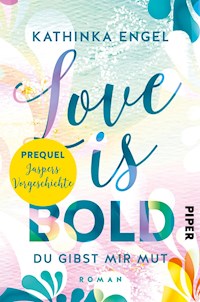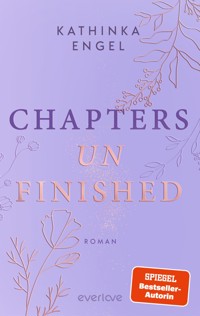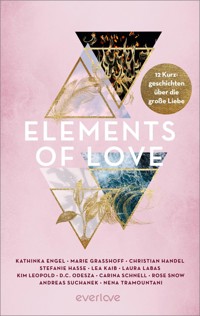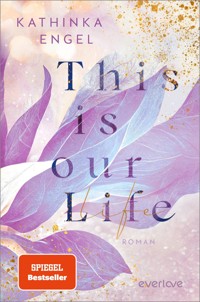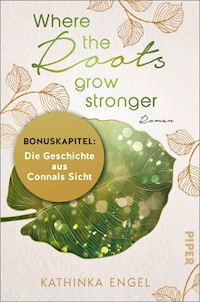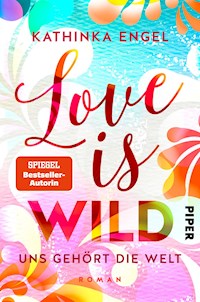9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie ist sein Hoffnungsschimmer in der dunkelsten Nacht Von der Liebe bitter enttäuscht, zieht Tamsin zum Literaturstudium ins kalifornische Pearley. Sie möchte sich auf sich selbst konzentrieren, den Männern hat sie ein für alle Mal abgeschworen. Doch dann trifft sie auf Rhys. Er ist unnahbar und faszinierend. Was Tamsin nicht weiß: Er saß seine gesamte Jugend unschuldig im Gefängnis. Jetzt muss sich Rhys plötzlich in einer ihm völlig fremden Welt behaupten. Auch er fühlt sich zu Tamsin hingezogen, die ihm voller Tatendrang hilft, alles Verpasste nachzuholen. Langsam beginnt er wieder zu vertrauen. Doch Rhys hat Tamsin noch längst nicht alles erzählt … »Finde mich. Jetzt« ist der Auftakt einer romantischen New Adult-Reihe der deutschen Neuentdeckung Kathinka Engel. Mit einer großen Portion Gefühl beschreibt die Autorin in der Finde-mich-Reihe das Auf und Ab der Liebe, lässt uns erst tief bewegt zurück und das Herz dann wieder ganz leicht werden. Unter dem Motto »Believe in second chances« erzählt sie von Neuanfängen, zweiten Chancen und der ganz großen Liebe. Perfekt für alle Fans von Mona Kasten und Laura Kneidl. Als leidenschaftliche Leserin studierte Kathinka Engel allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft, arbeitete für eine Literaturagentur, ein Literaturmagazin sowie als Übersetzerin und Lektorin. Mit ihrem Debüt »Finde mich. Jetzt« ist sie unter die Autoren gegangen. Wenn sie nicht gerade schreibt oder liest, trifft man sie im Fußballstadion oder als Backpackerin auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. »Ein zutiefst gebrochener, junger Mann. Eine starke, selbstbewusste und unabhängige Frau. Eine Liebe, die alle Hürden überwindet und die so tief greift, dass mir beim Lesen vor lauter Gefühl fast das Herz explodiert wäre.« Ina's Little Bakery »Eine wunderbare Liebesgeschichte voller zweiter Chancen. Gefühlvoll, emotional und dramatisch! Rhys & Tamsin sorgen definitiv für Herzklopfen!« primeballerina's books »Das Buch war großartig! So mitreißend, zart, gefühlvoll. Ich habe mich rettungslos in die Charaktere und die Geschichte verliebt. Ein paar Mal standen mir Tränen in den Augen und dann musste ich einfach nur wieder schmunzeln.« Kielfeder Die schönste Botschaft des Lebens: »Believe in second chances!« Lass dich in der »Finde mich«-Reihe fallen und vertraue darauf, von dieser berührenden New-Adult-Reihe aufgefangen zu werden. Die schönste Botschaft der Trilogie? Glaub an zweite Chancen. Denn manchmal braucht die Liebe einfach sehr viele Anläufe… Noch nicht genug von Kathinka Engel? Mit der »Love-is-« und der »Shetland-Love-Reihe« gibt es noch mehr von der deutschen Autorin zu lesen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover & Impressum
1 Tamsin
2 Rhys
3 Tamsin
4 Rhys
5 Tamsin
6 Rhys
7 Tamsin
8 Rhys
9 Tamsin
10 Rhys
11 Tamsin
12 Rhys
13 Tamsin
14 Rhys
15 Tamsin
16 Rhys
17 Tamsin
18 Rhys
19 Tamsin
20 Rhys
21 Tamsin
22 Rhys
23 Tamsin
24 Rhys
25 Tamsin
26 Rhys
27 Tamsin
28 Rhys
29 Tamsin
30 Rhys
31 Tamsin
32 Rhys
33 Tamsin
34 Rhys
35 Tamsin
36 Rhys
37 Tamsin
38 Rhys
39 Tamsin
40 Rhys
41 Tamsin
42 Rhys
43 Tamsin
44 Rhys
45 Tamsin
46 Rhys
47 Tamsin
48 Rhys
49 Tamsin
50 Rhys
51 Tamsin
52 Rhys
Danksagung
Leseprobe
1 Zelda
2 Malik
1 Tamsin
Heute ist ein Tag der Gegensätze. Ein Tag der letzten und der ersten Male, ein Tag der einsamen Traurigkeit und ein Tag der stillen Vorfreude. Ich habe zum letzten Mal den Briefkasten meiner Eltern geleert und zum ersten Mal meine neue Adresse auf Pakete geschrieben, die sehr zum Ärger des Postbeamten bis zum Rand mit Büchern und Schallplatten gefüllt waren. Ich habe auf der Beerdigung meines Großvaters zum letzten Mal von der wichtigsten Person in meinem Leben Abschied genommen und blicke gleichzeitig das erste Mal positiv und neugierig auf alles, was vor mir liegt.
Seit einer halben Stunde sitze ich nun endlich allein in meinem Kinderzimmer – in dieser rosa Hölle, in der nichts nach mir und alles nach meiner Mutter aussieht. Die letzten Beileidsbekundungen der Nachbarn konnte ich nicht mehr ertragen.
Sie streckten meinem Vater die Hand hin. »Mr Williams, Ihr Verlust tut uns leid.« Dann umarmten sie meine Mom. »Mrs Williams, wir fühlen mit Ihnen.« Niemand kam auf die Idee, mir sein Beileid auszusprechen, obwohl ich die einzige Person in diesem Haus bin, der er etwas bedeutet hat.
Aus der Küche dringt das Scheppern von Geschirr zu mir herauf. Meine Eltern sind also unten und werden mit Sicherheit nicht plötzlich hier hereinplatzen. Denn dass ich inmitten meiner Klamotten auf dem Boden sitze und Koffer packe, würde wohl definitiv zu Fragen führen. Die Fragen würden einen Streit auslösen, und dann müsste ich all meine Pläne begraben. Pläne, die mein Leben verändern sollen. Pläne, die ein aufgeregtes Kribbeln tief in meinem Innern verursachen.
Ich werde von hier weggehen. Heute Nacht, wenn alle schlafen, werde ich Rosedale den Rücken kehren und ein neues Leben beginnen – ein Leben als Studentin im beinahe dreitausend Meilen entfernten Pearley. Ich habe nur noch darauf gewartet, meinem Großvater ein letztes Mal Lebewohl zu sagen. Den Plan, zu gehen, hatte ich bereits in dem Moment gefasst, als er mich hier allein zurückließ. Denn nichts hält mich mehr in diesem provinziellen Nest. Absolut nichts.
Eine Packliste habe ich nicht. Vielleicht ist das waghalsig bei einem Umzug, aber die Dinge, die ich mitnehmen möchte, sind schnell gefunden. Alle Kleidungsstücke, die ich mir selbst ausgesucht habe, werfe ich in meinen Koffer. Was meine Mutter für mich gekauft hat, fliegt ohne jede Ordnung zurück in den Schrank. Ich bestimme, was ich in mein neues Leben mitnehme. Die Beerdigung meines Großvaters war die letzte Gelegenheit, bei der ich mir habe vorschreiben lassen, was ich anziehen soll.
Meine Vintagekleider aus dem Secondhandladen meines Vertrauens, die bestickten Hippieblusen vom Flohmarkt, die original 80er-Jahre-Jeans meiner Tante, die ich vor der Mülltonne gerettet habe – sie alle schaffen es in den Koffer. Nichts davon konnte ich je tragen, ohne dass meine Eltern die Nase rümpften. Mehr als einmal schickten sie mich sogar wieder in mein Zimmer, damit ich mir »etwas Anständiges« anzog.
Kurz überlege ich, was ich mit meiner Spitzenunterwäsche anstellen soll. Denn ich lasse nicht nur die strengen Regeln meiner Eltern in Rosedale zurück, sondern auch jede Ambition, mich jemals wieder auf eine Beziehung einzulassen. Andererseits brauche ich vielleicht Ersatz, wenn alles Bequeme in der Wäsche ist. Am Ende siegt die Faulheit und ich kippe einfach den gesamten Inhalt der Schublade in meinen Koffer.
Koste das Leben voll aus. Diesen Ratschlag meines Großvaters werde ich beherzigen. Ab jetzt. Ich habe heute zum letzten Mal das brave, folgsame Mädchen gespielt. Denn ich habe zum ersten Mal eine Entscheidung für mich allein getroffen. Ein Lächeln breitet sich auf meinem Gesicht aus, als mir bewusst wird, dass all das hier schon bald der Vergangenheit angehört.
Ich sehe es schon vor mir: wie ich mit Kommilitoninnen und Kommilitonen über Literatur diskutiere, in der Bibliothek arbeite, bis mein Kopf raucht. Ich will mit Sam auf wilde Studentenpartys gehen, neue Leute kennenlernen.
Sam ist mein bester Freund, meine bessere Hälfte. Und nach allem, was war, der einzige Mann, den ich noch in meine Nähe lasse, bis ich ungefähr achtzig bin. Wir waren lange Zeit Nachbarn, bis er fürs Studium nach Kalifornien zog. Inzwischen promoviert er in Pearley. Eigentlich wollte ich ihn darauf vorbereiten, dass sich meine Pläne geändert haben und ich nach Kalifornien komme. Doch zwischen meinen Vorbereitungen und der Beerdigung hatte ich noch keine Zeit, ihn anzurufen. Eine einfache Textnachricht erschien mir zu wenig. Ich will wenigstens seine Stimme hören, wenn er die aufregenden Neuigkeiten erfährt.
Mir vorzustellen, was mich erwartet, verstärkt das kribbelige Gefühl noch. Die Bilder in meinem Kopf machen den Aufbruch so richtig real. Ich wische meine feuchten Hände an einem Oberteil ab, das aussieht, als wäre es in den späten Neunzigern der letzte Schrei bei Sekretärinnen kurz vor der Pensionierung gewesen, und werfe es in den Schrank. Dann setze ich mich auf meinen Koffer, um den Reißverschluss zuzumachen. Hoffentlich platzen die Nähte nicht auf.
Mein Blick wandert durchs Zimmer. Nichts von all dem Kram, den ich zurücklasse, bedeutet mir etwas. Da sind die scheußlichen Nippesfigürchen in ihrer beleuchteten Vitrine, die meine Mutter mir jedes Jahr zum Geburtstag schenkt – natürlich viel zu wertvoll, als dass ich als Kind damit hätte spielen dürfen. Auf meiner Kommode stehen sinnlose Pokale, die von meinen vergangenen Erfolgen bei Buchstabier- und Vorlesewettbewerben zeugen. Das türkisfarbene Ungetüm von einem Ballkleid, das meine Mom mir zum Abschlussball aufgezwungen hat, hängt an der offenen Tür meines begehbaren Kleiderschranks. Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, dass meine Mutter jemals meine Wünsche wahrgenommen, geschweige denn respektiert hätte. Mein Zimmer – ihre Deko. Mein Abschlussball – ihr Kleid. Meine Freunde – ihr Urteil.
Ich lege mich das letzte Mal in mein Bett. Die Kleider behalte ich an, damit ich bereit bin, wenn um vier Uhr mein Wecker klingelt. Meine etwas ramponierte Ausgabe von Pu der Bär liegt noch auf dem Nachttisch. Wie jeden Abend lese ich ein paar Seiten. Denn ich bin überzeugt, wenn man lesend einschläft, werden die Träume schöner. Mit dem Buch in der Hand und dem unangenehm süßlichen Weichspülergeruch meiner perfekt gebügelten Bettwäsche in der Nase schlafe ich langsam ein.
Beim ersten Klingeln des Weckers bin ich sofort hellwach. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt richtig geschlafen habe. Mit einer App auf meinem Handy organisiere ich mir ein Uber. Die Adresse, die ich angebe, ist um die Ecke. Um jeden Preis muss ich verhindern, dass meine Eltern von einem laufenden Motor geweckt werden. Leise schleiche ich mich in mein Badezimmer, putze mir die Zähne und wasche mein Gesicht. Im Spiegel sehe ich irgendwie anders aus als noch vor ein paar Tagen. Irgendwie erwachsener. Als würde ich tatsächlich nicht mehr hierhergehören. Meine braunen Haare wellen sich über meine Schultern. Dazwischen schauen mich zwei etwas zu groß geratene braune Augen an. Ich lächle mir selbst zu, wie um mir zu sagen, dass das hier richtig ist. Und mein Spiegelbild lächelt das erste Mal seit Langem überzeugend zurück.
Ein Neuanfang. Danach sehe ich aus. Und ein Neuanfang soll es werden. Ohne meinen Großvater zwar, aber auch ohne … Nein, ich verbiete mir jeden Gedanken an ihn. Und ohne meine Eltern, die mich am liebsten für immer hier in Rosedale halten würden und die mir keine Wahl gelassen haben, als sie sagten: »Du studierst in Rosedale oder gar nicht.« Doch jetzt lasse ich ihnen keine Wahl. Ich habe mir fest vorgenommen, ab jetzt mein Leben selbst zu leben. Mich nicht von ihren Ängsten und Bedenken der Welt gegenüber anstecken zu lassen.
Meine letzten Toilettenartikel fliegen zu Pu der Bär in den Rucksack. Es ist die erste große Reise, die dieses Buch unternimmt. Ich setze den Rucksack auf und hebe den Rollkoffer hoch. Um keinen Lärm zu machen, muss ich ihn tragen.
Beinahe lautlos gelange ich ins Erdgeschoss. Erst jetzt erlaube ich mir, auszuatmen. Mein Herz schlägt schnell. Ich stelle den Koffer ab, froh über die Pause, die ich meinen Armen gönnen kann. Dann gehe ich ins Wohnzimmer. Ich traue mich nicht, das Licht einzuschalten, und taste mich behutsam im Halbdunkel vorwärts. Meine Hände erfühlen den Designer-Glastisch, auf dem die Sukkulenten-Sammlung meiner Mutter steht.
Aus meiner Hosentasche ziehe ich einen etwas zerknitterten Brief und lehne ihn an einen der Blumentöpfe. Darin erkläre ich meinen Eltern, dass ich nach Pearley gehe, um mein eigenes Leben zu führen. Es ist vielleicht nicht gerade die feine englische Art, einfach zu verschwinden, aber nach den Erlebnissen der letzten Tage fühle ich mich nicht imstande, einen Kampf mit ihnen auszufechten. Und ein Kampf würde es werden. Es ist einfacher, sie vor vollendete Tatsachen zu stellen. Das wird es auch für sie leichter machen. Hoffe ich zumindest.
Gegenüber vom Glastisch steht das spießige Blumensofa, auf dem man nicht krümeln darf. Meine Finger gleiten über die Oberfläche. Ob mich bei diesem letzten Mal wohl noch ein wenig Nostalgie oder Wehmut überkommt? Zwei Schritte nach vorn und ich stoße beinahe an den schweren, dunklen Sekretär, für den meine Eltern auf einer Antiquitätenauktion ein Vermögen ausgegeben haben. Das Gesprächsthema Nummer eins bei jeder langweiligen Dinnerparty.
Zurück im Flur ertaste ich mit den Fingern die Garderobe. Im Schuhregal finde ich meine geliebten Chucks. Meinen Eltern waren sie immer ein Dorn im Auge. Ihrer Meinung nach laufen nur »fragwürdige Jugendliche« mit diesen Schuhen herum. Aber zum ersten Mal in meinem Leben kann mir völlig egal sein, was sie denken oder sagen. Ich schnappe mir meine Jacke von der Garderobe, da es Anfang September in Maine nachts recht kühl ist.
Als ich die Tür öffne, weht mir frische Nachtluft ins Gesicht. Ich atme einmal tief ein und hieve meinen Koffer über die Schwelle nach draußen. Ganz vorsichtig, Zentimeter für Zentimeter, ziehe ich die Tür hinter mir zu, bis sie mit einem leisen Klicken langsam ins Schloss gleitet. Geschafft!
Noch wage ich es nicht, meinen Koffer zu ziehen, und trage ihn stattdessen die Einfahrt hinunter. Als ich auf der Straße vor unserem Haus stehe, stelle ich den Koffer ab und blicke mich noch ein letztes Mal um. Ich forme mit meinen beiden Daumen und Zeigefingern ein Viereck und konzentriere mich auf den Anblick meines Elternhauses. Diesen Moment will ich in meinem geistigen Fotoalbum festhalten – meinen Abschied von Rosedale. Ich betätige den imaginären Auslöser meiner Kopfkamera. So hat es mir mein Großvater beigebracht, als ich noch klein war. Seine Worte kommen mir in den Sinn: Auf diese Weise kannst du Momente, die nur für dich bestimmt sind, für immer festhalten. Es ist das erste Bild in meinem neuen Album.
Ich mache mich auf den Weg die dunkle Straße entlang, die wie ausgestorben vor mir liegt. Außer meinen Schritten und dem leisen Keuchen, weil mein Koffer von Minute zu Minute schwerer wird, ist kein Geräusch zu hören. Als ich um die Ecke biege, sehe ich dort die Rücklichter meines Ubers.
Der Fahrer, ein etwas mürrisch dreinblickender älterer Herr mit Baseballkappe, hebt den Koffer ohne jede Anstrengung in den Kofferraum.
»Wo soll es denn hingehen?«, fragt er.
»Zum Flughafen bitte«, sage ich mit klopfendem Herzen zum ersten Mal in meinem Leben.
2 Rhys
»So, Mr Bolton«, sagt Powell, einer der Wärter, »dann hoffe ich für Sie und uns, dass wir Sie hier nicht mehr zu Gesicht bekommen.«
Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich »Mr Bolton« genannt werde. Die letzten sechs Jahre war ich »Bolton« oder »52899«, Gefängnisinsasse des Pearley Juvenile Prison.
Powell händigt mir eine alte Plastiktüte aus. »Ihre Sachen«, sagt er. In der Tüte befinden sich eine Jeans und ein T-Shirt – die Klamotten, die ich anhatte, als sie mich mit fünfzehn hier eingesperrt haben. Schon damals war mir beides eigentlich zu klein. Was ich jetzt damit soll, weiß ich nicht, aber ich nehme die Tüte brav entgegen und quittiere den Empfang.
Powell eskortiert mich den langen Gang entlang, der neben diversen Hochsicherheitstüren und Schleusen den Trakt 2, in dem ich die letzten Jahre untergebracht war, vom Ausgang trennt. Metall- und Plastikröhren verlaufen an der Decke, und der gesamte Bau scheint zu summen.
Tief im Innern des seelenlosen Gebäudes betätigt jemand einen Knopf. Es ertönt ein dröhnendes Warnsignal – das Zeichen, dass die Tür jetzt entriegelt ist. Sie öffnet sich automatisch, und ich trete hindurch. In die Freiheit. Das erste Mal seit sechs verfluchten Jahren. Die Sonne blendet mich, und ich muss blinzeln. Ich stehe auf dem asphaltierten Vorplatz des PJP und habe das Gefühl, es sollte irgendetwas Großes passieren. Die Welt sollte mich, Rhys Bolton, willkommen heißen. Aber die Welt ist nicht mehr das, was sie war, als ich mich mit fünfzehn von ihr verabschiedet habe. Sie will mich nicht, und ich weiß nichts über sie. Wir sind einander völlig fremd.
Ich gehe einen Schritt und blicke dann noch einmal zurück. So richtig glauben kann ich es noch nicht. Aber tatsächlich, die Tür, durch die ich hinausgegangen bin, schließt sich in diesem Moment wieder – und ich stehe immer noch hier. Außerhalb der hohen Mauern, die jede Freude, jeden Traum ersticken. Draußen. Vermutlich sollte ich glücklich sein, mich verdammt noch mal federleicht fühlen. Aber ich fühle nichts. Ich merke nur, dass meine Jeans und der viel zu große Kapuzenpulli, die meine Sozialarbeiterin mir besorgt hat, zu warm sind für den kalifornischen Sommer. Aber in meine Sachen von damals, die ich als einzige Erinnerung an mein früheres Leben in der Hand halte, passe ich nun mal nicht mehr. Mit dem Jungen von damals habe ich nichts mehr zu tun. Innerlich wie äußerlich. Denn wenn man den Wichsern im PJP körperlich nichts entgegensetzen kann, wird man kaputt gemacht. Noch kaputter. Jetzt kann ich jedem Arschloch, das mir zu nahe kommt, den verdammten Schädel einschlagen.
Obwohl ich weiß, was meine nächsten Schritte sein sollten, stehe ich unschlüssig herum. Ich will mich nicht bei Amy melden. Das ist die Sozialarbeiterin mit dem »richtigen Riecher« für Kleidergrößen. Sie hat mir ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft besorgt und einen Job in einem Café, das »Leuten wie mir« eine zweite Chance gibt. Sie hat mir die Adresse ihres Büros aufgeschrieben, dort soll ich mich melden, wenn ich »draußen bin«. Aber ich habe keine Lust. Nicht auf Amy, nicht auf das Zimmer, nicht auf den Job. Ich will hier stehen und mich irgendwann auflösen. Komplett verschwinden. Dieses Leben ist nicht für mich. Für irgendjemanden, sicher. Aber nicht für mich. Für mich ist es eigentlich schon vorbei.
Doch es gibt da eine Sache, die ich mir geschworen habe. Den einen Gedanken, der mich am Leben gehalten hat. Ein Bild steigt vor meinem inneren Auge auf. Es ist verschwommen, so lange ist es inzwischen her. Aber ich halte es fest, klammere mich daran. Und siehe da, meine Füße setzen sich in Bewegung. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Sohlen meiner zu kleinen Schuhe sehr dünn sind und der heiße Asphalt sich langsam in meine Fußsohlen brennt. Aber ich habe immerhin dieses eine Ziel. Und um das zu erreichen, muss ich wissen, wo er sie versteckt. Dafür brauche ich eine Internetverbindung. Und dafür brauche ich eine Bude. Und ich brauche einen Laptop, wofür ich wiederum den Job brauche. Also brauche ich Amy.
Ich habe keinen mickrigen Cent für den Bus, der ohnehin nur einmal pro Stunde fährt, wie mir der Fahrplan verrät, auch wenn es schwer ist, etwas darauf zu erkennen, so vergilbt, wie er ist. Zu allem Überfluss hat jemand mit einem wasserfesten Filzstift seine hässlichen Initialen darüber verteilt.
Also werde ich zu Fuß gehen. Der Weg führt mich durch meine alte Nachbarschaft. Durch unsere alte Nachbarschaft. Ich überlege, ob ich einen Umweg gehen soll, um unser Haus nicht sehen zu müssen, um die Leere, die ich fühle, nicht bestätigt zu sehen. Denn sie sind nicht mehr da.
Die Neugierde siegt, und so mache ich mich auf den Weg an der heißen Straße entlang. Grillen zirpen laut in den Grasstreifen zu beiden Seiten. Es gibt keinen Fußweg, aber in dieser Gegend ist nicht viel Verkehr. Als ich die ersten Häuser erreiche, bin ich beinahe überrascht, wie abgefuckt es hier ist. In der Erinnerung habe ich meine Herkunft und mein trauriges Leben vermutlich verklärt. Die Fenster, sofern sie noch Scheiben haben, starren mich an wie schwarze Löcher. In den Vorgärten liegt Müll, der langsam von Unkraut überwuchert wird.
Ich biege in unsere Straße ein. Einige staubige Autos, die ihre beste Zeit längst hinter sich haben, parken am Straßenrand. Aus irgendeinem Haus dringt Kindergeschrei, das gleich darauf wieder verstummt. Probleme und Streitigkeiten werden in dieser Gegend ohne viele Worte gelöst.
Ich setze beinahe widerwillig einen Fuß vor den anderen, wage es kaum, den Blick zu heben. Das Haus, in dem ich meine Kindheit verbracht habe, ist nicht einmal hundert Meter von mir entfernt. Doch ich zwinge mich, weiterzugehen. Ich muss den Schmerz spüren. Ein letztes Mal.
Als ich direkt davor stehe, hebe ich den Blick. Es ist ein kleines, schäbiges Haus. Eine graue Fassade, von Rissen durchzogen. Eine morsche Holztreppe führt zur Eingangstür, in der ein kaputtes Fliegengitter hängt.
Offensichtlich wohnt jemand in dem Haus, denn ich erkenne neue Gardinen in den Fenstern. Ich starre hinauf zum ersten Stock. Dort oben war mein Zimmer. Das Zimmer, aus dem sie mich herausgerissen haben, mich, einen unschuldigen Fünfzehnjährigen. In mir verkrampft sich alles. Ich höre vergangenes Kinderlachen, das Klappern meiner Mom in der Küche. Und sein Brüllen. Sein Wüten.
Ich wende mich ab. Schnell setze ich meinen Weg fort. Dieser Ort ist für mich gestorben. Ich muss einen neuen finden, ein Zuhause für uns. Fernab von allem Bösen. Ich werde für uns stark sein. Stärker als jemals zuvor. Ich werde das hier hinkriegen. Das Leben, die Freiheit. Bei dem Gedanken wird mir übel und ich stütze mich auf der Motorhaube eines Autos ab, weil mir die Luft wegbleibt. Das rostige Metall ist heiß, und ich verbrenne mir beinahe die Finger.
Ich brauche Amys Hilfe.
Eine halbe Stunde später stehe ich vor einem heruntergewirtschafteten Gebäude, in dessen erstem Stock Amys Büro sein soll. Die Klingelanlage hängt an den Drähten aus der Wand und ich mache mir nicht die Mühe, sie auszuprobieren. Ich drücke die holzgerahmte Glastür auf, an deren Innenseite Flyer hängen. Entzugskliniken, Selbsthilfegruppen, Seelsorgetelefon, all so nutzloser Kram, den man erst braucht, wenn es schon längst zu spät ist. Aber hey, ruf uns an, dann wird alles wieder gut! Von wegen. Eher: Ruf uns an, damit wir unser schlechtes Gewissen beruhigen können.
Ich hoffe, Amy ist anders. Sie hat mich in den letzten Wochen ein paarmal besucht und wirkte okay. Nicht, dass es eine Rolle spielt, aber ich bin kein Mittel zum Zweck. Ich bin sicher nicht hier, um ihr Gewissen zu beruhigen, falls es das ist, was sie will.
Das Treppenhaus ist angenehm kühl nach meinem Fußmarsch durch diese Affenhitze. Ich wische mit dem Ärmel über meine Stirn und gehe die Stufen hoch. Auch hier hängen an der Wand Plakate für irgendwelche bescheuerten Programme. Jugendliche Straftäter, die in die Gesellschaft integriert werden sollen, Förderkurse – nichts für mich. Am Treppenabsatz angekommen zögere ich einen Moment. Was, wenn ich mich einfach nicht bei ihr melde? Was, wenn ich den Rest mit mir selbst ausmache, verschwinde und nicht mehr wiederkomme in dieses verfluchte Nest, das bis auf Elend und Verzweiflung nichts hervorbringt?
Aber natürlich trete ich ein. Ich bin es so gewohnt, keine Wahl zu haben, dass ich mich einfach füge. Wie armselig ich bin. Keine Ahnung von der Welt, kein Wille, kein Drive.
Amy sitzt an einem Schreibtisch voller Ordner und Unterlagen. Sie sieht auf und lächelt mich an.
»Hey, Rhys! Du bist schon da! Ich habe erst heute Nachmittag mit dir gerechnet«, ruft sie für meinen Geschmack etwas zu laut. Sie scheint begeisterter über meine Entlassung zu sein als ich.
»Hi«, sage ich kurz. Ich habe keine Lust auf Small Talk.
Sie lächelt freundlich. Ihre Schneidezähne stehen ein bisschen zu weit auseinander. Ihre blonden Haare hat sie zu einem unordentlichen Pferdeschwanz nach hinten gebunden. Sie wirkt locker. Genau das Gegenteil von mir. Ich weiß nicht, wohin mit mir, mit meinen Händen. Ich passe hier nicht hin. Amy steht auf und bedeutet mir, ihr zu folgen. Im Nebenraum steht eine Sitzgarnitur. Sie nimmt auf einem Sessel Platz, und ich lasse mich auf die Couch fallen.
»Na, dann schauen wir mal, was wir mit dir machen. Hast du für den Anfang schon irgendwelche Fragen? Dass ich eine Unterkunft und einen Job für dich organisiert habe, weißt du ja schon.«
»Nee, passt.« Ich habe wirklich keine Lust auf ein Gespräch. Es ist mir viel zu viel: die Räumlichkeiten, Amy, einfach alles.
»Okay, du weißt, dass du immer herkommen kannst, wenn etwas ist. Ich würde gerne – wenn du erlaubst – in der ersten Zeit ab und zu bei der Arbeit oder auch bei dir zu Hause vorbeikommen. Nur um sicherzugehen, dass es dir gut geht.«
»Mhm.« Das klingt ja fantastisch. Verdammte Freiheit, dafür Überwachung, oder was?
»Sehr schön. Danke für dein Vertrauen, das weiß ich zu schätzen. Ist ja nicht selbstverständlich.« Sie schlägt die Beine übereinander, greift nach einem Ordner und reicht mir daraus ein paar Blätter.
»Hier ist deine Adresse. Du wirst erst mal noch allein in der Wohnung wohnen. Allerdings ist nur eines der Zimmer für dich. Das andere wird bald vergeben. Leider wurde der Junge, mit dem du eigentlich dort hättest wohnen sollen, rückfällig. So was ist immer schwer.« Die letzten Worte sagt sie etwas leiser. Als würde es sie wirklich interessieren, was mit uns armen Schweinen passiert. »Das Café, in dem du arbeiten kannst, ist Teil eines Resozialisierungsprogramms. Dein Chef ist einer von den Guten. Ein echt netter Kerl, dem soziale Projekte in Pearley am Herzen liegen. Die meisten deiner Kollegen sind allerdings Studenten. Nicht jeder ist leicht vermittelbar.«
Ich schnaube. Leicht vermittelbar, wie das klingt. Als wäre ich ein beschissener Straßenköter. Ich brauche keine Gefallen. Ich komme schon klar. Aber das sage ich nicht. Ich halte einfach meine Klappe.
Sie lächelt wieder und fährt fort: »Also, da du schon so früh da bist, würde ich vorschlagen, dass ich dich erst mal nach Hause bringe.« Nach Hause. Sie sagt tatsächlich nach Hause. Ich weiß nicht mal, was das bedeuten soll. »Hast du irgendwelche Sachen?«
Ich deute auf die Plastiktüte. Mehr habe ich nicht – hatte ich vor sechs Jahren auch nicht. Woher denn auch? Er hat mir alles weggenommen. Er. Da ist er schon wieder. Immer wieder stiehlt er sich in meine Gedanken. Und mit ihm ein anderes Gesicht. Ein schönes, freundliches. Doch ich vertreibe es aus meinen Gedanken. Noch ist nicht die Zeit. Ich gebe mir einen Ruck. »Sonst habe ich nichts. Nur die Klamotten, die du mir mitgebracht hast. Danke übrigens.« Die letzten Worte nuschele ich in mich hinein.
»Kein Problem. Ich habe mich wohl bei der Größe vertan. Allerdings muss man zu meiner Verteidigung sagen, dass ich nicht gerade viel Auswahl habe. Die Spenden, die wir bekommen, passen in den seltensten Fällen. Der Vorbesitzer deines Sweatshirts war anscheinend deutlich dicker als du.« Sie lächelt wieder, und ich tue ihr den Gefallen und lächle auch. Es fühlt sich komisch an. Verzerrt. Also lasse ich die Mundwinkel wieder sinken. »Wenn du magst, kannst du mal im Lager schauen, ob dich etwas anlacht.«
»Okay«, sage ich. Denn schaden kann es nicht, ein bisschen Auswahl zu haben. Bis ich meinen Plan in die Tat umsetzen kann, werden sicher einige Monate vergehen. Ich weiß ja nicht einmal, wo ich anfangen soll, zu suchen. So lange kann ich schlecht in diesem hässlichen Sack herumlaufen.
Amy steht auf, und ich folge ihr. Sie geht aus dem Büro und sperrt eine Tür auf dem gleichen Stockwerk auf. Dahinter verbirgt sich offensichtlich eine Art überdimensionale Rumpelkammer. Es riecht leicht muffig. Sie knipst das Licht an und weist auf einige Kleiderstangen. »Hier, die kannst du gerne durchschauen. Ich gehe mal auf eine Zigarette raus – ja, ich weiß, ich sollte nicht rauchen«, schiebt sie hinterher und blickt beschämt zu Boden.
Ich zucke nur mit den Schultern. Ist mir doch egal.
»Komm einfach runter, wenn du fertig bist. Dann gehen wir zusammen rüber. Hier sind Müllsäcke, stopf einfach alles rein, was dir gefällt.« Damit dreht sie sich um und geht.
Ich bin froh, allein zu sein. Es ist brutal anstrengend, die ganze Zeit vollgequatscht zu werden. Ich gehe auf die Kleiderstangen zu. Nach einigem Durchforsten habe ich ein paar Jeans gefunden, die aussehen, als könnten sie passen, und vier T-Shirts. Ein Paar ausgelatschte Sneakers in meiner Größe steht auch herum. Die zu kleinen Schuhe und die Tüte mit meinen Sachen lasse ich da. Den Rest stopfe ich in einen Müllsack, knipse das Licht aus und mache mich auf die Suche nach Amy. Obwohl sie mir herzlich egal ist, und ich für sie nur ein Job bin, ist sie doch der einzige Fixpunkt, den ich im Moment habe. Sie steht vor dem Gebäude und raucht. Als sie mich sieht, lächelt sie wieder und hält mir ihre Schachtel Zigaretten hin. Ich nehme eine. Sie gibt mir Feuer, und ich inhaliere tief.
»Danke«, sage ich und meine es wirklich ernst. Diese Zigarette tut unglaublich gut und lässt mein Leben weniger fremd wirken. Ein Stück Normalität in der Fremde. Ich lehne mich gegen die Wand und schließe die Augen.
»Das ist sicher alles viel für dich«, sagt Amy. Ist sie eigentlich nie still? »Aber ich bin da, in Ordnung?« Sie zeigt auf meinen Müllsack. »Schön, dass du was gefunden hast. Bald kannst du dir von deinem Lohn auch was Neues kaufen. Aber für den Anfang ist es besser als nichts.«
Ich nicke. »Ja, passt schon.« Allerdings bezweifle ich, dass ich mir sonderlich viel von meinem Lohn werde kaufen können. Er reicht gerade einmal für die Miete und Lebensmittel. Ich nehme noch einen tiefen Zug.
»Sollen wir dann?«, fragt Amy. Sie kann es anscheinend kaum erwarten.
»Klar«, erwidere ich. Und gemeinsam machen wir uns auf den Weg.
In der Nachbarschaft, in der sich meine Wohnung befindet, sind die meisten Häuser abgerissen worden. Meine Wohnung ist in einem Wohnhaus, das früher mal links und rechts von weiteren Häusern flankiert wurde, jetzt aber frei steht. Der Putz bröckelt.
Im ersten Stock schließt Amy eine Tür auf und gibt mir gleich den Schlüssel. Drinnen riecht es seltsam fremd. Mein Zimmer ist klein und miefig. Ein Einzelbett steht darin, eine Kommode, ein Tisch mit einem wacklig aussehenden Stuhl. Die Wände sind kahl. Ich komme jedoch kaum dazu, mich in der abgefuckten Bude umzusehen. Denn Amy schlägt vor, gleich noch zu Mal’s Café zu gehen. Dann könne ich mich schon mal vorstellen und mit allem vertraut machen. Sie verschwendet wirklich keine Zeit. Ich hätte mich lieber auf mein Bett gelegt und eine Woche lang geschlafen, so müde bin ich. Aber wie heißt es so schön: Zeit ist Geld. Und Geld ist der Anfang von allem, was ich vorhabe.
Im Café werde ich als Erstes Malcolm vorgestellt. Er ist der Besitzer und freut sich offensichtlich, Amy zu sehen – und auch mich. Nach den üblichen Floskeln einer Begrüßung klopft er mir auf die Schulter. Ich zucke zusammen. Ich will nicht angefasst werden, schon gar nicht von einem alten Kerl, den ich gerade mal zwei verdammte Minuten kenne.
»Rhys wird sich hier bestimmt gut machen«, versichert Amy. »Oder, Rhys?«
»Mhm«, murmele ich. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll.
Wir gehen gemeinsam in die Küche, deren Zugang sich hinter dem Tresen befindet. Dort ist es unerträglich heiß.
»Hey, Mann«, ruft ein gut gelaunter Südamerikaner, der auf den Edelstahloberflächen Gemüse schnippelt. Er will mit mir abklatschen. »Ich bin Ernesto, aber alle nennen mich ›Che‹.«
»Hey«, erwidere ich und tue ihm den Gefallen eines High Five. »Rhys.«
»Freut mich! Endlich mal wieder ein richtiger Kerl – wenn man Ollie nicht zählt.« Er senkt verschwörerisch die Stimme. »Ollie ist lesbisch.«
Für diesen Kommentar boxt Malcolm ihn sanft in die Schulter. Anscheinend tatscht er einfach gern. Beide lachen laut. Ich versuche es noch mal mit einem bescheuerten Lächeln, aber es wirkt wieder so fremd, dass ich beschließe, es ab jetzt bleiben zu lassen.
Wir lassen Che in der Küche allein, und Malcolm beginnt, mir alles zu erklären. Kaffeemaschine, Kaffee, Milch, Becher, Deckel. Tassen für die Kunden, die sich an einem unserer Tische niederlassen wollen. Eimer und Lappen, um die Tische zu wischen. Muffins, Brownies, Donuts. Er drückt mir eine Schürze in die Hand und sagt: »Du teilst dir die Schichten mit Ollie und Liz, die immer kommt, wenn Not am Mann ist. Heute haben sich beide krankgemeldet, deswegen bin ich hier alleine. Traust du dir zu, schon einzuspringen?«
»Äh«, stottere ich, denn damit habe ich nicht gerechnet. Ich möchte einfach nur meine Ruhe haben.
»Ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist«, sagt Amy. »Rhys ist noch gar nicht richtig angekommen.«
»Oh, ach so, entschuldige, Rhys. Das ist kein Problem. Dann fängst du ganz normal deine erste Schicht übermorgen bei uns an. Hier ist der Schichtplan.« Mit diesen Worten gibt er mir einen Ausdruck. »Amy, kann ich dich noch kurz unter vier Augen sprechen?«
»Klar, für dich hab ich immer Zeit«, sagt Amy lächelnd.
Zu zweit gehen sie durch einen Vorhang ins Hinterzimmer. Endlich habe ich kurz Zeit, mich umzusehen. Das Café sieht normal aus, aber was weiß ich schon. Es ist ja nicht so, als sei ich in letzter Zeit in vielen Cafés gewesen. Das Holz der Tische gefällt mir. An der Wand hängen Bilder. Auf einem Schild lese ich, dass sie von lokalen Künstlern gemalt wurden. Ich widme mich der Kaffeemaschine.
3 Tamsin
Eingerahmt von meinem Gepäck warte ich vor meinem mit Graffitis verzierten Wohnhaus auf die Maklerin, die mir den Schlüssel vorbeibringen wollte. Mich beschleicht ein leicht mulmiges Gefühl, das ich aber sofort ignoriere. Ja, vielleicht habe ich unbesehen vor ein paar Tagen über eine Website eine Wohnung angemietet. Vielleicht war es die erstbeste, die ich finden konnte. Und ja, vielleicht ist das im Nachhinein betrachtet etwas leichtsinnig gewesen. Aber fangen nicht alle guten Abenteuer mit Leichtsinn an? Ich bin eine Viertelstunde zu früh und beschließe, meine Eltern anzurufen. Inzwischen müssten sie meinen Brief gefunden haben.
Als das Freizeichen ertönt, bin ich nervös. Ich sehe meine Eltern vor meinem inneren Auge. Entsetzt über ihre Tochter; schockiert darüber, dass ich sie übergangen habe. Ich lasse es lange läuten und will schon auflegen, als ich höre, wie jemand abhebt.
»Hallo, hier ist Tamsin«, sage ich. »Ich wollte sagen, dass ich gut angekommen bin.«
Am anderen Ende herrscht eisiges Schweigen. Gut, das war vermutlich zu erwarten. Auf einmal kommt mir mein Plan, einfach zu verschwinden, ziemlich blöd vor. Andererseits haben meine Eltern mir unmissverständlich klargemacht, dass sie alles daransetzen würden, mich in Rosedale zu halten.
»Dass du uns das antust«, flüstert meine Mom plötzlich am anderen Ende der Leitung. »Das ist unverzeihlich.«
»Es tut mir leid, Mom«, sage ich. »Ich musste das tun. Für mich. Ihr habt mir keine Wahl gelassen. Du weißt ganz genau, dass ihr mich nicht hättet gehen lassen.«
»Selbstverständlich nicht!« Sie spricht jetzt lauter, was anscheinend meinen Dad alarmiert. Aus dem Hintergrund höre ich ihn brüllen.
»Du telefonierst doch nicht etwa mit ihr? Leg sofort auf, Francine. LEGAUF, HABEICHGESAGT.«
»Ich muss Schluss machen«, sagt meine Mom und weg ist sie.
Ich schlucke schwer. Ich weiß, dass ich meine Eltern verletzt habe. Und ich habe es sicher nicht leichten Herzens getan. Aber meine Mom hat mir soeben noch mal bestätigt, dass sie mich nicht hätten gehen lassen. Es war meine einzige Chance.
Ich lächle bemüht breit, als ich mich von der Maklerin verabschiede und endlich die Tür meiner eigenen Wohnung hinter ihr schließe. Obwohl, Wohnung ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber es sind eigene vier Wände. Ich schließe die Augen und atme tief ein. Dann drehe ich mich um und laufe aus dem winzigen Flur am Badezimmer vorbei in mein Zimmer.
Ein Moment für meine Kopfkamera. Mein neues Zuhause. »Klick«, mache ich, als ich ein imaginäres Bild von meiner Umgebung schieße.
Ich liebe es hier. Ich liebe die Tapete, die halb heruntergerissen ist und in den Fünfzigern sicher mal der letzte Schrei war. Ich liebe den feuchten Fleck in der einen Ecke über dem beigefarbenen, abgewetzten Samtsessel. Er erinnert mich an Wasserfarben, und das ist gut, denn ich will nicht wissen, woher er wirklich stammt. Ich liebe den Blick aus meinen halb blinden Fenstern. Aus dem einen schaue ich auf die Straße, die links und rechts von parkenden Autos gesäumt ist. Auf der Straßenseite gegenüber ist ein Café, das mir vorhin schon aufgefallen ist. Und direkt neben meinem Wohnhaus bietet ein weiteres Fenster den Blick auf die ungefähr zwei Meter entfernte Hauswand eines leer stehenden Bürokomplexes, in dem sich bestimmt mal die Träume vieler Menschen erfüllen sollten. Start-ups und Kreativbüros. Was würde ich in einem eigenen Büro machen? Sofort fange ich an zu träumen. Meine eigene Literaturagentur. Oder ein Literaturmagazin. Oder … Ich lasse mich auf mein Bett fallen. Autsch! Meine Matratze ist eine Zumutung. Eine Feder bohrt sich in meinen Rücken, und ich beschließe, dass eine neue Matratze die erste Anschaffung werden muss. In meinem Kopf fange ich eine Liste an. Neben der Matratze brauche ich ein Regal für meine Bücher, einen Duschvorhang, einen zweiten Stuhl. Mir fällt sicher bald noch mehr ein, aber im Moment bin ich so zufrieden, dass ich nicht darüber nachdenken will, was mir fehlt. Koste das Leben voll aus, sage ich mir.
Ich habe es geschafft. Ich bin wirklich gegangen. Von Maine nach Kalifornien. Ich habe mich getraut. Und es war ganz leicht. Ich fühle mich so frei, beinahe, als würde ich schweben.
Wäre da nicht das nervtötende Vibrieren meines Handys, das mir gerade die ungefähr hundertste Nachricht in einer Woche ankündigt. »Wo bist du?«, »Melde dich!«, »Lass es mich erklären«, »Gib mir noch eine Chance«. Ich will es ignorieren, will mir diesen Moment nicht kaputt machen lassen. Männerfreie Zone. Das ist es, was diese Wohnung sein soll.
Nachdem ich mein neues Zuhause noch mal genau inspiziert habe, mache ich mich daran, meine Sachen auszupacken. Meine Klamotten hänge ich an die Kleiderstange, die neben dem Bett steht. Den Rest sortiere ich in die kleine Kommode unter einem der Fenster. Pu der Bär lege ich auf den Nachttisch. Das Buch sieht aus, als würde es genau hier hingehören. Meine Toilettenartikel räume ich ins Bad. Ich blicke in den Spiegel und mir fällt auf, dass auch ich so aussehe, als würde ich hier hingehören. Als Letztes stelle ich noch zwei Bilderrahmen auf. Eines der Bilder zeigt mich mit meinem Großvater.
Mit dem Daumen streiche ich über sein Gesicht. Ich bin diesem fantastischen Mann so unendlich dankbar für alles, was er für mich getan hat. Bei ihm habe ich gelernt, ich selbst zu sein, auch wenn ich dieses Selbst meistens für mich behalten musste. Auch dass ich hier in Pearley bin, verdanke ich vor allem ihm. Denn kurz nach seinem Tod bekam ich einen Anruf von einem »Mr Porter von Porter, Beck und Sealsfield«, einer Anwaltskanzlei in Rosedale. Dieser eröffnete mir, mein Großvater habe mir sechzigtausend Dollar vererbt. Ich fiel fast vom Stuhl – und hatte in diesem Moment die Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung für das Leben, gegen die Spießerhölle von Rosedale und mein Elternhaus, in dem ich mich nie wirklich frei gefühlt habe.
Das zweite Foto zeigt mich mit Sam, als wir noch Kinder waren. Die Aufnahme wurde kurz nach dem Einzug seiner Familie ins Nachbarhaus aufgenommen. Man sieht, wie ich ihn als Sechsjährige anhimmle, während er offensichtlich genervt ist. Ich liebe dieses Bild. Vor allem, weil die Freundschaft, die aus meiner Grundschulschwärmerei wurde, trotz des Altersunterschieds so lange gehalten hat. Und jetzt sind wir wieder in der gleichen Stadt! Der Gedanke an Sam zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht.
Allerdings weiß er ja noch gar nicht, dass ich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion meine Sachen gepackt habe und nach Pearley gezogen bin. Meine emotionale Aufgewühltheit und der allgemeine Trubel zu Hause ließen keine Zeit für Telefonate, bei denen ich die Zeitverschiebung hätte berücksichtigen müssen. Ich nehme mein Handy und wähle seine Nummer. Nach dem zweiten Klingeln meldet er sich.
»Tamsin!«, sagt er überschwänglich.
»Sam!« Ich imitiere seine Begeisterung.
»Das ist eine Überraschung. Was gibt’s?«
Ja, was gibt es? Das ist eine seltsam banale Frage, gemessen an der Antwort, die er gleich hören wird.
»Ich bin in Pearley«, sage ich lächelnd. Mein Herz schlägt schnell. Ich hoffe, er freut sich.
»Was? Warum hast du nicht gesagt, dass du mich besuchen kommst? Ich bin bis Sonntag gar nicht da!«
»Ich bin nicht zu Besuch. Ich bin hergezogen. Fürs Studium«, korrigiere ich ihn.
»Wie bitte?« Er gluckst. »Wann hast du dich denn dazu entschieden?«
»Erzähle ich dir, wenn wir uns sehen. Ist eine längere Geschichte. Erinnerst du dich, als wir vor ein paar Monaten aus Spaß zusammen meine Bewerbung umformuliert haben, um sie auch an die Pearley University zu schicken?«
»Natürlich erinnere ich mich daran«, sagt Sam. »Das war der Abend, an dem dein Dad unser Skype-Gespräch gecrasht hat, weil du beim Abendessen irgendeinen respektlosen Witz über die Republikaner gemacht hast.«
»Genau. Du hast gesagt, du würdest mit mir auf Studentenpartys gehen und durch Cafés und Bars tingeln. Ich weiß, das war damals ein Witz, aber wenn das Angebot noch steht, würde ich es gern in Anspruch nehmen.«
»Aber selbstverständlich steht das Angebot noch!« Er klingt immer noch leicht ungläubig. Aber nicht unglücklich. Ich kann aus seiner Stimme ein Grinsen heraushören. »Du bist echt irre, Tamsin. Ich bin die ganze Woche auf einer Summerschool, aber Sonntagabend können wir uns treffen. Soll ich uns einen Tisch bei meinem Lieblingsitaliener reservieren?«
»Sehr gern.«
»Perfekt. Dann haben wir ein Date.«
Haben wir natürlich nicht. Sam hat mit allen möglichen Studentinnen Dates, aber sicher nicht mit mir.
Es ist unglaublich. Ich werde am gleichen Institut studieren, an dem Sam promoviert. Ein paar allgemeine Kurse muss ich natürlich auch besuchen, ehe ich mich vollständig auf die Literatur konzentrieren kann, aber auch darauf freue ich mich. Die Schule hat mir nie gereicht. Ich war immer neugierig, noch mehr zu lernen – außer Trigonometrie. Ich wollte die Zusammenhänge der Welt verstehen und nicht nur an der Oberfläche entlangkratzen. Diese Möglichkeit bekomme ich jetzt an der Pearley University und kann es kaum erwarten, dass das Herbst-Trimester endlich beginnt.
Ich sehe mich schon die Bücher in meinem Sessel lesen, in der Bibliothek arbeiten – oder im Café. Wie eine richtige Studentin. Der Gedanke weckt in mir sofort die Entdeckerlust. Das Café gegenüber wäre vielleicht ein Ort, an dem es sich gut arbeiten und lesen ließe. Ich beschließe, es mir aus der Nähe anzusehen und gleich den Kaffee auszuprobieren.
In meiner Hosentasche rascheln ein paar kleine Dollarscheine. Es gibt Leute, die würden mich jetzt sicher schelten, dass ich schlampig mit meinem Geld umgehe. Dass es Geldbeutel gibt. Aber diese Leute gehören der Vergangenheit an, und ich finde es sehr praktisch, nicht erst mein Portemonnaie suchen zu müssen.
Aus einigen der Wohnungen, an denen ich im Treppenhaus vorbeikomme, dringen Geräusche. In der Wohnung direkt unter meiner läuft der Fernseher. Noch ein Stockwerk weiter unten höre ich eine Frau telefonieren. In einer anderen Wohnung wird offensichtlich gerade heftig gestritten. Auch wenn ich nicht glaube, dass meine Gegend wirklich gefährlich ist – zumindest hat die Maklerin mir versichert, dass ich hier gut aufgehoben sei –, so zieht der günstige Mietpreis sicher nicht nur Studenten wie mich an.
Draußen brennt die Sonne auf den Asphalt herunter. Anfang September ist in Kalifornien im Gegensatz zu Maine noch richtig Sommer. Von der anderen Straßenseite aus wirkt Mal’s Café sehr gemütlich. Links neben der Eingangstür ist ein großes Schaufenster, durch das ich in den Laden blicken kann. Drinnen stehen bunt zusammengewürfelte Holztische und -stühle. Ich laufe über die Straße, und als ich die Tür öffne, erklingt eine Glocke, die mich ankündigt. Ich trete ein und atme den betörenden Geruch von frisch gebrühtem Kaffee. An den Wänden hängen Bilder von verschiedenen Künstlern, die zum Verkauf angeboten werden. Es ist ein bunter Mix aus abstrakter Kunst und Landschaftsmalereien. Ja, hier lässt es sich aushalten.
Auf dem Tresen stehen große Gläser mit Cookies neben einer altmodischen Kasse. Dahinter dreht sich der Barista langsam um und sieht mich mit einem seltsamen Blick an. Sein Gesichtsausdruck ist eine Mischung aus Verwirrung und Panik. Wo bin ich denn hier gelandet?
»Hi«, sage ich, aber er nickt nur knapp. »Ich bin gerade gegenüber eingezogen«, erkläre ich ihm. Manchmal lockern solche Informationen merkwürdige Situationen auf. »Ich bin auf der Suche nach meinem neuen Stammcafé.«
Er sieht mich an, als hätte er keine Ahnung, was ich von ihm will. Ist das Konzept »Café« in Kalifornien ein anderes? Macht man hier keinen Small Talk?
»Aaaaalso«, sage ich gedehnt und studiere die Tafel über der silbern glänzenden Kaffeemaschine, auf der die verschiedensten Kaffeespezialitäten angeboten werden. »Ich glaube, ich nehme …« Vor lauter Frappuccinos und Lattes in verschiedenen Geschmacksvarianten bin ich etwas überfordert. »Ich glaube, ich nehme einfach einen schwarzen Kaffee.«
Ich lächle ihn breit an, aber sein Gesicht bleibt starr. Er glotzt mich einfach nur dämlich aus seinen eisblauen Augen an.
»Ich, also, hm«, macht er und räuspert sich. »Ich arbeite eigentlich noch gar nicht hier.« Er blickt zu Boden.
»Oh, ach so, entschuldige. Dann sind wir also beide neu hier«, sage ich und lache. »Ich bin Tamsin. Komischer Name, ich weiß.«
Langsam fühle ich mich ein bisschen dämlich. Der Typ fängt an, mir Angst zu machen, auch wenn er ziemlich gut aussieht. Ich habe den Männern zwar abgeschworen, aber auch ich bin nicht immun gegen ein derart markantes Gesicht. Soll ich noch einen Versuch unternehmen? Ich räuspere mich.
»Ich kann auch warten, kein Problem«, sage ich, um die Situation zu entschärfen. Was ist das nur für ein seltsamer Kerl, dass er nicht reagiert? Auch wenn er neu ist, ist das noch lange kein Grund, so ungehobelt zu sein. Entweder ist er dumm oder einfach nur extrem unhöflich.
»Mein Chef kommt gleich und macht dir deinen Kaffee«, bequemt sich der seltsame Kerl dann doch noch zu sagen.
Und tatsächlich, in diesem Moment wird der Vorhang zur Seite geschoben und eine sehr hübsche junge Frau und ein älterer Mann treten heraus.
»Ah, guten Tag«, begrüßt mich der ältere Mann. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Ja, ich hätte gern einen schwarzen Kaffee.« Ich kann nicht glauben, dass ich doch noch zu meinem Heißgetränk kommen werde.
Während ich warte, beobachte ich aus dem Augenwinkel die blonde Frau und Mr Unhöflich. Sie sagt seltsame Sachen zu ihm. Alles kann ich nicht verstehen, weil sie sich Mühe gibt, leise zu sprechen, aber ich höre ein paar Fetzen heraus.
»… nicht so schlecht für deinen ersten Tag … wird leichter … bin für dich da.«
Ich wüsste zu gern, um was es geht, aber ich möchte nicht lauschen. Also nehme ich den Kaffeebecher entgegen, zahle und laufe Richtung Tür. Die beiden blockieren mir leider den Weg, und eine Entschuldigung murmelnd dränge ich mich zwischen ihnen durch. Ich streife den ungehobelten Kerl mit dem Arm, und er macht einen Satz nach hinten, als hätte ich eine ansteckende Krankheit. So etwas ist mir wirklich noch nie passiert!
Auf der Straße drehe ich mich noch einmal um und schüttle kaum merklich den Kopf. Ob es wohl noch ein anderes Café in der Nähe gibt, in dem mein Traum von der kaffeesüchtigen Literaturstudentin wahr werden kann?
Am nächsten Tag kommen meine Bücherkisten. Ich bin froh, dass ich den höheren Preis für den Express-Versand in Kauf genommen habe, denn in der Fremde ist es schön, bekannte Dinge um mich herum zu haben. Als ich die Boxen öffne, entweicht ihnen ein zauberhafter Duft nach der Bibliothek meines Großvaters, nach Geborgenheit und Glücksmomenten zwischen Staub und vergilbten Seiten. Sofort steigen vor meinem inneren Auge Bilder seiner Wohnung auf. Ich wünschte, er könnte sehen, wie schön ich es hier habe! Schließlich war er die letzten neunzehn Jahre mein Verbündeter, mein Seelenverwandter. Der Einzige, bei dem ich mich verstanden und aufgehoben gefühlt habe.
Er war es, der mir mit fünf Jahren beibrachte, zu lesen. Der mir zeigte, dass ich in Büchern die Freiheit finde, nach der ich mich auf den Schutzbezügen unserer Sofagarnitur und in der geistigen Enge Rosedales immer gesehnt habe.
Kein Wunder also, dass meine Eltern mir die Besuche bei meinem Großvater verbieten wollten. Doch so folgsam ich ansonsten sein musste, diese eine Regel brach ich wieder und wieder. Keine Bestrafung der Welt konnte mich von seinen großen, dunklen Holzregalen fernhalten, die bis oben hin vollgestopft waren mit wunderschönen Klassikerausgaben. Beinahe jeden Nachmittag verbrachte ich in den unmöglichsten Sitzpositionen auf seinem gemütlichen ledernen Lesesessel – völlig versunken in fremde Welten.
Die Wohnung meines Großvaters war für mich der einzige Ort in ganz Rosedale, an dem ich das Gefühl hatte, ich selbst sein zu können. Hier musste ich nicht aufrecht sitzen, die Hände auf dem Tisch, Schultern zurück und Brust raus.
Ich schüttle das Gefühl der Enge, das mich überkommt, wenn ich an mein Elternhaus denke, von mir ab und widme mich wieder meinen Boxen.
Auf der Straße vor dem Café habe ich alte Obstkisten gefunden und sie an meiner Wand gestapelt. Ich hole ein Buch nach dem anderen aus den Kartons. Jedes einzelne behandle ich wie einen kostbaren Schatz. Mithilfe der Bücher stehen die Obstkisten sogar ziemlich stabil. Jetzt ist es richtig wohnlich. Ich finde, Bücher verleihen jedem Raum etwas Gemütliches und Lebendiges. Nicht nur sind die Buchrücken farbenfroh, man lernt auch noch viel über den Bewohner eines Zimmers. Ich war mal mit einem Jungen aus, in dessen Regal nur vier Bücher standen. Jedes hatte Ernährungs- und Fitnesstipps zum Inhalt. Mir war schnell klar, dass das mit uns nichts werden würde. Bei einer gewissen anderen Person war das anders. Er hatte viele Interessen, Pläne, Ziele. Wie kann man sich nur so in einem Menschen täuschen? Aber egal. Jetzt geht es nicht mehr um ihn. Jetzt geht es um mich!
Wie aufs Stichwort vibriert mein Handy.
Du kannst mich nicht ewig ignorieren.
Oh, doch. Das kann ich.
Meine Schallplatten lehne ich neben mein improvisiertes Regal. Mein Vater machte sich ständig lustig über meine Sammlung. Der Klang sei nicht gut genug, Vinyl zu empfindlich. Aber ich liebe den kratzigen Sound und das Gefühl, dass Musik etwas Zerbrechliches und Kostbares ist. The Velvet Underground, The Smiths, Nico, Talking Heads, The Clash. Über jedes Plattencover streiche ich einmal mit dem Finger, um sie willkommen zu heißen. Jetzt brauche ich noch einen Plattenspieler. Denn der, den ich zu Hause hatte, hätte die Reise nicht überlebt.
Ich mache mir eine Liste von den Dingen, die ich in den kommenden Tagen, bevor die Uni losgeht, noch erledigen muss.
Auf meine Liste schreibe ich:
Immatrikulation bestätigen
Online-Anmeldung für Unikurse
neue Matratze kaufen
Plattenspieler besorgen
Mom und Dad besänftigen
die Umgebung erkunden und hoffentlich ein neues Café finden
Damit habe ich einen Plan und es bleibt trotzdem noch genug Luft, um Sam zu treffen, zu lesen, den Campus kennenzulernen und die letzten freien Tage zu genießen. Ist das Leben nicht schön!
4 Rhys
Die nächste Zeit verbringe ich wie in einem Delirium. Ich schlafe viel, genieße die Stille um mich herum. Niemand schnarcht, ich werde nicht durch dieses scheußlich grelle Licht frühmorgens geweckt. Ich dusche lange und kann gar nicht fassen, dass ich dabei alleine bin. Manchmal habe ich den Eindruck, ich würde laute Männerstimmen vernehmen, aber das bilde ich mir nur ein. Ich nehme das erste Mal seit sehr langer Zeit meinen eigenen Körper wahr. Meine Hände verteilen die Seife auf meiner Brust und fühlen die Muskeln unter der Haut. Ich spanne sie an. Im Gefängnis bedeuteten sie Schutz. Ich habe trainiert, um fit zu sein, mich wehren zu können. Jetzt – ich weiß es nicht. Nichts, was ich tue, dient einem unmittelbaren Zweck. Es geht nicht mehr ums Überleben. Jetzt geht es ums Leben, und davon verstehe ich nichts.
Es fühlt sich seltsam an, Berührungen aktiv wahrzunehmen. Malcolms Hand auf meiner Schulter, der Arm des gesprächigen Mädchens aus dem Café an meiner Brust, meine Hände, unter denen Seife schäumt. Einerseits ist da nichts – als wären meine Nerven abgestumpft. Andererseits sind mir Berührungen so bewusst wie noch nie zuvor. Ich kann nicht einmal sagen, ob es mir gefällt. Ich weiß, dass es mir Angst macht. Nähe empfinde ich als bedrohlich. Und wer will es mir verdenken nach der ganzen Scheiße? Aber ich muss lernen, Menschen wieder in meine Nähe zu lassen. Sonst ist mein Plan zum Scheitern verurteilt.
Bei meinem ersten Ausflug in diese für mich so neue Welt mache ich mich auf die Suche nach einem Internetcafé. Früher gab es solche Läden an jeder Ecke. Aber inzwischen sind sie offensichtlich beinahe ausgestorben.
Ohne es zu wollen, entferne ich mich immer weiter von meinem Zuhause, von dem einzigen Ort, an dem ich meinen Platz kenne. Auf dem Teppichboden meines Zimmers, den Blick an die Decke gerichtet.
Ich nähere mich der Innenstadt. Immer mehr Menschen wuseln um mich herum. Es ist laut, es ist grell. Pearley ist in der Stadtmitte bunt und lebendig. Es ist das genaue Gegenteil von mir, der ich innerlich wie gelähmt bin. Besonders wenn die Studenten wie jetzt aus den Sommerferien zurückgekehrt sind, quellen die Restaurants, Cafés und Boutiquen, die die Straßen im Zentrum säumen, beinahe über. Pearley ist überschaubar, wenn die Studenten wegfallen. Aber sobald sie da sind, kommt die Stadt auf bestimmt achtzigtausend Einwohner. Und in diesem Moment habe ich den Eindruck, als wären alle achtzigtausend auf der Straße. Ich bin derjenige, der gegen den Strom unterwegs ist. Ständig muss ich nach links und rechts ausweichen, um niemandem zu nahe zu kommen. Oder damit mir niemand zu nahe kommt. Keiner scheint Notiz von mir zu nehmen, aber dafür bemerke ich jede noch so kleine Bewegung mit einer ungekannten Intensität. Autos fahren an mir vorbei. Jedes Mal zucke ich zusammen. Ich bin diese Art von Stadtlärm nicht mehr gewohnt.
An einer Kreuzung laufe ich an einem kleinen Kino vorbei. Es ist ein weißes Art-déco-Gebäude. Die weißen Anzeigetafeln mit schwarzen Buchstaben kündigen auch heute noch die Filme an. Kurz habe ich das Gefühl, dass die Zeit stehen geblieben ist. Ich erinnere mich, wie ich mich früher hier in Vorstellungen geschlichen habe, da nie genug Geld übrig war, um eine Karte zu kaufen. Aber als ich blinzle, bin ich mir der Tatsache, dass sechs Jahre vergangen sind, seit ich das letzte Mal hier war, nur allzu bewusst. Hinter der Kreuzung beginnt die Fressmeile. Restaurant reiht sich an Restaurant, ein Hotdog-Stand wirbt damit, die besten Hotdogs Kaliforniens zu verkaufen. Obwohl mein Magen knurrt, habe ich keinen Appetit.
Eine Gruppe junger Leute – vermutlich Studenten – kommt mir entgegen. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Es sind zu viele, um ihnen auszuweichen. Sie lachen, klopfen sich auf die Schultern. Es sind drei Kerle und vier Mädchen. Sie kommen immer näher, und ich erstarre. Einer der Typen blickt mich an, weil er einen Bogen um mich laufen muss, und runzelt die Stirn. Als sie an mir vorbeigelaufen sind, bleibe ich noch eine ganze Weile wie versteinert stehen. Ich versuche, regelmäßig zu atmen, um meinen Puls zu beruhigen. Es ist einfach zu viel.
Ich biege in eine der weniger belebten Nebenstraßen ein. Hier findet das Nachtleben statt, aber tagsüber ist es ruhig. Einige der Bars haben zwar schon offen, aber am frühen Nachmittag sind sie noch nicht gut besucht.
Vor einem Eingang, aus dem gedämpfte Musik zu hören ist, steht ein Mann und raucht. Ich gehe auf ihn zu.
»Entschuldigung, hätten Sie vielleicht eine Zigarette für mich?«, frage ich mit zittriger Stimme. Ich räuspere mich.
»Na klar«, sagt der Mann und lächelt. Er hält mir eine Schachtel und sein Feuerzeug hin, und ich bediene mich.
»Vielen Dank.« Ich inhaliere tief und merke sofort, dass ich ruhiger werde. Ich komme mir albern vor. Überfordert von einer Kleinstadt. Wenn ich jetzt zurück Richtung Hauptstraße blicke, wirken die bunt gestrichenen Häuser mit ihren Markisen und Sitzgruppen auf dem Gehweg regelrecht idyllisch. Die bunte Parade wird hier und da von rohem Backstein unterbrochen. Es ist nicht die Stadt, die mich bedroht. Ich bin es, der die Idylle stört.
Ich drehe mich wieder zu dem Mann um, der seine Zigarette in diesem Moment wegschnippt. Ich ergreife meine Chance.
»Wissen Sie zufällig, ob es hier in der Nähe ein Internetcafé gibt?«, frage ich und ziehe noch mal an meiner Zigarette.
»Ein Internetcafé?«, wiederholt er ungläubig, und als ich nicke, sagt er: »Hier an der Hauptstraße können sich solche Läden die Miete nicht mehr leisten. Siehst ja, was hier gefragt ist.« Er deutet auf die Bars und Restaurants. »Aber in dieser Richtung kommt da hinten auf der rechten Seite ein Computerladen, der auch Internet anbietet.«
Ich bedanke mich und er nickt mir zu, als er zurück in die Bar geht.
Der Angestellte der PC World weist mir einen Computer zu und ich mache mich gleich daran, meine im Gefängnis erlernten Internet-Fähigkeiten auszuprobieren. Doch ich stelle schnell fest, dass die Kurse, die uns angeboten wurden, nicht sonderlich nützlich waren. Ich kann immerhin mit Suchmaschinen umgehen und vertiefe mich in Artikel über das Auffinden von Personen. Daraufhin erstelle ich mir erst eine eigene E-Mail-Adresse und im Anschluss Profile in sozialen Netzwerken. Als sie mich damals mitnahmen, hatten wir zu Hause keinen Computer. Deswegen ist es nun das erste Mal, dass ich mich überhaupt mit sozialen Netzwerken befasse. Ich gebe nicht viel über mich preis, habe ja nicht einmal ein Foto von mir. Nacheinander tippe ich die Namen meiner Familie in die verschiedenen Suchmasken. Doch nachdem keiner der Namen einen Treffer erzielt, beschließe ich, dass ich systematischer vorgehen muss. Das Internetcafé kostet zu viel Geld, als dass ich hier meine Zeit verplempern könnte. Ich muss mir eine Liste mit Namen von früher machen. Ich hoffe, mir fallen genug ein. Denn bisher ist mir noch keine bessere Idee gekommen, um herauszufinden, wo er sie hingebracht hat.
Meine ersten Schichten in Mal’s Café sind in Ordnung. Meistens ist Ollie da und übernimmt die Kunden. Ich beobachte, wie sie mit den Gästen redet, ihnen einen schönen Tag wünscht, sie willkommen heißt. Sie redet ansonsten nicht viel, das gefällt mir. Ihr ganzes Gesicht ist gepierct, sie hat schwarze, kurze Haare und trägt einen Undercut. Ihre Jeans sind zerrissen und ihre T-Shirts ausgeblichen. Sie wirkt, als hätte sie schon einiges erlebt, und vermutlich ist sie deswegen nicht gesprächig. Sie fragt mich nichts, ich frage sie nichts. So kann es weitergehen.
Auch Liz ist okay. Alle sind freundlich zu mir, nur ich kann nicht aus meiner verdammten Haut. Meine Haut, die beinahe taub ist. Es gibt Momente, in denen es mir leidtut, dass sich alle Mühe geben und ich nichts erwidern kann. Aber dann merke ich, wie es mir doch egal ist.
Amys Besuche, die in dieser ersten Woche mit einer erstaunlichen Regelmäßigkeit erfolgen, strengen mich an. Sie erwartet von mir, dass ich mit ihr spreche. Sie fragt viel.
»Geht es dir gut, Rhys?«
Achselzucken.
»Hast du dich schon eingelebt?«
Blick auf den Boden.
»Wie ist der Job?«
»Okay.«
»Kommst du mit den anderen klar?«
»Ja.«
»Brauchst du etwas?«
Erneutes Achselzucken. Ich habe kaum Antworten für sie. Woher weiß ich, ob es mir gut geht? Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, sich eingelebt zu haben. Komme ich klar? Ich lebe noch, das sollte als Antwort genügen.
Manchmal bin ich kurz davor, ihr von meinem Plan zu erzählen und sie um Hilfe zu bitten. Aber ich habe Angst, dass sie versucht, ihn mir auszureden, und mich dann noch strenger überwacht. Ich könnte ihre Hilfe gut brauchen, denn die Sorge schnürt mir die Luft ab.
Um wenigstens irgendwas zu sagen, habe ich ihr erzählt, dass ich mir einen Laptop kaufen will, damit ich nicht auf Internetcafés angewiesen bin. Sie war völlig aus dem Häuschen, faselte etwas von Zielen, die gesund seien. Sie bot an, einen Bekannten zu fragen, der gebrauchte Laptops verkauft. Regelmäßig sagt sie, wie froh sie ist, dass ihr Projekt Kapazitäten für mich hatte. Bin ich froh darüber? Vielleicht. Vielleicht ist sie nützlich. Vielleicht ist es gut, jemanden hier draußen zu kennen.
Am Freitagmorgen arbeite ich wieder im Café. Ich bin mit Che alleine. Er erzählt mir von seiner großen Leidenschaft, dem Bierbrauen, und fragt mich, ob ich eins von seinen Stouts probieren will. Ich weiß nicht einmal, was das ist, aber er ist Feuer und Flamme und erklärt mir, dass es sich um eine schwere schwarze Biersorte handelt. Er faselt etwas von Malzgehalt und ich verspreche ihm, sein Bier zu probieren. Vor allem, damit er mich wieder in Ruhe lässt.
Später, kurz vor Feierabend, soll Ollie noch kommen, um die Kasse zu kontrollieren. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich neu bin. Vermutlich ist der Grund eher, dass ich ich bin. Jedenfalls mache ich die Abrechnung nicht.
Es ist nicht viel los. Ein paar Leute kaufen gekühlte Getränke. Für Kaffee ist es wohl einfach zu warm. Aber dann geht die Tür auf und das seltsame Mädchen von vor einigen Tagen steht wieder vor mir. Sie trägt Jeans und eine bunte Bluse mit weiten Ärmeln, und ihre braunen Haare fallen locker über ihre Schultern. Sie wirkt ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Das haben wir wohl gemeinsam – wenn auch auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Es verunsichert mich, dass sie einfach nicht aufhört zu reden und zu strahlen. Ihre übertriebene Positivität gibt mir das Gefühl, menschliche Interaktionen nicht mehr zu beherrschen. Ich kann Armdrücken, ich kann mein Bett in unter einer Minute machen und ich kann mit einem gezielten Schlag eine Nase brechen. Aber all das nützt mir hier draußen wenig.
Als sie mich sieht, gibt sie nur ein einfaches »Oh« von sich. Es klingt enttäuscht oder genervt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie wägt wohl ab, ob sie bleiben soll, entscheidet sich dann aber dafür. Sie legt ihre Umhängetasche und das Buch, das sie in der Hand hält, auf einen Tisch und kommt wieder an den Tresen.