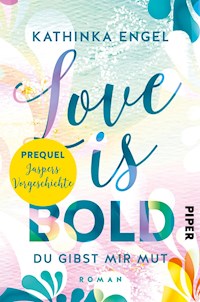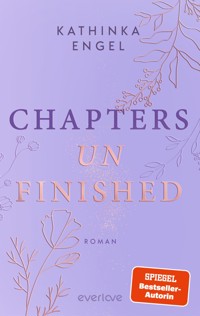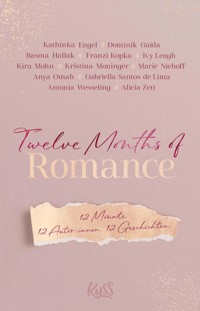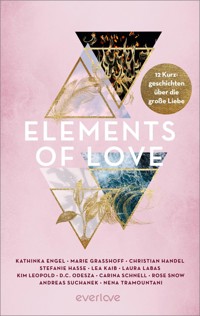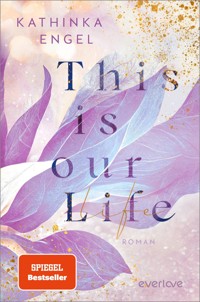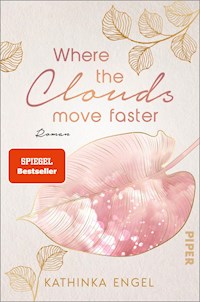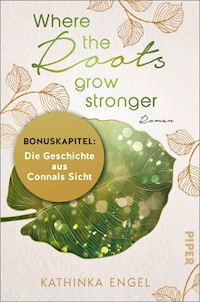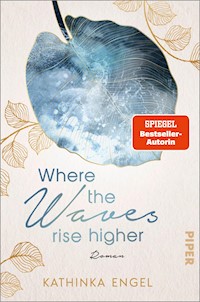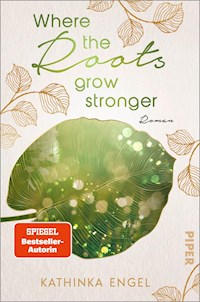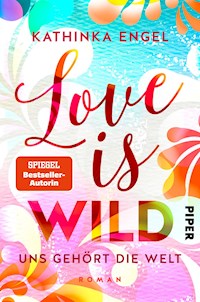9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Anziehung zwischen ihnen ist unverkennbar – doch er ist für sie tabu. Seit Ewigkeiten ist Bonnie in ihren Bandkollegen Jasper verliebt, und auch er fühlt sich zu ihr hingezogen. Doch Bonnie war mit Jaspers verstorbener Frau befreundet. Aus Angst, ihre tote Freundin zu verraten, verpasst Bonnie fast die Chance auf ihre große Liebe. Eine bunte, ungewöhnliche Stadt, eine junge Band und die große Liebe: Der zweite Band der neuen Reihe der Spiegel-Bestsellerautorin Kathinka Engel, in der sie uns ins bunte und lebensfrohe New Orleans entführt – und mitten hinein in das turbulente Leben einer Band. Zwischen berauschenden Auftritten und dem harten Alltag als Berufsmusiker suchen sie alle nach ihrem persönlichen Happy End. Als leidenschaftliche Leserin studierte Kathinka Engel allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft, arbeitete für eine Literaturagentur, ein Magazin sowie als Übersetzerin und Lektorin. Mit ihrem Debüt »Finde mich. Jetzt« schaffte Kathinka Engel es aus dem Stand auf die Bestsellerliste. Wenn sie nicht gerade schreibt oder liest, trifft man sie im Fußballstadion oder als Backpackerin auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Love is Bold – Du gibst mir Mut« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Von Kathinka Engel liegen im Piper Verlag vor:
Finde-mich-Reihe:
Band 1: Finde mich. Jetzt
Band 2: Halte mich. Hier
Band 3: Liebe mich. Für immer
Love-is-Reihe:
Band 1: Love is Loud – Ich höre nur dich
Band 2: Love is Bold – Du gibst mir Mut
Band 3: Love is Wild – Uns gehört die Welt
© Piper Verlag GmbH, München 2020
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Redaktion: Anita Hirtreiter
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Zitat
1 – Bonnie
2 – Jasper
3 – Bonnie
4 – Jasper
5 – Bonnie
6 – Jasper
7 – Bonnie
8 – Jasper
9 – Bonnie
10 – Jasper
11 – Bonnie
12 – Jasper
13 – Bonnie
14 – Jasper
15 – Bonnie
16 – Jasper
17 – Bonnie
18 – Jasper
19 – Bonnie
20 – Jasper
21 – Bonnie
22 – Jasper
23 – Bonnie
24 – Jasper
25 – Bonnie
26 – Jasper
27 – Bonnie
28 – Jasper
29 – Bonnie
30 – Jasper
31 – Bonnie
32 – Jasper
33 – Bonnie
34 – Jasper
35 – Bonnie
36 – Jasper
37 – Bonnie
38 – Jasper
39 – Bonnie
40 – Jasper
41 – Bonnie
42 – Jasper
43 – Bonnie
44 – Jasper
45 – Bonnie
46 – Jasper
47 – Bonnie
48 – Jasper
49 – Bonnie
50 – Jasper
51 – Bonnie
Danksagung
Für all die Mutigen. Für all die Ängstlichen. Und für Sabine.
1 – Bonnie
Vor vier Jahren
Im Fernsehen läuft Millionaire Matchmaker, unsere liebste Trash-TV-Sendung. Patti Stanger, die Moderatorin mit dem längsten Gesicht und den weißesten Zähnen der Welt, hat gerade einen ihrer Millionäre gerügt, er würde die Sache nicht ernst nehmen und wäre gar nicht auf der Suche nach der großen Liebe. Sie ist echt sauer, was nicht allzu oft passiert, und ich denke daran, dass ich Blythe morgen unbedingt von Pattis Ausbruch erzählen muss. Sie ist abends so müde, dass sie nicht einmal mehr fernsehen kann. Um kurz nach sieben wirft sie uns alle aus ihrem Hospizzimmer, damit sie schlafen kann.
Früher war diese Show Blythes und mein guilty pleasure. Ich weiß nicht einmal mehr, warum oder wie es angefangen hat. Als dann Weston auf die Welt kam und sie mit Jasper zusammenzog, wurde er ganz automatisch auch Teil von Millionaire Matchmaker. Weswegen ich, seit Blythe im Hospiz ist, mehrmals die Woche rüberkomme, um mit Jasper zusammen die Show zu sehen. Ein bisschen Normalität auf Blythes und Jaspers Sofa in dieser grauenhaften, unerklärlichen Zeit.
»Denkst du, tief im Innern würde Patti auch gern mal einen ihrer Millionäre daten?«, fragt Jasper.
»Sicher. Sie redet zwar immer von ihrer grandiosen Ehe, aber die Blicke, die sie manchen zuwirft …« Ich lache. Es soll ein unbeschwertes Lachen sein, seit Blythes Diagnose lacht allerdings niemand von uns mehr wirklich unbeschwert. Weston manchmal, doch ich glaube, er versteht einfach nicht, was passiert.
Aus dem Babyfon dringt leises Quäken, und Jasper bedeutet mir, kurz leise zu sein. Aber Maya ist anscheinend nicht wach geworden, denn nun ist sie wieder still. Die Vorstellung, dass sich die kleine Maus mit ihren achtzehn Monaten später einmal kaum an ihre Mom erinnern wird, ist unerträglich. Doch nur einer unter den Tausenden von unerträglichen Gedanken.
»Ich habe Angst«, sagt Jasper auf einmal. Der Fernseher läuft noch, aber wir hören beide nicht mehr hin. Er schluckt.
»Ich weiß.« Ich kann nur flüstern, weil das alles so furchtbar ist. Weil auch ich Angst habe. Angst davor, keine beste Freundin mehr zu haben. Aber verglichen mit Jaspers Angst, ist meine einfach nur albern. Und ich wette, seine ist nichts im Vergleich zu Blythes Angst.
»Ich kann das nicht allein«, sagt er leise und senkt den Blick.
»Du bist nicht allein, Jasper. Das verspreche ich. Wir sind alle für dich da.«
Er schüttelt kaum merklich den Kopf. Seine Schultern hängen herab. Eigentlich sollte ich ihm nicht so nah sein, wie ich es im Moment bin. Selbstschutz und so. Doch sein Kummer ist größer als meine dummen Gefühle.
Ich nehme sein Gesicht in meine Hände. Er hat sich länger nicht rasiert, und seine Bartstoppeln fühlen sich auf eine schöne Art kratzig an auf meinen Handflächen.
»Sieh mich an, Jasper«, sage ich sanft, aber bestimmt. »Sieh mich an.«
Er hebt den Blick, und ich schaue ernst in seine grünbraunen Augen. Ich liebe diese Augen, die seit Wochen dunkel umrandet sind und leicht rötlich gefärbt. Er schläft kaum und weint viel. Ich liebe seine langen Wimpern, die leicht gebogene Nase, seine geschwungenen Lippen. Seit ich ihn das erste Mal gesehen habe, liebe ich alles an ihm. Doch das spielt keine Rolle. Damals nicht und heute schon gar nicht.
»Wir werden das hinkriegen. Wir werden zusammen kaputtgehen, und dann werden wir uns irgendwie wieder zusammenflicken. Und wir werden für Weston und Maya da sein.«
Wieder schluckt er und nickt langsam.
Ich lasse sein Gesicht los und schlinge stattdessen die Arme um seinen Hals. Ich drücke ihn fest an mich und ignoriere das bescheuerte Herzklopfen in meiner Brust. Seine Schultern beben, doch ich halte ihn einfach. Versuche, die Starke zu sein für Jasper, für Blythe, für Weston und Maya. Obwohl ich selbst mit jedem Augenblick mehr in mir zusammenfalle.
Ich spüre seine starken Arme um meine Taille, spüre den Kummer in seinem Körper, so wie er meinen vermutlich ebenfalls fühlt.
»Ich brauche dich«, flüstert er nach einer Weile und löst sich etwas von mir.
Sofort sehnt sich mein Körper nach seiner Wärme, aber mein Körper hat die Klappe zu halten. Er hat keinen Anspruch auf Sehnsucht, kein Recht, etwas zu verlangen.
»Ich bin da«, sage ich leise, und diesmal ist es Jasper, der mein Gesicht in seine Hände nimmt.
»Versprich es«, sagt er, und seine Stimme bricht.
»Ich verspreche es.«
Mir ist beinahe, als näherte sich sein Gesicht dem meinen. Als käme ich ihm entgegen. Aber das kann nicht sein, weil es nicht sein darf. Und doch nehme ich seinen Duft auf einmal intensiver wahr als noch vor ein paar Sekunden. Ich glaube nicht, dass er in den letzten zwei Tagen geduscht hat, und so riecht er nach nichts als ihm selbst. Es ist der himmlischste Geruch, den ich mir vorstellen kann, und für diesen Gedanken schäme ich mich in Grund und Boden.
»Versprich es«, fleht er noch einmal, und unsere Lippen sind sich jetzt so nah, dass ich seinen Atem auf meinem Gesicht spüre.
»Ich … verspreche es«, erwidere ich so leise, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob ich es wirklich gesagt habe.
Jasper lässt seinen Kopf nach vorne sinken, und seine Lippen liegen nun auf meinen. Seine Arme sind wieder um meinen Körper geschlungen, und alles in mir schreit. Dass ich fliehen sollte, dass ich bleiben sollte, dass ich das Falsche tue, dass das hier genau richtig ist, dass wir alles zerstören, dass dies die Erfüllung all meiner Sehnsüchte ist, dass ich eine miese Verräterin bin, dass Jasper der Mann meiner Träume ist. Und dann schweigt meine innere Stimme. Und unsere Lippen sind gespitzt. Seine sind so warm, so weich. So … alles, was ich mir je erträumt habe. Sie verharren auf meinen, und ich schließe die Augen. Kann nicht anders. Platze beinahe innerlich.
Ich weiß nicht, wer zuerst die Lippen öffnet, doch auf einmal ist da mehr. Nicht viel, aber spürbar mehr. Unsere Münder bewegen sich kaum, und trotzdem wollen sie es. Wir sind vorsichtig, sanft, gebrochen. Ich höre mein Ausatmen, Jaspers erstickten Seufzer, der nach nichts anderem als tiefer Verzweiflung klingt. Und obwohl mein verräterisches Herz hasst, was ich tue, weiß ich doch, dass es das einzig Richtige ist.
»Das geht nicht«, sage ich und schiebe mich von ihm weg. Ein letzter Blick, dann krieche ich ans andere Ende des Sofas. »Was machen wir hier? Das dürfen wir nicht.«
»Entschuldige«, sagt Jasper und klingt ganz hohl, heiser. »Bitte verzeih.«
»O Gott«, entfährt es mir. Einerseits, weil ich mich nach ihm verzehre, und andererseits, weil ich der schlimmste Mensch auf dieser Welt sein muss. Ich vergrabe mein Gesicht in den Händen. Meine Haut glüht vor Scham.
»Es ist nichts passiert«, sagt Jasper, doch ich höre die leise Panik in seiner Stimme. »Wir sind beide verwirrt. Wir brauchen Nähe und Trost.«
Er kann nicht wissen, dass ich nun erst so richtig verwirrt bin. Aber natürlich war es das. Nähe und Trost. Doch es ist egal, was wir brauchen. Denn Blythe braucht uns. Blythe braucht ihren Mann, ihre beste Freundin.
»Ich sollte jetzt gehen.« Ich kann kaum sprechen, so sehr stehe ich unter Schock.
»Es ist nichts passiert«, wiederholt Jasper. »Okay? Es ist alles gut. Zwischen uns ist alles gut.«
»Ja«, hauche ich, doch ich weiß, dass nichts gut ist. Blythe stirbt, während wir uns küssen. Hat die Welt schon einmal so etwas Abscheuliches gehört?
Ich nehme noch wahr, wie Jasper etwas von »Extremsituationen« murmelt, dann ziehe ich die Tür hinter mir zu. Es ist eine schwüle Sommernacht, die Grillen zirpen, die Veranden der kleinen kreolischen Cottages werden durch Hängelampen und Lichterketten in ein warmes Licht getaucht. Es ist friedlich hier, beinahe zu friedlich.
Ich springe die Stufen von Jaspers Veranda nach unten. Das Gartentor klemmt, und ich brauche einen Moment, um es zu öffnen. Dass meine Finger zittern und hinter meinen Augen Tränen darauf warten, geweint zu werden, hilft nicht. Schließlich geht es auf, und ich renne. Renne die Straße entlang. Einmal nach rechts, dann nach links. Anschließend noch hundert Meter, und ich bin zu Hause.
Meine Mom sitzt vor dem Fernseher und sagt etwas zu mir, doch ich laufe einfach an ihr vorbei nach oben und in mein Zimmer. Hier, auf einem Regal, stehen zig Einweck- und alte Marmeladengläser. Ich gehe die einzelnen Bretter durch, bis ich ein unetikettiertes Glas gefunden habe. Der Deckel lässt sich leicht abschrauben, und ich sinke auf mein Bett. Ich schließe die Augen und durchlebe den Moment mit Jasper noch einmal in Gedanken. Ich lasse nichts aus. Spüre ihn, spüre den Schmerz. Spüre nichts als Schmerz und das kühle Glas in meinen Händen. Ich konzentriere mich darauf, alles, jedes noch so kleine Detail aus meinem Kopf zu verbannen, und dafür muss ich den Kuss mit Jasper erneut in seiner ganzen Schrecklichkeit und Schönheit durchleben. Dabei stelle ich mir vor, wie die Gedanken sich sammeln und dann als eine große Erinnerung in das Glas sinken.
Als ich mir sicher bin, dass nichts mehr davon übrig ist, schraube ich den Deckel wieder fest auf das Glas und klebe ein Etikett darauf. Unter das heutige Datum schreibe ich in fetten, schwarzen Buchstaben das Wort Verrat. Schließlich stelle ich das Glas aufs oberste Regalbrett. Ganz nach hinten an den Rand. Wo ich es hoffentlich nie wieder sehen muss.
2 – Jasper
Vor vier Jahren
Meine Hände wandern langsam über die kühlen Klaviertasten. Sie spielen wie automatisch eine Melodie. Eine Melodie voller Traurigkeit, Demut. Voll verpasster Momente und ungelebter Liebe. Sie ist weg. Für immer. Meine Frau, Westons und Mayas Mom. Mein Augenstern, meine große Liebe, die Erfüllung all meiner Träume. Wir haben Lebewohl gesagt, und sie ist gegangen. Erst ihr Blick, dann ihr Atem, ihr Herz und schließlich sie.
Der Klang des Klaviers – wie Wellen aus Glasperlen, die kommen und gehen – vermischt sich mit schauerlichen Lauten, die tief aus meiner Kehle, aus meiner Seele zu stammen scheinen. Stöhnendes Schluchzen, ein Keuchen, das einem verzweifelten Schrei ähnelt. Tränen kullern meine Wangen herab und tropfen eine nach der anderen auf die Tasten, wo meine Finger sie verwischen.
Nichts ist wichtig in diesem Moment. Nichts spielt eine Rolle. Ich sehe ihr Gesicht vor mir. Blythes schönes Gesicht. Ihr müdes Lächeln, ihre matte Hand, die in meiner lag. Einfach nur lag. Weil sie den Druck nicht mehr erwidern konnte. Ich spüre die Liebe, die grenzenlose Liebe, die nie vergehen darf.
Mir fehlt die Kraft. Die Kraft, diese Leere durchzustehen. Und doch muss ich es. Für Weston und Maya, die noch nicht einmal wissen, dass ihre Mutter nicht mehr da ist. Maya ist ohnehin zu klein, um sich noch an die Frau zu erinnern, die ihr das Leben geschenkt hat. Heute Nacht bleiben die Kinder bei Phoenix, der Tagesmutter. Zuerst dachte ich, ich könnte die Einsamkeit nicht ertragen. Ich spielte mit dem Gedanken, sie abzuholen. Aber nun, da ich nicht einmal die Energie habe, meinen eigenen Kopf zu stützen, weiß ich, dass es die richtige Entscheidung war. Ich brauche diesen Moment für mich. Diesen Augenblick der tiefsten Trauer, damit ich morgen für sie da sein kann. Milchpulver auflösen, Brei kochen, Windeln wechseln. Weston halten und halten und halten.
Blythes Bruder Link hat angeboten, mir unter die Arme zu greifen, da zu sein. Jeden Tag. Und ich weiß, er wird kommen, egal, ob ich ihn darum bitte oder nicht. Alle versprechen, dass ich nicht allein sein werde. Und doch ist es genau das, was ich will. Allein sein. Wenn ich nicht mit ihr zusammen sein darf, kann ich es mit niemandem sein.
Flashbacks der letzten Tage durchzucken meine Gedanken. Gedämpfte Gespräche im Hospiz, rot geweinte Augen, hoffnungsloses Kopfschütteln. Bonnies Gesichtsausdruck, als sie sich heute Vormittag verabschiedete. Sie wich meinem Blick aus, verschwand in den Weiten dieses seltsam friedlichen Ortes. Ich konnte sie nicht aufhalten. Konnte nicht von ihr verlangen, dazubleiben. Alles, was an diesem und an den Tagen zuvor von uns verlangt wurde, war zu viel.
Meine Hände zittern, und ich unterbreche die sanfte Melodie für einen Moment. Doch die Stille, die durchs Haus dröhnt wie der ultimative Beweis für das Ende, erschüttert mich. Sie geht durch Mark und Bein, durch Kopf und Herz. Und ich zwinge mich zu atmen. Befehle meinen Fingern, weiterzumachen, so, wie ich weitermachen werde. Gebrochen, ein Schatten meiner selbst. Das Leben ist ein Schatten seiner selbst. Es ist ein böser Hohn, dass es voranschreitet. Für manche. Für mich.
Maya weint seit Stunden auf meinem Arm, doch ich nehme ihre Laute kaum wahr. Ich gehe auf und ab. Auf und ab. Auf und ab. Weston ist eingeschlafen. Wir haben gemeinsam so lange geweint, bis er zu erschöpft war. Das war der Moment, in dem Maya aufgewacht ist. Sie will nichts essen, will nicht schlafen. Sie will weinen – und wer kann es ihr verübeln? All meine Versuche, sie zu beruhigen, schlugen fehl. Mein ersticktes Summen, das vorsichtige Wippen ihres kleinen Körpers in meinen Armen. Sie ist wütend auf die Welt, und ich bin es mit ihr.
Irgendwann setze ich mich zurück ans Klavier, meine letzte Zufluchtsstätte. Ich setze Maya auf meine Beine und beginne Melodien zu spielen, die Blythe liebte. Tatsächlich scheint es zu wirken. Maya beruhigt sich für einen Augenblick, und es gelingt mir sogar, ihr ein bisschen Milch einzuflößen. Ich gestatte mir einen Moment der Erleichterung, denn ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis ein so kleines Kind dehydriert ist. Ich würde Charlie, Blythes Mom, fragen, aber ich bringe es nicht über mich, ihre Nummer zu wählen.
Ich lehne meinen Kopf gegen das dunkle Holz des Klaviers, spiele mit der rechten Hand eine langsame Melodie und halte mit der linken die Flasche in Position.
»Siehst du«, sage ich leise, »du hattest einfach Hunger.« Beim letzten Wort ist meine Stimme ganz dünn und zu einem hohen Schluchzen geworden.
So findet Link uns, als er wenig später kommt. Er sieht fertig aus. Blass. Seine Augen sind dunkel umrandet. Er nimmt mir Maya ab, schickt mich ins Bett. Er hat Schlaftabletten dabei.
»Ich bleibe, bis du wieder wach bist«, verspricht er. »Kann ohnehin nicht schlafen.«
»Dafür sind die Dinger«, sage ich und deute auf das orangefarbene Plastikdöschen, das zwischen uns auf dem Tisch steht.
Er lächelt müde. »Erst du.«
Ich nicke erschöpft. Dankbar. »Wenn Weston aufwacht …«
»Ich bin da.«
Wir stehen alle gemeinsam am Ufer des Mississippi. Die Asche wurde in den Wind gestreut, und Sal spielt auf seiner Trompete einen langsamen Trauermarsch. Die klaren Töne durchschneiden die warme, feuchte Luft. In meinem linken Arm trage ich Maya, in meinem rechten Weston. Wir sind das, was von unserer Familie übrig ist, und wir müssen zusammenhalten. So eng zusammen, wie nur irgend möglich. Deswegen drücke ich meine beiden Kinder fest an mich, obwohl meine Arme sich anfühlen, als würden sie bald abfallen.
Auf dem Weg zurück zu den Autos lasse ich meinen Blick über all die Menschen schweifen, die gekommen sind, um Blythe Lebewohl zu sagen. Es ist unglaublich, wie viele Leben sie berührt hat. Wie dankbar man sein muss, Teil ihrer Geschichte gewesen zu sein – auch wenn ihre Geschichte viel zu kurz war.
Ich bleibe an meinen Bandkollegen hängen. Link, Curtis und Sal. Bonnie steht etwas abseits, den Kopf gesenkt. Ihr Herz ist ebenso gebrochen wie meines. Wie unser aller Herzen. Fast will ich zu ihr gehen, doch dann legt Con, Blythes Vater, seinen Arm um mich.
»Na komm, mein Sohn«, sagt er, so wie er es immer tut, obwohl ich nur sein Schwiegersohn bin, und schiebt mich sanft in Richtung Straße zurück. »Noch ein paar Stunden, dann hast du es hinter dir.«
Hinter mir. Das klingt schön. Aber es stimmt nicht. Denn der tägliche Kampf wird andauern. Wird vielleicht noch härter, jetzt, da wir vermeintlich Abschied genommen haben. Jetzt, da für viele andere wieder Normalität einkehrt.
»Willst du auf meinen Arm, Weston?«, fragt Con, doch Weston schüttelt an meiner Halsbeuge den Kopf. »Ist er dir nicht zu schwer?«
»Nein«, sage ich mit mehr Vehemenz als beabsichtigt.
Ich bin tatsächlich erleichtert, als ich die letzten Gäste verabschiede. Es fühlt sich an wie ein hinter mir, obwohl es nur eine kleine Etappe ist.
Link und Curtis sind noch da und helfen mir beim Aufräumen. Aber schnell merke ich, dass auch das zu viel ist.
»Stellt die Sachen einfach in die Küche, ich kümmere mich morgen darum«, sage ich.
»Bist du sicher, Alter?«, fragt Curtis. »Ist kein Problem, noch zu bleiben.« Er klopft mir auf die Schulter. Curtis ist der Einzige, der vollkommen normal mit mir umgeht. Vermutlich liegt es daran, dass er Verlust kennt. Dass er die Ohnmacht erlebt hat, als er seine Eltern durch Hurrikan Katrina verlor.
»Danke, aber ich wäre am liebsten allein.«
Charlie und Con haben die Kinder ins Bett gebracht, und ich sehne mich nach Ruhe. Nach Ruhe und Melodie. Nach Melodie und Erinnerung. Nach Erinnerung und Schmerz. Nach Schmerz und Dunkelheit.
Wenig später gehe ich noch einmal durch das leere Haus, in dem wir bis vor Kurzem noch zu viert wohnten. Ich sehe Blythe vor mir. Ihr Strahlen, ihre wachen Augen. Immer öfter gelingt es mir, die müde, die kranke Blythe durch die wirkliche zu ersetzen. So, wie sie es sich gewünscht hat.
Aber ich sehe auch alle anderen, die diesen Weg mit mir – mit uns – gegangen sind. All die bunten, wunderbaren Menschen aus Tremé, die heute hier waren. Ihre Eltern, unsere Freunde. Link, Curtis und Sal. Und Bonnie.
3 – Bonnie
Heute
»All my life I wanted nothing more than just to be … me and you«, singt Link mit heiserer, intensiver Stimme ins Mikrofon.
Ich sehe ihn lediglich von hinten, kann sein Mienenspiel nicht mitverfolgen, aber ich weiß ganz genau, dass er, während er einzig für seine Freundin Franzi singt, für jede Frau in unserem imaginierten Publikum die personifizierte Verheißung darstellt. Wäre das heute nicht einfach nur eine Bandprobe in der Tremé-Musikschule.
Hier jammen wir, sooft wir können. Hier sind wir eine Einheit aus Sound, Freundschaft, gemeinsamer Geschichte.
Meine Bass-Line ist anspruchsvoll, aber ich beherrsche sie im Schlaf. Meine Finger sind schnell, der Druck am Griffbrett kräftig. Das schnarrende Zupfen der Saiten, die Vibration des Instruments verleihen der Musik mehr Tiefe, Breite. Die Anwesenheit meines Klangs fällt den meisten unserer Zuhörer nicht auf. Erst durch seine Abwesenheit gewinnt der Kontrabass an Bedeutung. Das ist eine Facette meines Instruments, die ich bewundere. Die Bescheidenheit in Kombination mit Gewicht.
Schräg hinter mir kreist Curtis’ Besen über sein Becken und seine Drums. Er ist der König des Minimalismus, wenn es darauf ankommt. Er weiß in jedem Moment genau, welche Art von rhythmischer Intensität ein Song braucht. Und dieser, der ironischerweise von einer Liebe handelt, die schon immer war, braucht Sanftheit und Vorsicht.
Während meine Finger über die Saiten meines Instruments klettern, schweifen meine Gedanken ab. Hinter Link an der Wand steht das Klavier, an dem Jasper sitzt. Und mein Blick fällt wie automatisch auf seinen Hinterkopf. Der definierte Haaransatz an seinem Nacken. Die dunklen kurzen Haare, die sich locken würden, wären sie nur ein paar Millimeter länger. Seine eleganten Ohren, die sich beinahe perfekt an die Seite seines Kopfs schmiegen. Sie sehen so weich aus, und ich stelle mir vor, wie es sich anfühlen würde, mit dem Finger ganz leicht über ihre Rundung zu fahren bis zum Ohrläppchen hinunter – und dann weiter, die Halsbeuge hinab.
»Leute, das war großartig«, sagt Link, als der Song verklungen ist, und reißt mich damit aus meinen Gedanken. Aus meinen verbotenen Gedanken.
Er dreht sich zu uns um, fordert Curtis auf, den nächsten Song einzuzählen.
»NOLA my love?«, fragt er, und Curtis nickt.
Kurz treffen sich unsere Blicke, und ich fühle mich seltsam ertappt. Meine Wangen werden heiß, obwohl Link natürlich nicht wissen kann, womit mein bescheuertes Gehirn beschäftigt war. Doch er ist der Einzige, der von meinem Problem weiß. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich in ihm einen moralischen Kompass vermute – selbst wenn das paranoid ist. Link würde mich nie verurteilen. Nicht für meine Gefühle und auch sonst für nichts. Im Gegenteil: Er ist für mich da, wenn ich mal wieder nicht weiß, wohin mit all dem nervtötenden Kummer. Meistens habe ich ihn im Griff, aber es gibt Momente, da bahnt er sich einen Weg an die Oberfläche und überlagert alles. Die guten Vorsätze, die Standhaftigkeit, die Akzeptanz meiner Situation. Da möchte ich mich einfach zusammenrollen und zerfließen vor Gefühl und Hoffnungslosigkeit. Denn es gibt nichts, was ich gegen mein Problem tun könnte. Es ist nicht so, als hätte ich es nicht versucht. Doch mein Gehirn schüttet weiter Hormone aus, die dazu führen, dass ich verliebt bin. Unsterblich verliebt. Schon immer. Ich habe es gegoogelt. Es ist nichts anderes als eine Ausschüttung von Botenstoffen. Das sage ich mir wieder und wieder.
Auch in diesem Augenblick, als ich mit einer schnellen Melodie in unseren nächsten Song einsetze und die mächtige Vibration des Kontrabasses an meinem Körper spüre, zähle ich die kleinen Teufel in meinem Kopf auf: Dopamin, Oxytocin, Adrenalin. Nichts weiter. Doch wenn es nichts weiter ist, warum ist dann diese schmerzende Sehnsucht, die sich in mir eingenistet hat, so real? Warum fühlt es sich an, als zerrte man an meiner Seele?
Mein Herzschlag beschleunigt sich parallel zum Rhythmus, den Curtis vorgibt. Ich könnte es auf den Song schieben, aber ich weiß, dass Jaspers Rücken der wahre Grund ist. Seine fließenden Bewegungen. Das sanfte Hin-und-her-Wiegen, während seine Finger über die Tasten tanzen. Manchmal hüpfen seine Schultern regelrecht, und mein Herz mit ihnen. Ich schmachte, und ich hasse mich dafür. Vermutlich ebenso sehr, wie ich Jasper liebe.
»Ich würde euch gern noch eine neue Idee von mir zeigen«, sagt Link. »Wenn ihr noch Zeit habt?«
»Du sprühst ja geradezu vor Eingebungen in letzter Zeit«, sage ich. Und es stimmt. Seitdem Link verliebt ist – so richtig verliebt –, produziert er neue Songs wie am Fließband. Sie sind alle ein bisschen ruhiger, gefühlvoller, aber gleichermaßen schön. Und wir sind immer offen, Neues auszuprobieren.
Er spielt eine Melodie und singt dazu.
»This is where the magic begins. This is the sparkle, the glisten, the glint.«
»Where it begins?«, fragt Curtis. »Nicht vielleicht where it happens?« Er wackelt anzüglich mit den Augenbrauen.
»Curtis«, ermahnt Sal ihn, doch wir anderen grinsen. So ist er eben.
»Klingt cool«, sagt Jasper, und ich nicke begeistert.
»Wirklich gut.«
»Bleib dran, Mann. Das kann echt was werden.« Curtis ist jetzt ganz ernst.
»Das tue ich«, verspricht Link. »Jasper, hast du Lust, mit mir daran zu arbeiten?«
»Es wäre mir eine Ehre, Hughes. Ich habe die ganze Nacht Zeit.«
»O Mann, Jasper, ich sag dir, hätte ich an deiner Stelle einmal im Leben die Kinder aus dem Haus, ich wüsste schon, was ich mit meinem freien Abend anstellen würde«, sagt Curtis grinsend. »Da würde überall Magic passieren. Im Bett, auf dem Sofa, auf dem Essti-«
»Danke, Curtis, aber ich glaube, wir wissen alle, was du anstellen würdest.« Jasper lacht.
»Selbst, wenn du die Kinder nicht los wärst«, biete ich an, und Curtis nickt.
»Sehr richtig«, sagt er. »Apropos, ich habe gehört, dass es bei mir heute keine Magic gibt, weil Amory mit dir verabredet ist.«
»Schuldig im Sinne der Anklage«, erwidere ich, denn Amory ist nicht nur Curtis’ Mitbewohnerin with benefits, sondern auch die Person, die einer besten Freundin in meinem Leben am nächsten kommt.
»Langweilig«, sagt Curtis und zeigt auf mich. »Und langweilig.« Sein Finger wandert zu Jasper.
»Ja, nun, ich schreibe vielleicht gern einen Song mit meinem Lieblingsschwager«, sagt Jasper und spielt ein paar Akkorde, die klingen wie die in Musik gegossene Antiklimax.
»Eines Tages, Jasper, wirst du alt sein, und dann bereust du es vielleicht.« Curtis lässt nicht locker, und langsam ist es mir unangenehm, zuzuhören.
»Eines Tages, Curtis, wirst auch du alt sein. Und dann können wir uns ja noch einmal darüber unterhalten, ob ich mehr Sex hätte haben sollen«, sagt Jasper selbstbewusst. Das Wort »Sex« aus seinem Mund jagt mir einen Schauder über den Rücken, und ich ermahne mich, tief durchzuatmen. Denke an ein kühles Bier mit Amory im French Quarter. An Ablenkung und Spaß.
Als ich merke, dass Link mir erneut einen Blick zuwirft – ziemlich beabsichtigt diesmal –, bin ich auf einmal sehr beschäftigt damit, in meinen Noten zu blättern. Er ahnt, dass die Richtung, in die dieses Gespräch sich wendet, für mich schwer erträglich ist.
»Bonnie, hilf mir mal«, sagt Curtis. »Link?«
»Ich mische mich da nicht ein«, entgegnet Link, den Blick immer noch auf mich gerichtet.
»Sieht denn niemand, dass es für Jasper langsam an der Zeit ist, mal wieder unter Leute zu kommen?« Curtis ringt die Hände.
»Vielleicht hat Curtis tatsächlich recht«, murmle ich kaum hörbar. Ich versuche, cool zu sein. Link zu zeigen, dass ich darüberstehe. Auch wenn ich es ganz offensichtlich nicht tue, so wie mein beklopptes Herz gerade rast.
»Ha!« Seinen Triumph unterstreicht Curtis mit einem Trommelwirbel.
»Ihr könnt sagen, was ihr wollt«, erwidert Jasper. »Es ist Gott sei Dank meine eigene Angelegenheit.«
Ich treffe Amory in einer etwas versteckten Bar am Rand des French Quarter. Die Touristen bleiben meist auf den ausgetretenen Pfaden um den Jackson Square, die Bourbon Street und die Frenchmen Street herum. Das Barrel ist eingerichtet wie ein Wohnzimmer. Plüschsofas und geblümte Lampenschirme, dazu Südstaatenblues aus alten Boxen.
Amory sitzt am Tresen und unterhält sich mit dem Barkeeper. Sie trägt ein bodenlanges Kleid mit Ethno-Muster, an ihrem Handgelenk klimpern goldene Armreifen. Kurz blicke ich an mir selbst hinab. Weites Bandshirt, Boyfriendjeans. Manchmal beneide ich Amory um den selbstbewussten Umgang mit ihrem Körper. Ich bewundere, wie sie ihre Weiblichkeit in Szene setzt. Ab und zu habe ich mich sogar dabei ertappt, wie ich mich gefragt habe, ob mir so etwas auch stehen würde. Aber dann verwerfe ich jedes Mal den Gedanken und rufe mir in Erinnerung, was passieren kann, wenn man sich zur Schau stellt.
»Aus Mississippi«, höre ich sie gerade sagen, als ich auf den Hocker neben ihr klettere.
»Und was machst du in New Orleans?«, fragt der Barmann.
»Keine Farmerin werden«, erwidert sie und lacht. Dann wendet sie sich mir zu. »Eric hier macht die besten Drinks. Das hier ist ein … wie heißt er noch mal?«
»Aviation«, sagt Eric.
»Probier mal.« Sie hält mir ihr Martiniglas mit einer blassrosa Flüssigkeit hin.
»O ja, sehr gut. Aber ich nehme trotzdem lieber ein Bier«, sage ich zu Eric.
»Können wir kurz über Curtis reden?«, fragt Amory. »Ich muss das einfach loswerden. Dann ist es genug mit Männern, versprochen.«
»Gemeinheit«, sagt Eric und stellt mir ein Bier hin.
»Ich meinte natürlich, dann reden wir nur noch über Eric.« Amory grinst ihn frech an.
»Du kannst so viel über Curtis reden, wie du willst, Am«, sage ich. Denn dafür hat man schließlich Freundinnen.
»Ja, aber ich weiß, wie blöd es für dich ist, weil du zwischen den Stühlen sitzt und so. Mit Curtis in deiner Band und mir in deinem Herzen …«
Ich lache. »Ach was, das macht mir nichts aus.«
»Siehst du, das ist dein Problem«, sagt Amory. »Du bist ein zu guter Mensch. Immer denkst du nur an die anderen.«
»Ich dachte, du wolltest mir etwas über Curtis erzählen. Wäre es da nicht besser, mein Angebot anzunehmen?«, frage ich lachend.
»Okay, Punkt für dich.« Sie nimmt einen Schluck von ihrem Drink. »Also, ich weiß, dass das mit Curtis und mir einfach eine lockere Affäre ist. Spaß und sonst nichts. Ich meine, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft er betont hat, dass das zwischen uns ›nur Sex‹ ist. Dass ›keine Gefühle im Spiel‹ sind. Dass er ›keinen Bock auf den Stress‹ hat.« Sie malt begleitende Anführungszeichen in die Luft.
»Ich kann es mir, ehrlich gesagt, ganz gut vorstellen«, sage ich und denke an das Ende der Bandprobe. »Also, was ist das Problem?«
»Ich glaube, ich würde mich gern mit jemandem verabreden.«
»Oh«, sage ich.
»Ja, genau. Oh.«
Sofort habe ich eine Ahnung, was das Problem ist. Auch wenn Curtis nach außen den harten Kerl mimt, so tut, als könne ihm nichts etwas anhaben, wissen wir beide, dass er in Amorys Nähe zur Ruhe kommt.
»Aber ihm muss doch klar sein, dass diese lockere Sache mit euch beiden nicht für die Ewigkeit ist …«, sage ich vorsichtig.
»Was ihm klar ist und was er draus macht, sind zwei völlig verschiedene Dinge.« Und damit hat Amory absolut recht.
Curtis ist wirklich nicht leicht zu handhaben. Er ist emotional ein absolutes Wrack, seit er mit zehn Jahren seine Eltern durch Hurrikan Katrina verloren hat.
»Aber du kannst doch nicht aus Rücksichtnahme auf jemanden, der nie in der Lage sein wird, dir das zu geben, was du dir vielleicht wünschst …«
»Nein, das kann ich nicht. Da hast du recht«, sagt Amory. »Ich bin nicht naiv, weißt du, mir ist klar, dass Curtis eine verlorene Seele ist und dass ich schauen muss, wo ich selbst bleibe. Aber es bricht mir trotzdem das Herz, dass ich ihm nicht helfen kann. Dass Liebe nicht reicht, ihn zu heilen.«
Ich bewundere Amory für ihre Abgeklärtheit. Dafür, dass sie sich in Momenten, in denen es drauf ankommt, selbst schützt. Curtis ist tief in seinem Innern so angeknackst, dass er Hilfe braucht, die weit über das hinausgeht, was wir zu geben imstande sind.
»Es hilft ja nichts«, sagt Amory seufzend. »Er wird sich benehmen müssen. Anders geht es nicht.« Sie nimmt noch einen Schluck von ihrem Drink, und ich tue es ihr nach, nippe an meinem Bier.
Man muss schauen, wo man selbst bleibt, da hat sie schon recht. In ihrem Fall bedeutet es, dass sie einem Freund das Herz bricht. In meinem … Ich wage kaum, es zu denken.
4 – Jasper
Heute
Jemand zupft an meiner Hose.
Ich blicke von meinem zerfledderten Krimi auf. Maya, meine inzwischen fünfjährige Tochter, hält mir eine gekeimte Blumenzwiebel hin. Ihre Hände sind von der Erde ganz braun.
»Ui, pflanzt ihr die jetzt ein?«, frage ich.
Maya nickt. Eigentlich versuche ich, weniger Ja-Nein-Fragen zu stellen, um sie zum Reden zu bringen, so, wie es Jacob, Phoenix’ Lebenspartner, empfohlen hat. Er ist Psychotherapeut und mein erster Ansprechpartner in allen Fragen, die mit Mayas Verweigerung zu sprechen zu tun haben. Aber oft habe ich keine Lust, darüber nachzudenken. Und auch Jacob sagt, dass es für Maya das Beste ist, wenn wir ungezwungen miteinander umgehen. Denn sie kann reden. Sie hat nur keine Lust darauf. Irgendetwas hemmt sie.
Sie läuft zurück zum Blumenbeet. Hugo, ihr Urgroßvater, der mindestens zwei grüne Daumen hat, reicht ihr die kleine Schaufel.
»Die Löcher graben sich nicht von allein, junge Dame«, sagt er, und Weston lacht.
Statt mein Buch wieder aufzunehmen, beobachte ich für einen Moment diese häusliche Harmonie, die sich in meinem Garten abspielt. Es ist ein Bild für die Götter: Maya in ihrem ehemals gelben Kleid, das ihre Großmutter ihr gestrickt hat, Weston, der konzentriert Samen aussät, Hugo in seinem fleckigen Unterhemd mit Strohhut auf dem Kopf. Er hat auf alles ein Auge. Gibt Tipps, Anweisungen. Manchmal ist er für Maya zu ironisch, dann muss Weston übersetzen. Aber die beiden finden es ungeheuer spannend, seit Neuestem einen Urgroßvater zu haben.
Hugo ist vor ungefähr drei Monaten in unser Leben geplatzt. Erst hatte ich Angst, durch seine Gegenwart würden Dinge wieder an die Oberfläche gezerrt, mit denen ich längst abgeschlossen hatte. Ich wollte nicht, dass meine Kinder in ein neues Familiendrama hineingezogen werden, während sie noch mit ihrem eigenen zu kämpfen haben. Aber der kurze Abriss, den Hugo mir über sein Verhältnis zu meinem Vater gab, zeigte mir, dass ich nichts zu befürchten habe. Und solange ich nicht möchte, sprechen wir das Thema nicht an.
Themen, die wir allerdings ansprechen, sind: Mein Leben. Meine Musik. Meine Familie. Meine Träume. Er möchte alles über mich wissen, als würde er versuchen, die Zeit nachzuholen, die uns genommen wurde.
Maya winkt und zeigt auf die Blumenzwiebel.
»Ich schau dir zu, Süße«, rufe ich.
Zufrieden setzt sie die Blumenzwiebel in das Loch, das sie gebuddelt hat, und schaufelt mit den Händen Erde darauf.
»In ein paar Wochen blühen die schon«, sagt Hugo, und Maya sieht ihn mit großen Augen an.
Der Garten ist ein ganz schönes Chaos. Bevor Hugo angefangen hat, mit den Kindern zu gärtnern, war es einfach eine Brache. Alles, was wuchs, war hartnäckiges Unkraut. Als Blythe noch lebte, war dieser Ort eine Oase. Sie hatte ein Händchen für Pflanzen. Hatte Lust, Schönheit zu erschaffen. Aber im ersten Jahr nach ihrem Tod hatte ich keine Kraft, mich darum zu kümmern. Ich nahm nicht einmal wahr, dass der Garten vor sich hin dörrte. Und dann war es irgendwie zu spät, etwas zu verändern. Wir gewöhnten uns an den Anblick. Blythe. Ihr würde gefallen, dass unsere Kinder die Sache nun in die Hand nehmen. Und ich bin Hugo dankbar, dass er die beiden anweist. Er hat zwei Beete angelegt. Ein Blumenbeet und eines für Kräuter und Gemüse. Er hat das, was früher fleckiges Grün war, umgegraben und neuen Rasen gesät. An der ein oder anderen Stelle keimt er schon. Es wird noch einige Monate dauern, bis das Gras so belastbar ist, dass man es betreten darf. Von Links Wohnwagen, der in der hinteren Ecke des Gartens steht, führt ein Pfad aus Steinen zum Haus. Hugo hatte früher eine Baufirma. Er kennt sich aus und hat einfach an alles gedacht.
»Sollen wir uns mal an die Büsche machen?«, fragt Hugo an Weston gewandt.
In Plastikeimern warten mehrere größere Pflanzen darauf, in ihr neues Beet gepflanzt zu werden.
»Weiß nicht, ob ich stark genug bin«, sagt Weston. »Vielleicht sollte Dad dir helfen?«
»Papperlapapp«, erwidert Hugo. »Deinen Dad lassen wir in Ruhe lesen.«
»Was höre ich da von wegen ›nicht stark genug‹?« Link hat im Haus geduscht und tritt in diesem Moment nach draußen.
»Kannst du uns helfen?«, fragt Weston.
»Nicht, dass du meine Hilfe nötig hättest, aber klar. Ich will auch mitmachen.«
Maya streckt ihre Hand nach ihm aus. »Du bist auch stark genug, hab ich recht?«
Sie nickt.
»Dann wollen wir mal«, sagt Hugo. Er hat bereits das erste Loch gegraben und weist Weston und Link an, den ersten Busch aus dem Eimer zu ziehen. Maya hält einen der äußeren dünnen Äste.
Mit vereinten Kräften tragen sie ihn zu der Stelle, die Hugo vorgesehen hat, und lassen ihn vorsichtig in das Loch sinken.
»Maya, kannst du das Loch zuschaufeln?«, fragt Hugo, und sie macht sich sofort begeistert daran.
Es ist schön zu sehen, wie gut es den beiden geht. Dass es auch mir selbst gut geht. Dass sich der Kampf, den wir viel zu lange täglich kämpfen mussten, auszahlt. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Und so wenig ich daran glaubte, so offensichtlich ist es jetzt. Nicht, dass unsere Wunden alle geheilt wären. Aber sie werden überlagert von metaphorischen Verbänden und Pflastern. Von neuen Erfahrungen, schönen Tagen, die zu Erinnerungen werden. Von Freunden und Familie – auch wenn es keine normale Familie ist. Jeder von uns trägt täglich dazu bei, dass es besser wird. Vollständiger. Weniger leise und weniger traurig. Und tatsächlich ist inzwischen die Traurigkeit selbst so leise, dass ich sie oft gar nicht mehr wahrnehme. Was bleibt, ist das Schöne, das Wertvolle, das ich in meinem Kopf abgespeichert habe. Dankbarkeit für alles, was wir hatten. Für das, was ich danach mit viel Hilfe daraus gemacht habe. Und für die Hilfe selbst natürlich.
Hugo lässt den Stamm los, und alle klatschen. Der Busch hat ein neues Zuhause gefunden und steht in meiner Vorstellung für so viel mehr. Es fühlt sich an wie der Beginn von etwas Großem. Ein Neuanfang für den Garten und ein Neuanfang für uns. Wir machen keinen Cut, wir sprechen es nicht einmal aus. Aber die Tatsache, dass Hugo nun in unserem Leben ist, dass unser Garten wieder zu einem Ort wird, an dem man sich gerne aufhält, dass mein bester Freund und Schwager jetzt bei uns wohnt, all das gibt mir das Gefühl von einem frischen Wind, der hier weht.
Die letzten Jahre waren hart. So hart, dass ich an manchen Morgen nicht wusste, wie ich es schaffen sollte, aufzustehen. Ich funktionierte für die Kinder, doch für mich selbst funktionierte nichts. Ganz, ganz langsam gelang es mir, nicht mehr nur zu funktionieren, sondern auch wieder vorsichtig zu leben. Musik zu machen. Musik zu schreiben. Ein Ventil zu finden für meine Traurigkeit. Und mit jedem Song, mit jedem Gig, mit jeder Tonfolge, die meine Finger spielten, wurde es ein bisschen besser. Mit jedem Wort, das Maya zu mir sagt, mit jedem Lächeln, das Weston mir schenkt. Mit jedem Tag, der vergeht.
Während meiner Grübeleien haben Link und Weston mit Mayas tatkräftiger Unterstützung auch den zweiten Busch eingepflanzt. Man erkennt den Garten jetzt schon kaum wieder, obwohl noch nichts blüht. Allein die Tatsache, dass die Mühe sichtbar ist, macht bereits einen enormen Unterschied.
»Wie sieht die nächste Woche aus?«, fragt Link und lässt sich auf einen der Plastikstühle neben mich fallen. »Kann ich dir unter die Arme greifen?«
Manchmal denke ich, Link glaubt, er hätte etwas wiedergutzumachen. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir einen ziemlich üblen Streit. Er hatte mich seit Blythes Tod hintergangen, lebte illegal in leer stehenden Warehouses, um mir heimlich seinen Anteil unserer Gage unterzujubeln. Doch wir versöhnten uns und haben nun ein Arrangement: Er wohnt in dem alten Wohnwagen in unserem Garten und darf drinnen im Haus Küche und Bad benutzen, und dafür zahlt er Miete. Erst wollte ich nicht einmal das annehmen. Schließlich hatte er in den letzten Jahren genug für mich und die Kinder getan. Aber er rechnete mir in aller Ruhe vor, dass ich es mir nicht leisten konnte, auf die zusätzlichen Einnahmen zu verzichten. Mit dem Klavierunterricht unter der Woche und den Gigs am Abend kommen wir zwar gerade so über die Runden, allerdings habe ich seit Blythes Tod einen Schuldenberg abzustottern, der größer ist als alles, was ich mir bis dahin vorstellen konnte. Nicht einmal das Sterben ist in diesem Land umsonst.
»Es steht nichts Besonderes an«, sage ich.
»Kommen die beiden mit zum Gig?«, fragt Link.
»Ich hoffe, sie können bei Phoenix schlafen«, sage ich. »Wenn nicht, muss ich sie mitnehmen.« Das ist ein Punkt, an dem ich bald etwas ändern möchte. Wenn ich keinen Babysitter finde und die Zeit nicht reicht, um Weston und Maya zu ihren Großeltern zu bringen, schlafen die beiden im Lager vom Cat’s Cradle, während wir spielen. Sie dann aufzuwecken und in ein Taxi zu verfrachten, bricht mir jedes Mal das Herz. Es ist kein Zustand für Kinder, in Hinterräumen von Kneipen zu schlafen, während ihr Vater Musik macht. Aber manchmal gibt es keine andere Lösung.
»Jasper, hör auf, dir deswegen Sorgen zu machen. Den beiden geht’s gut.« Er nickt in Richtung meiner Kinder, die gerade ihren Urgroßvater mit Erde bewerfen und lachen.
Ich schlucke. »Ja, oder?«
»Das Leben ist kein Bilderbuch, es ist ein Abenteuer. Deins, meins, Westons, Mayas …«
»Manchmal denke ich eben, ich enttäusche sie.«
»Du meinst Blythe, oder?«
»Ja.« Ich fixiere einen Brandfleck auf dem verblichenen weißen Plastiktisch, den Curtis dort hinterlassen hat.
»Sie war die Königin der Improvisation«, sagt Link. »Und du bist ein würdiger Nachfolger.«
Ich lächle. »Ja … vermutlich hast du recht.«
»Glaubst du, die beiden würden sich einen anderen Vater wünschen? Denkst du, es gibt für die zwei einen besseren Dad als dich?«
»Vermutlich nicht, oder?«
»Sehr richtig.« Er klopft mir auf die Schulter. »Aber wenn es dich wirklich so wurmt, warum fragst du nicht Hugo, ob er ab und zu einspringt?«
Ich blicke wieder zu den dreien. Hugo ist es gelungen, sich Maya unter den Arm zu klemmen. Sie kreischt und quietscht.
»Dafür ist es noch zu früh. In ein paar Monaten vielleicht. Wir haben ihn gerade erst kennengelernt. Ich will sichergehen, dass er bleibt.« Es ist merkwürdig, das auszusprechen. So konkret habe ich noch nie darüber nachgedacht. Aber es stimmt wohl. Ich kann mir noch nicht zu hundert Prozent sicher sein.
»Oh, glaub mir, er bleibt«, sagt Link grinsend. »So, ich mache mich auf ins French Quarter.«
»Straßenmusik?«, frage ich.
»Die Miete zahlt sich nicht von allein.«
Nachdem er gegangen ist, schlage ich mein Buch wieder auf. Mit halbem Ohr höre ich auf das Gejohle der Kinder, um eingreifen zu können, falls es zu toll wird. Doch Hugo scheint alles im Griff zu haben. Und ich merke, wie sich erst mein Körper und dann mein Geist langsam, aber sicher entspannen.
5 – Bonnie
Heute
»Lula?« Ich klopfe an ihre Zimmertür. »Lula, du musst aufwachen. Sie kommen gleich.«
Ich lausche, doch drinnen regt sich nichts. Bestimmt ist sie erst in den frühen Morgenstunden nach Hause gekommen. Freitags und samstags arbeitet sie meistens, bis der Nachtclub schließt.
»Lula!« Ich hämmere ein bisschen fester gegen die Tür. »Aufwachen!«
Natürlich könnte ich sie auch weiterschlafen lassen. Laut meiner Mom ist es uns selbst überlassen, ob wir an ihrem monatlichen Gemeindebrunch nach dem Gottesdienst teilnehmen, aber Lula und ich wissen beide ganz genau, dass es ihr wichtig ist. Und keine von uns will herausfinden, wie wichtig. Deswegen haben wir einen Deal. Obwohl ich jeden vierten Samstag im Monat selbst spät nach Hause komme, weil ich mit einer Veteranenband im Vape spiele, bereite ich den Brunch vor und lasse Lula so lange wie möglich schlafen, dafür kümmert sie sich später um den Abwasch.
Hinter der Tür erklingt ein genervtes Grunzen. »Bnwch«, krächzt sie.
Unten duftet es nach Speck und Pancakes. Der Esstisch im Wohnzimmer ächzt unter den Massen an gefüllten Schüsseln und Tellern. Eigentlich ist unser Haus zu klein für Einladungen dieser Größenordnung. Glücklicherweise ist es ein schöner Tag, und so werden sich die meisten Gäste wohl ohnehin auf der Veranda und im Vorgarten tummeln.
»Alison würde sich sicher freuen, wenn du sie mal wieder besuchst«, sagt Mrs Withers gerade. »Sie und Kenny sind einfach Zucker!« Sie zückt ihren Geldbeutel, um mir ein Hochzeitsfoto der beiden zu zeigen.
Alison und ich saßen in der Grundschule nebeneinander, Freundinnen waren wir allerdings nie wirklich. Dennoch sehe ich mir natürlich die Fotos an.
»Nichts macht einen fröhlicher als junges Glück«, fährt Mrs Withers fort. »Aber keine Sorge, du findest bestimmt auch bald den Richtigen.«
»Ja, sicher«, erwidere ich, denn es hat keinen Zweck, Mrs Withers zu erklären, dass nicht jeder Lebensplan einen Mann und Kinder vorsieht. Dafür ist in ihrer Vorstellung kein Platz.
»Vielleicht ist er ja sogar heute hier!«
Ich nicke mechanisch. Sie ist nicht die Einzige, mit der Lula und ich diese Art von Gesprächen führen. Die meisten Freundinnen unserer Mom sehen es als unsere Aufgabe auf dieser Welt an, uns zu vermählen und zu reproduzieren. Je früher, desto besser. Dass ich mich mit meinen dreiundzwanzig Jahren und in meiner Position als Langzeit-Single bisher nicht unbedingt intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, behalte ich für mich. Lula ist da anders. Lula fragt jedes Mal direkt, ob sie Mann und Kinder dann mit in den Nachtclub nehmen sollte. Daraufhin sind die meisten Leute still. Aber ich will meine Mom nicht vor den Kopf stoßen, indem ich während eines ihrer Brunchs eine Diskussion lostrete.
»Sie kaufen gerade ein Haus hier in der Gegend. Das wäre doch auch etwas für dich. Ein kleines Häuschen in der Nähe deiner Familie …«
Das ist meine Privatangelegenheit, würde ich gern sagen. Stattdessen erwidere ich: »Ja, das wäre sicher schön.«
»Emmy, Liebes, ich habe Bonnie gerade erzählt, dass Alison und Kenny sich ein Haus kaufen. Und dass ihr Traummann vielleicht näher ist, als sie denkt.« Mrs Withers zwinkert mir zu.
»Bestimmt, Süße«, sagt meine Tante Emmy. »Oft passiert es ja, wenn man es am wenigsten erwartet.«
Ich habe echt kein Interesse an einem eurer Junggesellen, würde ich gern sagen. Stattdessen drehe ich den Kopf zur Seite, damit niemand meinen inzwischen genervten Gesichtsausdruck bemerkt. Meine Erleichterung kennt keine Grenzen, als ich sehe, dass Amory in diesem Moment das Gartentor öffnet. Im Schlepptau hat sie Link und seine Freundin Franzi.
»Ich muss kurz meine Freunde begrüßen«, sage ich entschuldigend und bahne mir entschlossen den Weg durch, wie es scheint, die gesamte Nachbarschaft.
»Gott, bin ich froh, euch zu sehen!« Ich falle allen drei um den Hals. Gleichzeitig.
Link grinst. »Mrs Withers?«, fragt er.
»In Kombination mit Emmy.«
»Dann sind wir ja keine Sekunde zu spät.«
Franzi blickt fragend von Link zu mir. Sie ist heute zum ersten Mal bei unserem Gemeindebrunch.
»Nachbarschaftstratsch«, erklärt Amory. »Lasst uns was zu essen holen.«
Drinnen hat meine Mom ihre Haarschneide-Station aufgebaut. Sie war früher Friseurin in einem Salon, bevor er dichtmachte. Seither kommen die Leute zu ihr nach Hause. Während des Brunchs schneidet sie die Haare von Bedürftigen umsonst.
»Heute entkommst du mir nicht«, sagt sie, als sie Link erblickt. »Deine Haare müssen ab!«
Sie unterbricht ihre Arbeit an dem Jungenkopf, ermahnt den kleinen Kerl jedoch, sitzen zu bleiben. Dann wackelt sie auf uns zu.
»Amory!« Sie drückt sie fest an sich. Daraufhin wendet sie sich Link zu. »Mein Junge«, sagt sie und schließt Link in ihre mächtigen Arme.
»Annabella, das ist meine Freundin Frenzy«, stellt er seine Begleitung vor.
»Franzi«, korrigiert Franzi.
»Willkommen in der Familie«, sagt meine Mom und drückt sie ebenfalls an sich. »Wurde auch Zeit, dass unser Link mal jemanden mit nach Hause bringt. Zu uns nach Hause«, fügt sie noch hinzu.
Sie wackelt zu dem Jungen zurück, der vollkommen starr sitzen geblieben ist. Es ist schön zu sehen, wie groß der Respekt ist, den meine Mom hier genießt. Sie ist einer der Bausteine, der diese Community am Laufen hält. Jeder hilft jedem, man rückt zusammen. Man kennt sich, man mag sich mal mehr, mal weniger, aber niemals würde man einander hängen lassen.
Am späten Nachmittag haben sich die meisten Gäste verabschiedet. Auf dem Haarschneide-Stuhl sitzt inzwischen Lula, deren Kurzhaarfrisur schnell nachkorrigiert ist. Die Seiten ganz kurz, oben ein kleiner Afro.
Meine Haare sind glücklicherweise nicht so wartungsintensiv. Ich trage sie in langen, dicken Box Braids mit hineingeflochtenen weißen Strähnen, die ein paar Monate halten.
»So, Lula, fertig«, sagt meine Mom und gibt ihr einen Klaps auf die Schulter. »Link, du bist dran. Man sieht ja dein hübsches Gesicht kaum noch.«
Er streicht sich seine dunkelblonden Haare aus der Stirn und grinst. »Also gut, weil du es bist.« Er setzt sich auf den Stuhl und lässt sich von meiner Mom in den schwarzen Umhang hüllen.
Ich nehme Amory und Franzi mit nach draußen. Franzi will Lula erst mit dem Abwasch helfen, aber zu meiner Überraschung lehnt meine Schwester das Angebot ab. »Das schaff ich schon allein«, versichert sie.
»Danke für die Einladung«, sagt Franzi, als wir uns im Garten auf den alten Plastikstühlen niedergelassen haben. »Es ist schön, zu sehen, wie Links Freunde wohnen. Teil davon zu sein.«
Amory und ich werfen uns einen Blick der stillen Übereinkunft zu. Franzi ist Links Freundin. Sie hat bewiesen, dass sie Link glücklich macht, indem sie aus Deutschland nach New Orleans ausgewandert ist, nur um bei ihm sein zu können. Und wenn er sie liebt, werden wir es auf eine freundschaftliche Art auch tun.
»Für ihn ist es toll, dass du dabei bist«, sage ich. Denn es stimmt. Ich habe ihn noch nie so glücklich und gelöst erlebt. Nicht einmal früher, als alles noch in Ordnung war. Seine Familie noch vollständig.
»Wir sollten mal was zu dritt machen«, schlägt Amory vor, und ich nicke ihr dankbar zu. »Einen Filmabend oder so. Bei mir in der WG.«
Franzi lächelt. »Sehr gern.« Dann: »Deine Schwester wirkt sehr nett.«
»Haha, ja«, erwidere ich. »Sie ist interessant.«
»Man würde kaum glauben, dass ihr Zwillinge seid. Sie ist so …«
»Freizügig?«, bietet Amory lachend an.
Lula ist bis auf ihr Gesicht tatsächlich das ziemliche Gegenteil von mir. Abgesehen von den kurzen Haaren, zeigt sie außerdem gern so viel wie möglich von ihrer perfekten Figur und ihrer tätowierten Haut. Das war schon so, bevor sie anfing, in aufreizender Wäsche für Touristen zu tanzen. Vermutlich ist es deswegen ihr Traumjob. Sie liebt es einfach, sich zu zeigen. Und keiner kann es ihr verdenken. Ich im Gegensatz trage seit jenem Abend vor über vier Jahren nichts anderes als weite Jeans, in die ich weite T-Shirts stecke. Ich besitze nicht ein einziges Set hübsche Unterwäsche, sondern verstecke mich mithilfe von Sport-BHs und schlichten, schwarzen Baumwollpants.
Kurz ertappe ich mich bei dem Gedanken, dass es schön wäre, wenigstens mit Amory über die Gründe für meinen Kleidungsstil sprechen zu können. Abgesehen von Link, wusste und weiß niemand Bescheid. Schließlich war meine beste Freundin mit dem Objekt meiner verbotenen Gedanken und Gefühle verheiratet. Und Link weiß es auch nur, weil er in mich hineinsieht wie sonst niemand. Eines Tages kam er zu mir und sagte: »Du bist in Jasper verliebt, oder?« Eine Woche sprachen wir nicht miteinander. Dann erzählte ich ihm alles.
»Sollen wir zurückgehen? Sichergehen, dass meine Mom Link keinen militärischen Kurzhaarschnitt verpasst?«, frage ich, bevor meine Gedanken sich verselbstständigen.
Franzi sieht alarmiert aus.
»Keine Sorge, sie macht nur Witze«, sagt Amory. »Annabella ist eine Künstlerin.«
Tatsächlich sieht Link – sofern das überhaupt möglich ist – mit etwas kürzeren Haaren noch besser aus. Sie fallen ihm immer noch in die Stirn, aber längst nicht mehr so tief. Er wirkt reifer, ernsthafter. Und an Franzis Gesichtsausdruck erkenne ich, dass sie auch mehr als zufrieden mit dem Ergebnis ist.
»Alter«, sagt Lula, »wärst du nicht so blass, hätte deine Freundin ein Problem.« Sie grinst anzüglich, während sie die spärlichen Reste des Brunchs auf einen Teller lädt.
»Dazu gehören immer noch zwei, Lula«, erwidert Link und wuschelt sich durch die neue Frisur.
»Als könntest du mir widerstehen.« Sie zwinkert ihm zu und leckt sich über die Lippen.
»Du bist wie eine Schwester für mich.« Link verzieht das Gesicht.
»Es wäre wirklich supereklig«, pflichte ich ihm bei.
»Ich mach nur Spaß«, sagt Lula und wirft erst ihm, dann Franzi eine Kusshand zu. »Keine Sorge.«
Kurz durchzuckt mich ein Stich, weil mir auf einmal schmerzhaft bewusst wird, dass das Glück, das Link und Franzi haben, für mich nicht bestimmt ist. Meistens komme ich mit dieser Tatsache zurecht. Aber in Momenten wie diesen, in denen ansonsten alles perfekt ist, die durch ihre Friedlichkeit und Seligkeit beinahe schmerzhaft schön sind, erschüttert mich der Gedanke daran. Dann ist es, als würde mein Herz trotz der dicken Mauern drum herum brechen. Für ein paar Sekunden bleibt mir die Luft weg, und ich muss die Augen schließen, um mich zurückzubesinnen. Jaspers Gesicht flackert kurz hinter meinen geschlossenen Lidern auf, doch ich vertreibe es mit aller Macht.
Als ich wieder in die Runde blicke, ist der stechende Anflug vorbei, und ich bin wieder da. Mit den Händen in den Hosentaschen meiner weiten Boyfriendjeans.
6 – Jasper
Heute
Phoenix lebt in einem kreolischen Cottage, das unserem nicht unähnlich ist. Der Hauptunterschied ist wohl die Buntheit hier. Am Gartenzaun hängen Hunderte von Perlenketten, die mit jedem Mardi Gras mehr werden. Auf der Veranda stehen bemalte Blumentöpfe dicht an dicht. Statt Gardinen sind bunte gebatikte Tücher in den Fenstern angebracht.
»Hallo, ihr Schätze«, sagt Phoenix mit ihrer tiefen Männerstimme. »Bereit für unseren Mädelsabend?«
Maya nickt begeistert und reicht Phoenix ihren Stoffaffen, den sie zu jedem Übernachtungsdate mitschleppt.
»Ich bin kein Mädchen«, korrigiert Weston.
»Das weiß ich doch, handsome, aber man muss kein Mädchen sein, um einen schönen Abend zu haben.«
»Du hast aber ›Mädelsabend‹ gesagt«, beharrt er.
»Das ist doch nur ein Wort. Niemand wird ausgeschlossen.«
Deswegen liebe ich es, dass meine Kinder in Tremé aufwachsen. Die Vielfalt, mit der sie seit ihrer Geburt konfrontiert werden, macht ihr Leben reich und bunt. Genauso hätte ich es mir für mich selbst auch gewünscht. Stattdessen saß ich in prunkvollen Villen, erhielt klassischen Klavierunterricht und lernte für die Schule. Es war behütet, sicher – solange mein Vater nicht da war. Aber für einen kleinen Jungen unendlich langweilig. Bei der ersten Gelegenheit – ich kann kaum älter als vierzehn gewesen sein – stahl ich mich weg. Ich überlistete meine Nanny und wagte mich ins musikalische Leben von New Orleans. Mein Klavierlehrer hatte mir von einer Musikschule in Tremé erzählt, in der Kinder und Jugendliche Jazz und Funk spielten. Und dort ging ich hin, wann immer ich konnte. Ich lernte Bonnie und Link kennen. Und über sie Blythe.
Maya hat es sich bereits auf Phoenix’ Sofa gemütlich gemacht. Weston stellt seine Schuhe ordentlich in den Eingangsbereich.
»Trinkst du noch einen Tee mit uns?«, fragt Phoenix, und da ich noch etwas Zeit habe, nehme ich dankend an.
Von einem kleinen, runden Tisch fegt Phoenix mit der Hand ein paar Bastelarbeiten in einen Korb auf dem Boden. Sie näht all ihre Kostüme selbst, und es sieht so aus, als wäre sie gerade dabei, neue Masken mit Federn und Pailletten zu gestalten.
»Also sag schon, Darling, was ist los?«, erkundigt sie sich, während sie einen dampfenden Becher mit Kräutertee vor mich stellt.
»Was meinst du?«, frage ich.
»Süßer, man sieht dir aus hundert Metern Entfernung an, dass du grübelst.«
Ich muss lachen. »Tut man das also?«
»In der Tat.« Sie streicht mir mit ihrer großen Hand über den Arm.
»Dann muss es wohl das Übliche sein«, sage ich.
»Das ›Übliche‹ haben wir alle, Schatz.« Sie sieht mich auf diese forschende Art an. Ihre Augen wirken durch die Masse an Schminke, die sie gekonnt darum verteilt hat, noch größer.
»Du weißt doch, wie es ist. Geld, Verantwortung … Manchmal spüren wir es mehr, manchmal weniger.«
»Das ist alles sehr wahr. Aber weißt du, was guttut?«, fragt sie und legt ihre Hand auf meine Hand. »Wenn man dabei nicht allein ist.«
»Ich bin nicht allein. Ich habe meine Band, dich, seit Neuestem einen Großvater …«
»Und wer ist da, wenn abends das Licht ausgeht?«
Mich durchzuckt etwas. »Meine Kinder und ich«, sage ich und lächle Phoenix müde an.
»Es ist jetzt wie lange her?«, fragt sie. »Vier Jahre? Mehr als das, oder?«
»Etwas.« Vier Jahre, in denen ich getrauert habe, gelernt habe, mit der Trauer um meine Frau zu leben, angefangen habe, mich auf die schönen Erinnerungen zu konzentrieren und den Schrecken zu vergessen.
»Es ist keine Schande, sich anlehnen zu wollen. Es ist kein Betrug«, sagt sie.
»Bietest du dich an?« Ich weiß nicht, wie ich auf ihre Worte reagieren soll. Deswegen bleibt mir nur die Flucht in den Humor.
»Du weißt, dass ich dir verfallen bin«, sagt sie theatralisch und klimpert mit ihren falschen Wimpern. »Aber das meine ich nicht.«
»Was ist nur los mit euch?«, frage ich grinsend. Mir fallen Curtis’ Bemerkungen während unserer Bandprobe vor ein paar Tagen ein. Der Inhalt war zwar ein anderer – bei Curtis ging es wie immer um Sex –, aber die Botschaft war die gleiche. Und dann kommt mir Bonnies Blick in den Sinn. Eine Mischung aus Genervtheit und Unsicherheit in ihren mahagonifarbenen Augen. Ich habe seither ab und zu an diesen Blick gedacht. Und daran, dass sie anders aussah. Frischer. Auf merkwürdige Art schöner.
»Wir sehen dich«, sagt Phoenix. »Und nicht nur das. Wir sehen dich außerdem als einen Menschen, der Bedürfnisse hat.«
Kommen wir jetzt Curtis doch näher? »Phoenix!«, tadle ich sie scherzhaft.
»Ach, du denkst, es geht hier um Sex?« Sie lacht ihr dunkles Lachen. »Nein, Süßer, auch wenn ich nicht abstreiten würde, dass es mit dir ein reizvolles Thema wäre.«
Ich sehe mich nach Weston und Maya um, aber die beiden sind vertieft in ihr Spiel.
»Du, mein lieber Jasper, bist einsam.«
Ich verschlucke mich beinahe an meinem Tee. »Schwachsinn.«
»Ach ja?«, fragt Phoenix.
Es ist Schwachsinn. Ich habe alles, was ich brauche. Meine Kinder, meine Freunde. Seit Kurzem habe ich sogar einen Hugo, was auch immer das bedeutet. Ich bin nicht einsam.
»Du wehrst dich. Aber glaub mir, ich habe recht. Ich weiß das, weil ich deinen Gesichtsausdruck kenne. Früher habe ich auch so ausgesehen. Früher, als ich noch … Hosen getragen habe.« Sie grinst. »Das Alleinsein ist deine Hose.«
Ich habe das Gefühl, Phoenix ist ihr Tee zu Kopf gestiegen. »Was hast du in die Mischung getan?«, frage ich und deute auf ihre Tasse.
»Nichts, wenn Kinder da sind. Das weißt du ganz genau.«
»Nur, weil man allein ist, bedeutet das nicht, dass man einsam ist, weißt du?«, versuche ich es.
»Oh, glaub mir, das ist mir bewusst. Und nur, weil man zweisam ist, bedeutet das auch nicht, dass man nicht einsam ist.«
Ich erinnere mich an Phoenix’ Geschichte. Damals, als sie noch Moses war. Verheiratet mit einer Frau. Wie es sie beinahe alles gekostet hat, das Leben zu führen, das ihr gestattet, sie selbst zu sein. Und wie sie dann wie ein Phoenix aus der Asche aufstieg und zu einem glücklichen Menschen wurde.
»Ich will nur, dass du Folgendes weißt: Es ist keine Schande, Sehnsüchte zu haben und ihnen nachzugehen.« Auf einmal ist ihre Stimme ganz sanft. Sie nimmt wieder meine Hand und drückt sie einmal fest. »Du bist ein toller Vater. Ein toller Mensch. Du hast es verdient, glücklich zu sein.«
Ich schlucke. »Das weiß ich. Danke, Phoenix.«
Wir trinken unseren Tee, dann blicke ich auf die Uhr.
»Ich glaube, ich sollte wohl langsam mal los. Wenn was ist, Phoenix, ruf an. Die Nummer vom Cat’s Cradle …«
»… hab ich. Mach dir keine Sorgen, Jasper, es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Zuckerstücke hier übernachten.«
Ich weiß, dass sie recht hat. Und trotzdem plagt mich das schlechte Gewissen. Ich wäre gern in der Lage, meine Kinder selbst ins Bett zu bringen. Jeden Abend. Seit wir nur noch zu dritt sind, ist dieses Band zwischen uns so viel stärker und wichtiger geworden. Auch wenn Blythe in unseren Gedanken ist. Dafür sorge ich. Aber mein Job als Klavierlehrer reicht uns nicht zum Überleben. Nicht mit diesem enormen Schuldenberg. Und mir persönlich würde es auch nicht reichen. Ich brauche die Musik, die Gigs, das Leben. Das ist meine Berufung, meine Medizin gegen alles, was auf mir lastet.
»Also dann, ihr zwei, ich hole euch morgen ab!«, sage ich auf meinem Weg nach draußen und küsse meine beiden Kinder auf den Scheitel.
»Bye, Dad!«, sagt Weston, ist jedoch gleich wieder vertieft in irgendein Comicheft.
Maya winkt.
»Ab mit dir«, befiehlt Phoenix sanft. »Und hör auf, dir Sorgen zu machen. Es steht dir zwar, aber fürs Herz ist es nicht gesund.« Sie tippt gegen meine Brust. »Und das musst du schützen. Denn es ist das Einzige, was noch schöner ist als dein hübsches Gesicht.« Sie grinst, dann schiebt sie die Tür zu.