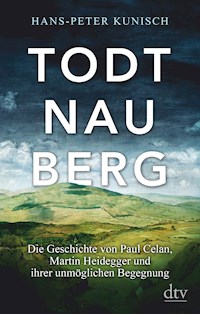19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die brisanten Briefe des Dichters In den Briefen, die Rilke insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg mit der jungen Mailänder Fürstin Aurelia Gallarati-Scotti wechselte, offenbart der Dichter eine noch immer wenig bekannte und gern verdrängte Seite: Er zeigt offen Sympathien für den italienischen Faschismus und autoritäre Regime – Gallarati-Scotti widerspricht ihm mit humanistischer Klarheit, woraufhin sich Rilke nur noch tiefer verrennt. Hans-Peter Kunisch gelingt in seiner Biografie mit erzählerischen Mitteln eine brillante Analyse, die das Werk eines der bekanntesten deutschen Dichter und seine politischen Überzeugungen in einen neuen Kontext stellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Hans-Peter Kunisch
Das Flimmern der Raubtierfelle
Rilke und der Faschismus
Reclam
Für Ursula Kunisch-Mauch (1925–2021)
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH
Coverabbildung: akg-images
Autorenfoto: © Cornelia Jeske
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMSUNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962434-1
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011503-9
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Vorbemerkung
I »Was für eine schöne Rede von Herrn Mussolini!«
II »Nein, lieber Rilke«. Lellas erste Entgegnung und ein zweifelhafter Kronzeuge
III »Ihnen gegenüber werde ich immer aufrichtig sein«.Rilke lobt die »wahren Diktatoren«. Der Brief vom 17. Januar 1926
IV »Töten ist eine Gestalt unseres wandernden Trauerns«. Archaische Jagd in den Sonetten an Orpheus
V Das Flimmern der Raubtierfelle. Die Duineser Elegien, der Archaïsche Torso Apollos und Die Aschanti
VI »Raus, raus, verlasst die häuslichen Mauern, so wie der Pfarrer die Sakristei!«. Lellas »engagierte« Jugend bei Padua
VII »Wann wird sich endlich dieser übertriebene Nationalismus beruhigen«. Lellas Antwort vom 10. Februar 1926
VIII Der Convegno und der Circolo filologico – kultureller Antifaschismus in Mailand
IX Totprügeln bei Tageslicht. Italien Mitte der 1920er Jahre. Der Fall Matteotti
X Der »Architekt des italienischen Willens«. Rilkes Brief vom 14. Februar 1926
XI »Wenn ich Ihnen lediglich meine Zustimmung ausdrücken wollte, fühlte ich mich schon steif und beklommen«
XII Eine verschobene Parallele: Thomas Manns Mario und der Zauberer
XIII Gesänge und Katzenjammer. Rilkes Krieg
XIV »Die innige Zusammenarbeit aller geistig Interessierten.« Der humanistische Beginn des Briefwechsels
XV Der Nationalismusbrief von 1923
XVI René Maria Rilke – ein Freund der Tschechen?
XVII Eine andere junge Frau. Rilke, Ilse Blumenthal-Weiss und das Judentum
XVIII Muzot und das Suastika, oder: Rilkes Beziehung zu Alfred Schuler
XIX Schwache, reiche Humanisten, ein dunkler Mann und eine alte Verbindung zum Duce
XX Die letzte Zeit
XXI Eine Widerstandszelle im Kloster, die Töchter verteilen Flugblätter auf Fahrrädern, Lella sitzt im Rollstuhl
XXII »Wir wollen ganz gewiss nicht als eine Art Zensurstelle für Rilke-Publikationen gelten.« Über Methoden der Verharmlosung und Vermeidung
XXIII Alles, was da ist
Literaturhinweise
Dank
Vorbemerkung
Vor einiger Zeit blätterte ich in den Russland-Reisebriefen von Rilke und Lou Andreas-Salomé, folgte Rilkes ekstatischer Schilderung einer Feier der orthodoxen Osternacht im Kreml und der Idylle einer gemeinsamen Fahrt auf der Wolga. Ich verstand, warum das Paar mitgerissen war, und gleichzeitig kam mir dieses Schwelgen in fremden einfachen Lebensumständen schon damals anachronistisch vor: »We Had a Wonderful Time in This Terribly Poor Country« hieß mal ein Bild eines Pärchens vor idyllischer Landschaft in einer zeitgenössischen Kunstausstellung. Jahre später, als ich während des Ukrainekriegs wieder in die russischen Briefe schaute, fiel mir auf, dass Rilke Kiew abgelehnt hatte, es war ihm zu »international«, es gebe dort »elektrische Bahnen« und »große Hôtels«.1 Und dann las ich plötzlich irgendwo im Netz, dass Rilke für Mussolini und den Faschismus geschwärmt habe.
Wie? Rilke und Mussolini? Der Dichter, der die feinsten Verästelungen der Liebe wie der Einsamkeit kannte und einen Feigenbaum beschreiben konnte, dass man ihn zum ersten Mal sah? Ein Mann, der mit seinen sanften Versen ganze Reihen von Schlossherrinnen in beseelte Backfische verwandelt hatte; der jedem eingesperrten Tier mit seinem Schulbuch-»Panther« ein Denkmal gesetzt hat, das heute noch wirkt?
Und gleich neben diesem zarten Wortkünstler sollte sich auf einmal ein aufgeblasener Politclown ins Bild drängen, den man jahrzehntelang allenfalls gerühmt hatte, weil er »nicht so schlimm war wie Hitler«? Wobei die Verharmlosung Mussolinis und seines brutalen Regimes seinen deutschen Lehrling mit an die Macht gebracht hat.
Wirklich: Rilke und der erste regierende Faschist Europas? Was mich besonders überraschte, war, dass ich doch längst hätte Bescheid wissen müssen. Schließlich kam ich ja tatsächlich aus Rilke-Land. Nicht nur, dass ich gerade mal sieben Kilometer von Rilkes Grab entfernt geboren wurde und aufgewachsen war; dass manche meiner Lehrer so begeistert von ihm erzählen konnten, als sei Rilke »einer von uns«. Nein, auch zu Hause war Rilke da. Eine stattliche Zahl Insel-Bändchen stand bereit und wurde gelesen, von seinem Stunden-Buch bis hin zu den Duineser Elegien. Rilkes berühmtes Gedicht Archaischer Torso Apollos, das ich anfangs höchstens halb verstand, und sein noch berühmterer, trocken-pathetischer Schluss hatten mich immer begleitet: »Du musst Dein Leben ändern.«2
Regelmäßig waren wir zu Rilkes schön gelegenem, schlichtem Grab spaziert, hatten sein bekanntestes, dort in Stein gemeißeltes Rosengedicht beschaut, waren gelegentlich um Muzot, den immerhin dreißig Kilometer entfernten, legendären Ort seines letzten großen kreativen Schubs herumgeschlichen, hatten uns durch Rilkes Lob der Landschaft, in der wir lebten, beinahe persönlich geehrt gefühlt, empfanden uns in den früher glutheißen Sommern dort gelegentlich schon als Spanier und Provenzalen.
Dann hatte ich auch noch in München Germanistik und Philosophie studiert, an einer Universität, an der ich, dank bloßer Namensgleichheit mit einem historischen Rilke-Forscher, manchen Dozenten als prädestiniert für meine Fachrichtung galt. Während mich andere aus dem gleichen Grund besonders kritisch beobachteten. Manchmal versuchte ich, Rilke schon zu umgehen. Aber beinahe naturgemäß fuhr ich dann doch irgendwann nach Duino und Ronda. Wie viele lachte ich über die affektierten Jugendgedichte und war begeistert von der radikalen Paris- und Selbsterfahrung in den Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, die mich bis heute unmittelbar in ihren Bann ziehen und eines der beeindruckendsten Werke der europäischen Avantgarde geblieben sind.
Natürlich wusste ich auch bald, dass Martin Heidegger, viel zu lange ein Propagandist Hitlers, Rilke als Schüler Hölderlins für sich in Anspruch nahm3; dass Heideggers philosophischer Rivale Theodor W. Adorno im gegen Heidegger gerichteten Jargon der Eigentlichkeit Rilke als »auf dem Grat«4 zum Faschismus stehenden Dichter mit aufgenommen hatte. Doch das waren nicht mehr als Interpretationen, die man beide mit gutem Recht anzweifeln konnte, Stellvertretergefechte auf den schmalen Schultern eines so einzelgängerischen wie salontauglichen Dichters, mit denen sich nichts beweisen ließ.
Aber Rilke von »wahren Diktatoren« begeistert? Er lobe die »gesunde und sichere Gewalt« des Duce, las ich jetzt, diesen »Schmied eines neuen Bewusstseins, dessen Flamme sich an einem alten Feuer entzündet. Glückliches Italien!« Das hatte Rilke geschrieben? Wo? Warum hatte ich nichts davon gehört?
Lag es nur daran, dass ich gelernt hatte, zuerst die Bücher der Autoren zu lesen, statt von vornherein die Geschichten über ihr Leben? Rilke war ein Konservativer, klar. Wer freundlich profitierend von Adelssitz zu Adelssitz zieht, muss aufpassen, nicht zu sehr als Revolutionär aufzufallen. Aber ausgerechnet der Faschismus, mit seinen pathetisch wuchernden Sprachverhunzungen? Rilke war in seinen besten Gedichten doch sehr um Genauigkeit des Ausdrucks bemüht.
Und wenn Faschismus – wer hatte mir und einigen anderen, die bei der Erwähnung von »Rilke und Mussolini« jetzt erst einmal erstaunt den Kopf schüttelten, die Sicht darauf vernebelt?
Warum fand sich in all den Regalmetern der Forschung nur sehr wenig dazu? Ich fing an zu recherchieren: Ein Buch von Egon Schwarz, eines jüdischen Emigranten aus Wien, mit erzwungen abenteuerlicher Lebensgeschichte und einem dazu passenden lebensnahen Blick auf Literatur hatte vor über fünfzig Jahren für einige Zeit für Aufregung gesorgt.5 Aber das war lange her, und inzwischen tat man wieder so, als sei nie etwas geschehen und Rilke mehrheitlich etwas zum Staunen für feinsinnige ältere Herrschaften und Popstars wie Lady Gaga. Meist wird schnell abgewunken, »das« sei vielleicht da, aber nicht wichtig. Und so geht das bis in die jüngste Zeit.6
Aber wie sehen Rilkes Stellungnahmen zum Faschismus denn überhaupt aus? Warum gibt es siebzig Jahre nach ihrer Entdeckung zwar eine unvollständige französische Originaledition und eine parallel erschienene, ebenso unvollständige italienische Übersetzung jener Lettres Milanaises, um die es auf den ersten Blick geht7, aber keine ordentliche deutschsprachige Ausgabe? Es gibt unzählige Editionen von Rilke-Briefen, doch ausgerechnet in diesem Fall ist mehr als ein erster Versuch dazu in einer vor gut fünfzig Jahren in den USA entstandenen Doktorarbeit nicht vorhanden.8 Einem dicken deutschen Band politischer Briefe, in dem eine kleine Auswahl besagter Lettres zwischen über 200 anderen Briefen versteckt ist, merkt man den Versuch des wacker gralshüterhaften Herausgebers, seinen Helden vor allen erdenklichen unangenehmen Fragen zu schützen, im Kommentar und auf jeder Seite des Nachworts deutlich an.9
Aber genauso stellt sich natürlich die Frage: Haben Rilkes Aussagen zum Faschismus denn etwas mit seinem Werk zu tun? Sind seine politischen Überzeugungen dort sichtbar? Oder waren diese vielleicht doch nur ein seltsamer Ausrutscher, geboren aus dem getrübten Bewusstsein eines schwerkranken Mannes, wie gern erzählt wird?
Ich musste Rilke selbst noch einmal lesen.
Und Mussolini? Eine Schwester meiner Großmutter hatte einen Sizilianer geheiratet, einen freundlichen kleinen Mann, der in Italien Deutsch und Griechisch unterrichtete und es durch seine bescheidene Art und seinen genauen Witz bei mir zum Lieblingsverwandten gebracht hatte. In unserem letzten Gespräch vor seinem Tod hatte er plötzlich Mussolini gepriesen. Für die Italiener sei er der Richtige gewesen. Danach hatte ich mich näher mit dem Duce beschäftigt. Jetzt stieß ich unter Rilkes Briefpartnerinnen auf eine Italienerin, die dem Dichter aus Prag, der nicht auf sie hören wollte, einen Eindruck zu vermitteln versuchte von dem, was damals in Italien geschah.
Wer war diese Frau? Von ihrer offenen Ablehnung des Faschismus ging Rilkes vertiefendes Lob erst aus. Doch über sie selbst war in den Rilke-Büchern, die so gern möglichen Liebschaften des Dichters nachspürten, bis auf wenige Zeilen nichts zu finden.10 Wie kam Aurelia Gallarati-Scotti, von der ich zuerst nur diesen Namen kannte, dazu, dem Bewunderten auf seinen ersten begeisterten Mussolini-Satz ohne Umschweife mit »Nein, lieber Rilke« zu antworten – und ihn damit zu für ihn ungewöhnlichen, ausführlichen Gegenreden herauszufordern? Ich begann, auch nach ihr zu forschen, von der natürlich viel weniger bekannt war, bemühte mich, beider Leben bis zu ihrem Aufeinandertreffen und während des Briefwechsels zu rekonstruieren. Wie kamen sie in ihrer Zeit zu ihren Überzeugungen? Was beschäftigte sie, während sie schrieben? Allmählich verstand ich, was da passiert war. Und begann mich zu fragen, was die Auseinandersetzung der beiden über den Faschismus mit unserer Zeit zu tun haben könnte.
Es soll hier also nicht darum gehen, Rilke zu schützen oder ihn böse vom Sockel zu stürzen. Es wäre auch ganz falsch, Reinheit, Unfehlbarkeit von ihm zu erwarten. Großartige Künstler können politisch, moralisch oder in ihrem Privatleben Würmer sein – und trotzdem großartige Kunst schaffen. Genauso falsch ist es aber, deswegen nichts von den Untiefen in ihrem Leben und Denken wissen zu wollen, aus denen sich diese Kunst eben auch speist. Wenn wir über die Werke von Dichtern oder Schriftstellern mehr von der Welt verstehen möchten, müssen wir diese Menschen schon ganz kennenlernen wollen.
I»Was für eine schöne Rede von Herrn Mussolini!«
Wieder liegt Rilke in Zimmer 47. Wieder ist die Aussicht vom dritten Stock der Klinik Val-Mont majestätisch: schräg gegenüber, in der Ferne, die »Zähne des Südens«, die mächtige Alpenkette der Dents du Midi. Davor, weit unten, der breite und langgezogene, die Dreitausender auf Distanz haltende Genfer See.
Wenn der vor etwas mehr als fünfzig Jahren in mittlere Prager Verhältnisse geborene Dichter, der in literarischen Kreisen schon zu Lebzeiten berühmt ist, aber sich nach wie vor als prekäre Existenz empfinden darf, an diesem 5. Januar 1926 kurz auf seinen Balkon geht, kann er zwei kleine Dörfer am Südostufer des Sees über Kilometer hinweg in der Sonne leuchten sehen: St. Gingolph und Le Bouveret, wo die Rhone, die man im Deutschen ohne Zirkumflex schreibt, den »Hafen des Wallis« bildet, des Schweizer Kantons, in dem Rilke seit mehr als vier Jahren seinen festen Wohnsitz hat.
Val-Mont liegt, so exponiert wie verwunschen, in einer Waldlichtung hoch über Montreux. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts werden hier wohlhabende Menschen kuriert. Seit 1909 bringt eine elektrifizierte Zahnradbahn, die damals bis in das nahe Dorf Glion führt, sie an eine kleine Haltestelle nur für die Klinik, von der man in zehn Minuten gemütlich durch den Wald hinaufspaziert.
Endlich Ruhe. In München war es am Ende unaushaltbar. Dort hat man Rilke im Frühling 1919 eines Tages um fünf Uhr morgens mit Gewehrkolben an seine Schwabinger Wohnungstür geholt und des Bolschewismus verdächtigt. Vermutlich, weil er sich im Herbst davor vom Rausch der Revolutionäre um den von Arbeiter- und Soldatenräten zum Ministerpräsidenten gewählten unabhängigen Sozialdemokraten Kurt Eisner hat mitreißen lassen.
Rilkes Schwabinger Wohnung, hoch oben im vierten Stock der Ainmillerstraße 34, wurde plötzlich zu einem Treffpunkt zwanzig Jahre jüngerer, aufständischer Bohemiens. Vom bekannten bayerischen Exzentriker Oskar Maria Graf, für den Rilke einen entlastenden Brief an dessen Rechtsanwalt schrieb, bis hin zum Absolventen der Kunstakademie, frischgebackenen Kommunisten und späteren stalinistischen DDR-Hardliner Alfred Kurella. Zusammen mit Fritz Klatt, der mitten im Nationalsozialismus ein schönes, eigenwillig-existenzialistisches Buch über Rilke schreiben und als halber innerer Emigrant nach Wien ziehen wird1, hatte Kurella zur Führung des linken Flügels der bürgerlichen Jugendbewegung gehört. Den nach dem Sturz der Räterepublik verfolgten Schriftsteller Ernst Toller musste Rilke abweisen. Toller zitiert Rilke in seiner Autobiographie Eine Jugend in Deutschland wörtlich: »[B]ei mir sind Sie nicht sicher, zweimal schon wurde mein Haus durchsucht. Sie hatten meine Wohnung unter den Schutz der Räterepublik gestellt. Vor zwei Tagen war die Polizei wieder da. Detektive haben beim Photographen eine Mappe gefunden, in der ihr Bild neben meinem lag. Dieser Zufall war der Anlass zu neuer Verfolgung.«
Toller hat allerdings auch geschrieben, Rilke sei »bald danach […] aus München ausgewiesen« worden2, was nicht stimmt: Rilke hat eine Einladung des legendären Zürcher Lesezirkels Hottingen, in dem auch Hugo von Hofmannsthal, Gerhart Hauptmann und Thomas Mann zu Gast waren, zum Anlass genommen, Deutschland am 11. Juni 1919 aus eigener Initiative für immer zu verlassen. Toller bleibt ihm trotzdem verpflichtet. Im September 1919 hat er Rilke »als Zeichen tiefen Dankes« seinen Sonettenkranz Gedichte der Gefangenen geschickt und geschildert, »[w]as mir das Stunden-Buch in der Haft wurde: ein Geschenk, dessen große weise Schönheit ich in immer neuer Beglücktheit empfangen«.3
*
Tatsächlich ist Rilke seit seiner Ausreise vor knapp sieben Jahren nicht mehr in Deutschland gewesen. Aber auch in der neutralen Schweiz, die besser durch den Ersten Weltkrieg gekommen ist, hat er, anfangs nur mit einer Aufenthaltserlaubnis für zehn Tage versehen, lange einen passenden Ort zum Schreiben gesucht. Von Zürich bis ins Tessin, vom Bergell bis nach Basel. Gönnerinnen und Gönner haben ihn für Wochen oder Monate da und dort mehr oder weniger exklusiv untergebracht. Erst jetzt, in seinem schon damals auch von den Einheimischen gern »Château« genannten, einfachen mittelalterlichen Herrenturm Muzot oberhalb der ländlichen Kleinstadt Sierre, ist der Dichter sesshaft geworden. Werner Reinhart, ein kunstliebender Schweizer Industrieller, hat Haus und Grund ein knappes Jahr nach Rilkes Einzug Mitte Mai 1922 für ihn gekauft. Die beiden bescheidenen Weiler Miège und Veyras, zu dem der Turm gehört, sind nah, aber das meiste, was man zum Leben braucht, muss unten in Sierre geholt werden. Und wenn er besondere Wünsche hat, kann er sich an Reinharts Cousine Nanny Wunderly-Volkart wenden, die er schon Ende 1919 kennengelernt hat und die zu seiner wichtigsten Schweizer Vertrauten geworden ist.
Rilke ist dem »kleinen Muzot« überaus dankbar. »Wie ein großes Tier« hat der Dichter »die alten Mauern« im kahlen Mondschein […] gestreichelt«, nachdem sie es ihm »gewährt haben«4, sein selbsternanntes Hauptwerk, die schon vor dem Ersten Weltkrieg im mächtigen Adria-Schloss von Marie von Thurn und Taxis begonnenen Duineser Elegien, endlich abzuschließen: »Und plötzlich in diesem mühsamen Nirgends« ging die »vielstellige Rechnung zahlenlos« auf, schreibt Rilke in der letzten fertiggestellten, nachträglich eingefügten fünften Elegie am 14. Februar 1922.5
Trotzdem hat er es an diesem Glücksort für sein Werk schon in den beiden vergangenen Wintern nicht mehr ausgehalten. Zu einsam und kalt für seine aus noch unbestimmten Gründen immer schwerer in Mitleidenschaft gezogene Gesundheit ist der alte Turm in dieser Jahreszeit. Hier dagegen, in Val-Mont, nur fünfzig Kilometer weiter westlich, kann Rilke noch Anfang Januar den Süden spüren, kann glauben, dass die Rhone durch den See ins Mittelmeer fließt.
*
Auch Mailand, wohin Rilke jetzt einen Brief richtet, ist nah. Es gibt direkte Züge durch den Simplon, am Lago Maggiore entlang. Wenn man Glück hat, dauert es von Montreux aus fünfeinhalb Stunden. Das ist damals nicht viel. Immer wieder schaut Rilke in den Indicateur, das Kursbuch, wie er Aurelia Gallarati-Scotti, an die er gerade schreibt, schon im Juli 1923 erzählt hat. Die Fahrt würde einigermaßen angenehm. Im Fahrplan ist frühmorgens sogar der Orientexpress verzeichnet, der seit dem Ende des Ersten Weltkriegs durch die Walliser Alpen zieht – auf einer neuen Route, die die »Verlierermächte« Deutschland und Österreich randständig aussehen lässt. Nur im Juli allerdings führe das Bähnlein hier oben früh genug. Sonst müsste Rilke sich eine Kutsche nehmen, um den Zug um 7:25 Uhr zu erreichen. Aber danach wäre alles ganz einfach.6
Trotzdem hat Rilke Aurelia, die junge Mailänder Herzogin, die Briefe an ihre Freunde noch immer mit dem mädchenhaften »Lella« unterzeichnet, nicht mehr gesehen, seit er sie, noch vor dem Krieg, in Venedig kennengelernt hat. Damals ist ihm eher ihre nachdenkliche, drei Jahre ältere Schwester Maria aufgefallen. Aber Lella ist es, die den Kontakt wiederaufgenommen hat, vom fremden Dichter, aber auch von Rilkes Gaben als Causeur, der sich in den Salons von Venedig zu behaupten wusste, beeindruckt.
So hat sie es Lavinia Mazzucchetti erzählt7, einerseits eine der bekanntesten italienischen Übersetzerinnen aus dem Deutschen, unter anderem zuständig für Goethe und Thomas Mann, aber auch ebenjene wichtige Mailänder Freundin, die beinahe dreißig Jahre später den Briefwechsel zwischen Lella und Rilke ins Italienische übertragen wird.
Das französische Original der Briefe liegt im Rilke-Archiv der Schweizerischen Nationalbibliothek8 und wurde, im Abgleich mit den bestehenden (Teil-)Übertragungen9, wo nötig, von mir für dieses Buch neu übersetzt. Eine kritische Ausgabe aller Briefe, mit französischem Text, deutscher Übersetzung und Kommentar wäre ein eigenes Buch.10
*
Begonnen haben die Briefe von Lella für Rilke wie eine schöne Überraschung. Es dürfte etwas über ein Jahr nach seinem einzigen Nachkriegsaufenthalt in Venedig gewesen sein, vom 10. Juni bis Mitte Juli 1920, dass ihn, schon in Muzot, ein kleines Billett ohne Datum und Anrede erreichte:
Mailand, 30 Via Manzoni
Ich weiß nicht, ob Sie sich meiner noch erinnern: Wir haben uns vor etwa einem Jahrzehnt bei meiner Tante Valmarana kennengelernt. Mit Interesse hörte ich inzwischen indirekt über Ihr Ergehen. Ich wünschte mir, dass Sie wieder einmal nach Italien zurückkehren. Sollte das der Fall sein, so denken Sie daran, wie sehr ich mich über ein Wiedersehen freuen und wie gern ich Sie meinem Mann vorstellen würde.
Lella Gallarati-Scotti
Rilke muss sich tatsächlich an Lella erinnert haben. In seiner Antwort wird er beinahe sofort persönlich: »[D]a ich nichts vergessen habe, muss ich mich beherrschen, Sie nicht mit Fragen zu überfallen, über Sie selbst, Madame, und über die Ihren: Ihre Eltern, die Contessina Maria – aber ich halte schon inne, es wäre bei Weitem zu unbescheiden.«
1920 hat Rilke die inzwischen in Mailand Verheiratete nicht gesehen. Wieder war er beinahe von Anfang an im Mezzanin von Marie Taxis untergekommen, einem typisch venezianischen Zwischengeschoss, in dem ihn nur die bis spät in die Nacht auf dem gegenüberliegenden Campo San Vio spielenden Kinder beim Arbeiten störten.
Danach wird Lella aus der Valmarana-Verwandtschaft wohl »indirekt« von Rilke gehört haben. Immerhin hat Cousine Pia dem gerade noch intensiv nach einem kreativitätsfördernden Rückzugsort suchenden Dichter angeboten, er könne in ein leerstehendes »kleines Haus« in den Euganeischen Hügeln ziehen. Es hatte Gino gehört, dem 1918 verstorbenen Bruder von Lellas Vater, den Rilke noch kennengelernt hat.
Zurück in der Schweiz, hat er die Villa Rovollón in der Nähe von Padua im Briefwechsel mit Pia schon am 28. Juli 1920 zum ersten Mal erwähnt. Da hat er das Haus noch gar nicht gesehen, aber scherzt, er werde es immer im »Horizont« behalten, auch wenn er »etwas kurzsichtig« sei. »Ich werde nicht immer gut unterscheiden können, ob es sich um ein Häuschen oder einen Stern handelt.« Trotzdem nimmt Ginos gar nicht so kleine Villa eine wichtige Stelle in Rilkes Möglichkeitsleben ein. Nach wie vor muss er seine Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz alle drei Monate erneuern, Muzot ist noch nicht gefunden, und aus Deutschland hört er nichts, was er gut finden könnte: »Nach den Nachrichten, die ich aus Deutschland erhalten habe, wird eine Arbeit wie die meine in einem übellaunigen, böswilligen Land, das entweder aus Erschöpfung oder aus Verzweiflung nur auf seine Vernichtung hinarbeitet, immer unmöglicher.«11
Zwar wird sich das Gerücht als falsch erweisen, dass alle nach dem 1. August 1914 zugezogenen Ausländer aus München weggeschickt würden und der seit Mitte Mai 1920 mit einem tschechoslowakischen Pass ausgestattete Rilke seine untervermietete Schwabinger Wohnung nicht behalten dürfe. Aber er will die Wohnung weder aufgeben, noch will er in diesem Moment in sie zurück.
Worauf sich Rilke bei den Nachrichten aus Deutschland bezieht, bleibt zunächst unklar. Am 17. August 1920 sieht er etwas deutlicher und schreibt an Pia: »Was für ein Mangel an Visionen für dieses verstörte Deutschland, das sich aus reinen Rachegelüsten, seine wahre Bestimmung vergessend, darauf vorbereitet, sich den bolschewistischen Strömungen anzuschließen, die bald ganz Europa erfassen werden.«12
Rilkes revolutionärer Impuls scheint da schon sehr abgekühlt. Im Mai 1921 fragt er dementsprechend bei Marie Taxis nach, ob sie sich Rovollón einmal stellvertretend für ihn ansehen könne. Sie kommt nicht dazu, aber spricht mit Pias Mutter, die abrät. Zu wenig Schatten gebe es dort, zu wenig Bäume, kein elektrisches Licht, und wahrscheinlich sei auch Personal schwer zu finden.13
Lella mag von all diesen Umständen nur in Umrissen wissen, aber aus irgendeinem Grund hat sie die kleine Karte riskiert und sie in München abgeben lassen. Wahrscheinlich direkt in der Ainmillerstraße. Wer die Karte dorthin transportiert hat, konnte bislang nicht festgestellt werden. Liliane von Schnitzler, eine Münchner Bekannte beider Briefpartner, von der es vermutet wurde14, war es nicht. Lella hat sie erst Monate nach Rilkes erster Antwort kennengelernt.
Auch wer Lellas Karte aus München nach Muzot weitergeleitet hat, weiß man nicht. Womöglich kam sie schlicht mit einer der gewöhnlichen Sammelsendungen, die Rosa Schmid, Rilkes österreichische Köchin, ihm in seinen Augen zu selten nachschickt. Rosa hütet die Wohnung und kümmert sich um Untermieterinnen wie Lou Andreas-Salomé. Rilke schätzt ihre Kochkünste sehr, aber die für ihn wichtige Post leidet enorm. Vermutlich aus pragmatischen Gründen. An Thankmar von Münchhausen, den Sohn einer Freundin, hat Rilke schon am 13. Dezember 1920 geschrieben: »Du Lieber, dieses arglose Ungeheuer, die Rosa, – was soll ich Dir sagen? – schickt mir Deinen Brief (des Datums 6. Oktober!) mit zwanzig anderen, die zum Teil aus dem seeligen September stammen, vor drei Tagen nach!«15
Als Rilke im November 1921 endlich sicher ist, den Winter über im Wallis bleiben zu können und es auch zu wollen, beginnt er, seine aktuellen Briefschulden zu begleichen. Gemeinsam mit der Übersetzung der Sonette Michelangelos dienen sie wohl dazu, sich warmzuschreiben, die Elegien noch einmal »anzuschleichen«.
Es wird auch Zeit. Bald zehn Jahre nach dem Rilke in Hochstimmung versetzenden Auftakt fehlt in diesem Spätherbst 1921 noch einiges vom letzten Stück Weg, das den selbstkritischen Autor in seinen eigenen Augen erst zu einem wirklich großen Dichter machen würde. Noch immer hat er die Ruhe zum Abschluss des Elegien-Zyklus nicht gefunden.
Auch Briefe nimmt Rilke sehr genau, schreibt sie nie »einfach so«. Oder, wie Carl Jacob Burckhardt es Anfang Oktober 1920 in einem Brief an Hugo von Hofmannsthal ausdrückt: »Briefe schreibt er, wie ein Goldschmied Schmuck anfertigt.«16
Nach Mailand
Château de Muzot-sur-Sierre
Valais (Suisse)
am 29. November 1921
Chère Comtesse,
durch einen glücklichen Zufall haben die Worte,
die Sie für mich in München hinterlassen haben, mich vor Kurzem
endlich hier erreicht. Ich nenne den Zufall mit
vollster Überzeugung »glücklich« – denn welche Freude ist
es für mich, mit Ihrer freundlichen Erinnerung über so
viele (und so schmerzliche) Jahre hinweg rechnen zu können.
*
Im Januar 1926 haben Lella und Rilke mittlerweile zwanzig Briefe gewechselt und sich langsam neu kennengelernt. Aber die von Lella angestrebte Lesung in Mailand oder ein persönliches Treffen in Muzot, das Rilke mehrmals vorgeschlagen hat, haben sie noch nicht zustande gebracht. Immer wieder kommt etwas dazwischen: Mal sind die kleinen Kinder der inzwischen verheirateten jungen Herzogin krank, und sie muss, etwa den für Ende Mai 1924 geplanten Besuch im Wallis, im letzten Moment per Telegramm absagen. Mal geht es Rilke nicht gut. Der als »Frühchen« geborene Dichter verfügte noch nie über eine starke Gesundheit und beschäftigt sich, ganz im Stil der damaligen Lebensreformer, seit einem Vierteljahrhundert mit der Optimierung von (Selbst-)Heilungsmethoden. »Luftbäder«, die auch in Val-Mont angeboten werden, schätzt er schon lange. Bereits vor mehr als zwanzig Jahren hat er »barbein« auf dem Strand von Viareggio getanzt und ist anschließend Ende März nackt ins frische Mittelmeer gesprungen.
Auch Rilkes nach Visavermerken verlangender neuer Pass, über den der Dichter aus dem untergegangenen Habsburgerreich froh sein kann, und die deutsche Inflation halten ihn zurück. Sie lässt die Beträge, die Rilke für den Abdruck von Gedichten und Erzählungen erhält, oft zu aufgeblasenen Winzigkeiten verkommen. Gut ist, dass er mit Geld schon öfter Glück gehabt hat: Auf Rat des Innsbrucker Zeitschriftenherausgebers Ludwig von Ficker hat ihm etwa kein anderer als der anonym bleibende Philosoph Ludwig Wittgenstein 20 000 Kronen von seinem ungeliebten Erbe abgezweigt. Was heute der Kaufkraft von etwa 40 000 Euro entspricht.
Rilke ist zwar schon lange kein erfolgloser Autor mehr, und die Vorschüsse und sonstigen Zuwendungen, die er von seinem Verleger Anton Kippenberg erhält, kommen in der Regel in Schweizer Franken. Doch ein Best- und Longseller wie Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke, Rilkes pathetische, in einer Nacht halb herbeigeträumte Vergegenwärtigung des »legendären und gewalterfüllten Schicksals eines meiner frühen Vorfahren«, wie er im August 1922 an Lella geschrieben hat, ist nicht zu erwarten. Auch Rilkes Tochter Ruth, die mit 21 Jahren Mutter geworden ist, braucht Geld. Ebenso Baladine Klossowska, Rilkes Geliebte vom Anfang der 1920er Jahre, ohne deren praktische Hilfe er Muzot, das vor seiner Ankunft länger leer stand, nicht hätte bewohnen können.
Auch wenn sich Rilke, seinem kaum veränderten Beziehungsmuster gemäß, nach der ersten Begeisterung schnell wieder von Baladine distanziert und sie nach Berlin zu ihrer Schwester abgeschoben hat, fühlt er sich verpflichtet, kümmert sich um ihre beiden Söhne eines polnischen Bühnenbildners aus Ostpreußen. So organisiert er für Baladine, Pierre und Baltusz, der ein weltberühmter Maler werden wird, Unterstützung durch die befreundete Familie Reinhart und bei Richard Weininger, dem unter anderem mit Schreibmaschinen reich gewordenen Bruder des berühmten Skandalautors Otto, der mit Geschlecht und Charakter eine Art »Bibel« jüdischen Selbsthasses und der Frauenfeindlichkeit geschrieben hat.
*
Aber was ist mit Rilke selbst? Ist er, der noch immer ungenau diagnostizierte Kranke, in seiner Klinik mit Aussicht denn am richtigen Ort?
Henri-Auguste Widmer, der Gründer von Val-Mont – und wie Sigmund Freud ein Schüler des berühmten Pariser Psychiaters Charcot –, ist so warmherzig wie geschickt. Nach einigen Jahren hat der geschäftstüchtige Sohn eines Lausanner Cafébesitzers bemerkt, dass eine Anstalt, die sich mit den Verdauungsbeschwerden des wohlhabenderen Teils der Bevölkerung beschäftigt, auf sanftere Weise dem Geist der Zeit entspricht als die Psychiatrie. Inzwischen hat er Val-Mont ganz auf Ernährungs-, Elektro-, Helio- und Physiotherapie umgestellt.
Mit Rilke persönlich beschäftigt sich allerdings Dr. Theodor Hämmerli, ein Herzspezialist und Freund von Oskar Reinhart, der durch einen Anruf vor drei Jahren über Nacht einen Platz für Rilke organisiert hat. Nun ist das Herz kein vordringliches Problem Rilkes, der eher mit dem Darm und den Nerven zu kämpfen zu haben scheint, aber Hämmerli ist es gewohnt, mit illustren Klienten umzugehen. Als zweiter Sohn eines erfolgreichen Schweizer Waffenfabrikanten hat er Medizin studiert und ist als junger Landarzt im Berner Oberland an Margot Asquith geraten, die Frau des damaligen britischen Premierministers. Die kränkelnde Lady nahm den aufgeweckten blonden jungen Mann mit nach London, wo in 10, Downing Street auch Winston Churchill und Lloyd George zu seinen Gesprächspartnern zählten. Rilke stöhnt gelegentlich über Hämmerlis nonchalante Art, sieht in ihm manchmal aber auch einen Freund, mit dem er sich über Gott und die Welt unterhalten kann. Die geheimnisvollen Beschwerden des Dichters wird Hämmerli jedoch bis drei Wochen vor Rilkes Tod für die überwiegend psychosomatischen Beschwerden eines Hypochonders halten. Dabei ist es, wie sich herausstellen wird: Leukämie, Blutkrebs.
Als Rilke an diesem 5. Januar 1926 an Lella Gallarati-Scotti schreibt, weiß er also nichts davon, dass er mit einer damals unheilbaren Krankheit nur noch auf Zeit lebt. Sein immer wieder schmerzhaft mit Bläschen und Geschwülsten entzündeter Mund besorgt ihn, aber heute ist er gutgelaunt und klar im Kopf. Bloß erschöpft fühlt er sich.
*
Zu Beginn seines Briefs tändelt der Dichter ein wenig. Er dankt für einen schönen Kalender mit alten Mailand-Stichen, der, falls er selbst es vergessen sollte, ihn immer daran erinnern werde, dass er dieses Jahr endlich wieder einmal in die Stadt kommen wolle, in der seine Briefpartnerin lebt. Außerdem erzählt er, ohne Titel zu nennen, von »schöner französischer Literatur«. Gerade gebe es eine »große Auswahl« davon, und seit er vergangenes Jahr in Paris einige der Autoren persönlich kennengelernt und bei den meisten »wechselseitige Sympathien« verspürt habe, sei sein Interesse daran »noch lebendiger« geworden.
Harmlose, allgemein gehaltene Formeln. Doch dann kommt Rilke in diesem durchgehend auf Französisch geführten Briefwechsel mit viel Enthusiasmus auf das Land der Adressatin zu sprechen:
Aber auch in Italien, was für ein Aufschwung, und das nicht nur in der Literatur, auch im öffentlichen Leben! Was für eine schöne, an den Gouverneur von Rom gerichtete Rede von Herrn Mussolini! Unter Ihren Dichtern hat man mich in Paris besonders Ungaretti bewundern gelehrt. Voilà: Da haben Sie die Themen, über die ich gern mit Ihnen sprechen würde … Und viele andere … ich unterbreche mich mit Gewalt. Der Ihre, liebe Gräfin.
Rilke17
Voilà.
Quel beau discours que celui de Monsieur Mussolini! Zuerst nur dieser schnell hingeworfene Name. Aber in den nächsten Briefen wird noch einiges folgen. Und schon jetzt stellen sich ein paar Fragen: Was bedeutet es, dass Rilke Mussolini lobt? Hat Rilkes Kehrtwende, sein postrevolutionärer »Kater«, den der Brief an Pia Valmarana schon vor mehr als fünf Jahren angezeigt hat, ihn inzwischen derart weit nach rechts geführt? Hat sich in den Jahren seither etwas verändert? Und wenn ja, was? Aber auch: Wie kommt Rilke an diese Rede? Und wie reagiert die junge Italienerin?
Lella ist dem bewunderten Dichter sehr zugewandt und wird sich nie daran stören, dass Rilke, der selbst Wert auf exakte Etikette legt, sie seit dem Beginn ihres Briefwechsels vor mehr als vier Jahren durchgehend mit Comtesse (Gräfin) anspricht, obwohl sie seit ihrer Heirat Duchessa, also Herzogin ist (und vorher eine Grafentochter, Contessina, war). Sie verwendet auch kein aufwendiges, holzfreies Briefpapier mit Wappen, wie Rilke selbst, der sich viel auf seinen bloß vage dokumentierten Adel zugutehält. Und sie unterzeichnet nach wie vor mit »Lella«, lediglich um den neuen Nachnamen ergänzt.
Ihren Briefpartner hingegen nennt sie meist schlicht cher ami, lieber Freund. Was heißt: Hier begegnen sich zwei Menschen, unabhängig von ihrem sozialen Stand.
II »Nein, lieber Rilke«. Lellas erste Entgegnung und ein zweifelhafter Kronzeuge
Schnell zu beantworten ist die Frage, warum und wie Rilke hoch über dem Genfer See an Mussolinis Rede kommen konnte: Der Duce ist prominent. Die ganze Welt interessiert sich Mitte der 1920er Jahre dafür, was in Italien, dem ersten faschistischen Staat, geschieht. So ist auch die kurze Ansprache, von der Rilke begeistert ist, in der auflagenstarken Westschweizer Tageszeitung Journal de Genêve, die Rilke regelmäßig liest, am Sonntag, den 3. Januar 1926, kommentarlos in französischer Übersetzung abgedruckt. Darin feiert Mussolini städtebauliche Erfolge seit dem »Sieg« des fascismo: neue Straßen, Schulen, Gärten, Parks. Aber seine Rede ist nicht etwa ein »grünes« Programm. Mit pompösen Worten mahnt der Duce die architektonische Bereinigung des Römer Zentrums an: »Die tausendjährigen Monumente unserer Geschichte müssen gigantisch herausragen durch ihre für sie notwendige Einsamkeit.« Was meint: Der Wille zum Protz mit der Historie zwingt zum Kahlschlag drum herum. Für die Freilegung von Sichtachsen auf Denkmäler müssen alte Wohnhäuser weichen. Auch Liebhaber nationalistischer Worthülsen werden bedient: »Rom ist heute die größte Perle im neuen Bewusstsein des sieghaften Vaterlandes.«1
Das klingt zwar unangenehm, verglichen mit anderen Ansprachen Mussolinis ist der Ton, den er hier anschlägt, sind die Forderungen, die er stellt, aber eher zahm. Ginge es bei der Diskussion um Rilkes politische Überzeugungen nur um diese Rede – könnte man da, trotz des auffälligen Lobs für den aufgeblasenen italienischen Potentaten, nicht schon wieder »Entwarnung« geben? Ist »Mussolini« in diesen Zeilen nicht vor allem ein sofort vergessenes Reizwort? Geht es nicht schon im nächsten Moment mit Giuseppe Ungaretti weiter, einem noch heute anerkannten Großmeister der italienischen Lyrik, dessen Frühwerk Ingeborg Bachmann so eindrucksvoll ins Deutsche übertragen hat?
*
Eine erste Schwierigkeit mit dieser Haltung ist, dass Ungaretti ein überzeugter Mussolini-Anhänger der ersten Stunde und politisch alles andere als unproblematisch ist. Von 1912 bis 1915 war er Paris-Korrespondent für Mussolinis Zeitung Il popolo d’Italia, kannte Mussolini seit 1915 persönlich und bleibt über zwanzig Jahre, bis zum Ende von Mussolinis Herrschaft, eifrig auf seiner Seite.2
Bezeichnend für Ungarettis Haltung ist etwa ein Brief an den Duce vom 3. Januar 1926, also ausgerechnet unmittelbar nach dessen Rede an den Gouverneur Roms und zwei Tage bevor Rilke sein erstes Mussolini-Lob für Lella verfasst. Carissimo Duce, schreibt Ungaretti, von »bürgerlicher« Literatur, wie sie (in der politisch sich gerade noch wehrenden, einst liberalen) Tageszeitung Corriere della Sera gepriesen werde, habe man »mehr als genug«. Es brauche »Mut und Konsequenz«, auch in »literarischen Angelegenheiten«. D’Annunzio sei »allen heilig« und »der Beste«, aber als nächsten (und einzigen sonst) nennt Ungaretti – sich selbst: Tra i giovani poeti c’è ilsottoscritto – »Unter den jungen Dichtern nenne ich den Unterzeichner.«
Mussolini »treu«, wie er seit langem sei, hoffe er auf dessen Hilfe, damit er »seine Pflicht als Dichter leisten« könne. Sono il vostro devotissimo milite. – »Ich bin Euer ergebenster Soldat.«3
Was Ungaretti darunter versteht, sieht man, als eine der besten zeitgenössischen Analysen der ersten Zeit des Faschismus, The Fascist Dictatorship in Italy (1922–1926) des Historikers und Emigranten Gaetano Salvemini, in den USA schon 1927 erschienen, im Herbst 1930 in Frankreich herauskommen soll. Als eng mit Paris vernetzter Propagandist des Regimes sieht sich Ungaretti zum Eingreifen verpflichtet. Am 7. Oktober 1930 schreibt er an Jean Paulhan: c’est en verité de la bave. Avec des documents volés par des traitres. – »Das ist in Wahrheit nichts als Gesabber. Mit von Verrätern gestohlenen Dokumenten.« Ungaretti schlägt Paulhan sogar vor, er könnte selbst schnell nach Paris kommen, »um die Auslieferung zu verhindern«.4
Von solchen Sachen wollte Ungaretti, der sich später gern als eine Art sympathischer Seebär in Rente gab, nach dem Sturz des Duce natürlich nichts mehr wissen. Er habe in der Zeit des Faschismus nur Künstler und Schriftsteller gekannt, habe sich immer für Juden und andere Verfolgte eingesetzt usw. In Wahrheit hat er versucht, direkte »Konkurrenten« wie den Antifaschisten und späteren Nobelpreisträger Eugenio Montale zurückzudrängen. Auch bei der Auswahl italienischer Autoren für Zeitschriften wie Paul Valérys Commerce, in der auch Rilke veröffentlichte. Da Rilke mit der Geldgeberin der Zeitschrift 1925 in Paris viel zu tun hatte, wie seine Notizbücher dieser Zeit vermerken5, wäre es durchaus möglich, dass er, der in dieser Zeit drei bis vier Termine täglich wahrnahm, Ungaretti persönlich kennengelernt hat, aber dessen Erwähnung Lella gegenüber klingt nicht danach. Vielmehr bezog sich Rilke vermutlich allein auf Gespräche mit Dritten und auf seine Ausgabe der im November 1922 erschienenen zweiten Auflage von Il porto sepolto, Ungarettis tatsächlichem literarischem Meisterwerk, die im Schweizerischen Rilke-Archiv in Bern aufbewahrt wird.6
Es ziert sie eine an Ungaretti gerichtete Widmung des im Oktober 1922 eben erst zum Regierungschef ernannten Duce. Er habe, wie Mussolini Ungaretti wissen ließ, im Augenblick keine Zeit, das Buch zu lesen. Das hinderte ihn nicht daran, den langjährigen Unterstützer überschwänglich zu loben: Ungarettis Poesie sei entstanden aus »Empfindsamkeit, Qual, Forschung, Leidenschaft und Geheimnis«.7 Eine etwas allgemeine, aber tatsächlich »unpolitische« Würdigung. Auch Ungarettis frühe Gedichte wirken so – in all ihrem kargen Pathos der Stärke, des soldatischen Überstehens. Rilkes Besitz der Ausgabe mit Mussolini-Widmung besagt für sich genommen tatsächlich nicht viel. Und was genau Rilke über Ungaretti gehört hat, ist nicht bekannt.8
*
Das Problem bei »Rilke und Mussolini« ist ein anderes: Es geht um deutlich mehr als ein, zwei bloße Namensnennungen. Was im Briefwechsel mit Lella zur Sprache kommt, weil Rilke mit seinem enthusiastischen Statement für den italienischen Diktator Pech hat. Es kommt bei der jungen Herzogin nicht so selbstverständlich gut an, wie er gedacht haben mag. Rilke muss sich verteidigen und gibt dabei einiges von seinen politischen Ansichten preis. Lella ihrerseits bleibt, ganz im gebildeten Diskurs der Zeit, in ihrer Antwort höflich, wird aber, nach einer kleinen Einleitung, durchaus direkt. Datiert auf den 10. Januar 1926 schreibt sie:
Am Ende Ihres Briefs berühren Sie eine tiefe Wunde, die das Italien der letzten Jahre spaltet. Nein, lieber Rilke, ich bin keine Bewunderin von Herrn Mussolini. Ich verstehe gut, dass einige seiner Reden den besten Eindruck machen können. Im letzten Frühling habe ich ihn im Senat übrigens eine Debatte über ein Militärgesetz auf so brillante Weise gewinnen hören, wie ich es mir nie hätte träumen lassen.
Man kann ihm auch andere Meriten nicht bestreiten. Aber es würde zu lange dauern, Ihnen all die Gründe auseinanderzusetzen, die es mir, von Anfang an, unmöglich gemacht haben, irgendeine Bindung an den Faschismus zu entwickeln; ich sage Ihnen hier nur, dass ich für meinen Teil Gewalt verabscheue, und ich ertrage sie noch weniger, wenn sie zu meinen Gunsten oder zugunsten meiner sozialen Klasse eingesetzt wird, als wenn sie von meinen Feinden ausgeübt würde. Und zweitens denke ich: Die politische Ordnung eines Landes ist nur dann gewährleistet, wenn die Freiheit darin auch gestattet, eine tatsächliche Idee davon zu bekommen, was das Land denkt und will – wenigstens ein Minimum an Freiheit –, übrigens das erste Recht, das uns die Zivilisation gebracht hat.
Das ist eine in ihrer freundlichen Klarheit und differenzierten Entschiedenheit beeindruckende persönliche Grundsatzerklärung. So kommt neben der Frage, wie Rilke zu seinem Mussolini-Lob gelangen konnte und ob das in seinem literarischen Werk zu sehen ist, schon hier Neugier auf: Wer ist diese selbstbewusste junge Frau, die den berühmten Dichter schätzt, ihm aber trotzdem ohne jede Schüchternheit entgegentritt und damit diesem Briefwechsel erst seine besondere Dynamik verschafft? Wie kommt sie zu ihrer Haltung? Was verbindet die beiden? Was trennt sie?
III »Ihnen gegenüber werde ich immer aufrichtig sein«. Rilke lobt »die wahren Diktatoren« und eine »gesunde, sichere Gewalt«. Der Brief vom 17. Januar 1926
Doch zuerst: Wie nimmt Rilke Lellas Entgegnung auf, die seinem Bild vom faschistischen Italien klar widerspricht? Womöglich mit der aus anderen Briefwechseln bekannten Anschmiegsamkeit, die ihn nicht selten kleine Konversationspirouetten drehen, sich entschuldigen oder von etwas anderem sprechen lässt, wenn er bemerkt, dass er bei seinen Briefpartnerinnen und -partnern auf gegensätzliche Ansichten, gar Widerstand stößt?
Rilkes Antwort vom 17. Januar 1926 sieht anfangs ganz danach aus. Nach wie vor in Val-Mont, spricht er zunächst von seiner noch unbestimmten Krankheit, von der speziellen Erfahrung damit. Gerade habe man die Behandlung verstärkt, so dass »selbst heute, an einem halben Ruhetag, mein Körper nichts zu sein scheint als ein Tummelplatz verschiedenster Reaktionen, die sich alle in mir überschneiden und mich mit einer angstvollen, unbestimmten Müdigkeit erfüllen«.
Rilke wirkt in seiner Selbstdarstellung hier in einiger Hinsicht wie ein »neuer« Malte Laurids Brigge, durch dessen Körper nicht mehr die Pariser »Elektrischen« rumpeln, der sich aber ein weiteres Mal als ein unter einer disparaten Wirklichkeit leidendes Opfer erfährt. Eine Wirklichkeit, die hier nicht mehr vor allem von außen kommt, sondern deutlicher aus ihm selbst. Aber sie peinigt ihn nach wie vor. Dementsprechend möchte Rilke »von meinem Recht als Patient Gebrauch machen und die unendliche Wohltat Ihrer Zeilen annehmen, ohne auch nur zu versuchen, Ihnen etwa das aufs Papier zu bringen, was sich in meinem Innersten bewegt«.
Das hieße wohl, Lellas Statement zu akzeptieren und nicht mehr von diesem Thema zu sprechen. Als Leser stellt man sich auf einen eher kurzen, formalen Brief ein, der jede weitere politische Diskussion vermeidet. Stattdessen wird es das bisher umfangreichste Schreiben, das Rilke Lella geschickt hat, und nach zwei kleinen, aber aussagekräftigen Umwegen folgt eine ausführliche Antwort auf ihre Mussolini-Kritik.
Der erste Umweg heißt Rabindranath Tagore. Lella hat den indischen Literaturnobelpreisträger von 1913, den sie seit dem vorigen Jahr, als er Mailand auf private Einladung besucht hat, persönlich kennt, in ihrem Brief vom 10. Januar erwähnt: »Ich habe ihn immer sehr bewundert. Er hinterließ bei mir den Eindruck großer Aufrichtigkeit, so erhaben war er über jegliche Schmeichelei, so groß war er als Dichter. Ich möchte sehr gern wissen, ob Sie ihn auch so schätzen?«
Daraufhin setzt Rilke seinen Ruf als geschickter Fürstinnenschmeichler erstaunlich entschlossen aufs Spiel, indem er sein literarisches Urteil nicht hinter den Formeln versteckt, mit denen er höflicherweise beginnt:
Nun aber zu Tagore: Meine liebe, teure Freundin, um ganz aufrichtig zu sein (und Ihnen gegenüber werde ich es immer bleiben), ich habe ihn anfangs einmal geliebt, als – es ist schon manches Jahr her – Gide mir seine feinfühlige Übersetzung von Gitanjali schickte; danach habe ich mich von Werk zu Werk immer mehr von diesem Dichter entfernt (den ich allerdings nur auf Französisch gelesen habe, Englisch kann ich längst nicht mehr). Sie werden sich gewiss wundern, wenn ich Ihnen sage, dass ich mich dieser bewusst »poetischen« Poesie unendlich entgegengesetzt empfinde, einer Poesie, die schon durch ihr Programm vorgibt, besonders gut und »human« zu sein.
»Unendlich entgegengesetzt« / »infiniment opposé«. Gegen Lellas Tagore-Bewunderung gehalten ist Rilkes ostentative Ehrlichkeit (»Ihnen gegenüber«) natürlich eine Provokation – aber auch bemerkenswert. Rilke nimmt hier den klaren, direkten Ton auf, den Lella mit ihrer Erwiderung »Nein, lieber Rilke« angeschlagen hat – und gibt ihn etwas schärfer und abfälliger gegen den von Lella bewunderten Tagore zurück.
Rilke dürfte von Lellas Antwort überrascht gewesen sein. Aufrichtigkeit war in einer derartigen schriftlichen Konversation der kulturinteressierten höheren Stände eher selten. Erst recht, wenn man sich lange, in diesem Fall seit vierzehn Jahren, nicht mehr gesehen hatte. Ich werde, mag Rilke sich da insgeheim gedacht haben, mit gleicher Münze zurückgeben. Bei aller trotzdem eingehaltenen Verpflichtung gegenüber Konventionen: Genau daraus ergibt sich eine ganz besondere Kommunikation, ein für Rilke-Briefwechsel ungewöhnlicher Einblick in seine hier prononciert formulierten Gedanken.
Pikant ist: Ausgerechnet das Thema Tagore ist für Lella ebenfalls mit Mussolini verbunden. Die private Mailänder Einladung an ihn, für die Lellas Mann Tommaso Gallarati-Scotti, auf den wir noch genauer zu sprechen kommen, mitverantwortlich ist, war gegen die Kulturpolitik des Duce durchgesetzt worden. Das belegt ein Brief Tommasos an den Mailänder Orientalisten und Sammler Guido Cagnola. Cagnola hatte zuerst noch beim Bildungsministerium um finanzielle Unterstützung des Tagore-Besuchs ersucht. Jetzt schreibt ihm Tommaso: »Lieber Freund, ich bin mit Ihnen toto corde für die Einladung an Rabindranath Tagore. Ich habe Mitleid mit dem Bildungsministerium, das sich aus Angst weigern muss, einen großen Dichter offiziell in Italien zu empfangen. Diktatoren hatten schon immer Angst vor Dichtern.«1
Wie Lella lässt auch ihr Mann, der Cagnola schon länger kennt und daher offen sein kann, keinen Zweifel an seiner Einschätzung des Regimes. Und tatsächlich wird die faschistische Presse den gefeierten Mailänder Auftritt Tagores, sein Eintreten für eine Philosophie der Liebe, kritisieren.
Bei Tagores zweitem Besuch wird es dann allerdings dramatisch anders zugehen. Im Juni 1926 wird Carlo Formichi, ein faschismusnaher Orientalist, in Rom nach Unterstützung fragen, und Mussolini, dem Tagore bislang gleichgültig gewesen sein muss, wird die günstige Gelegenheit erkennen und den anfangs ahnungslosen Schriftsteller als Propagandainstrument missbrauchen. Lella und Tommaso werden unter denen sein, die Tagore zu schützen versuchen. Tagore wird später erzählen, dass Tommaso in Turin zu ihm an den Zug gekommen sei, um ihn zu warnen.2
Aber all das ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschehen.
Vorerst erwähnt Rilke, als zweiten Umweg, einen weiteren Autor, den Lella in ihrem Brief genannt hat, und auch ihn kritisiert er: »Es ist genau dasselbe, was mich von einem Schriftsteller wie Romain Rolland trennt, den ich persönlich durchaus schätze, ohne jedoch im Geringsten seine Absichten gutzuheißen, und mögen sie noch so edel sein.« Kunst, so Rilkes Statement zu Tagore wie zu Rolland, hat nichts mit Moral zu tun. Damit stützt Rilke natürlich seinen Ruf als »reiner«, bedingungsloser, nur der Kunst verpflichteter Ästhet. Aber es fällt auf, dass er auch die »Absichten« Rollands nicht billigt. Er hätte schließlich ohne Not etwa schreiben können: »den ich persönlich durchaus schätze und an dessen Absichten ich nichts Tadelnswertes bemerke, aber …« Rilke macht es anders. Ganz eindeutig lehnt er den pazifistischen Humanismus des Nobelpreisträgers von 1915 hier grundsätzlich ab – egal, ob Rolland ihn in der Kunst oder im politisch-sozialen Leben zeigt.
Was schon deswegen erstaunlich ist, weil Rilke gerade noch davon profitiert hat, dass Rolland gemeinsam mit Stefan Zweig vor Jahren dafür gesorgt hat, dass André Gide und Jacques Copeau während des Ersten Weltkriegs zwei Koffer mit Manuskripten und Briefen Rilkes bei dessen Concierge in der Rue Campagne première abgeholt haben, um sie vor der Beschlagnahme zu schützen. Gide brachte die Koffer im Keller der Éditions Gallimard unter, und Rilke konnte sie bei seinem Paris-Aufenthalt 1925 wieder in Empfang nehmen.3
So aber macht die Passage zu Rolland, der seit 1922 in unmittelbarer Nähe von Val-Mont in Villeneuve am Genfer See wohnt, wo er Tagore nach seinem zweiten Italien-Aufenthalt weiter über das Italien Mussolinis aufklären wird4, besonders deutlich, wie sehr sich die politische Haltung Rilkes seit dem Ende des Ersten Weltkriegs verändert hat.
Nachdem Rilke damals von seiner ersten Kriegsbegeisterung abgefallen ist (vergleiche auch Kapitel XIII), folgt er im Januar 1915 einer Initiative der Schriftstellerin Annette Kolb, die Geld für eine friedensstiftend-vermittelnde europäische Zeitschrift sucht, die schließlich Internationale Rundschau heißen wird. Der mit Kolb befreundete Rilke schreibt in dieser Angelegenheit am 18. Januar 1915 an Marianne Mitford (geborene Friedländer-Fuld) und deutet dabei an, wer seine Mitarbeit schon zugesagt habe: »[E]s hat hier, in München, kürzlich eine Versammlung von geistig-lebenden Menschen stattgefunden, die die Gründung einer internationalen Zeitschrift beschlossen haben: Romain Rolland, Shaw, van Eeden und andere ›feindliche‹ Ausländer sind bereits für die Theilnahme gewonnen worden.«
Der Ton, den Rilke im Brief an Mitford anschlägt, ist also durchaus »rollandfreundlich« und geradezu aktivistisch: »Ich sprach Annette vorgestern und sie erzählte mir von einer Unternehmung, von der ich Ihnen gleich schreiben möchte, denn sie will in dieser Richtung wirken und das geht uns alle unbedingt an.« Denn gemäß »unserem seelischem Organismus« stünden »wir« ähnlich »zwischen den Völkern« wie Annette Kolb mit ihrer französischen Mutter und ihrem deutschen Vater auf »organische« Weise.5
Gleich im ersten Abschnitt nach den gewandelten Ansichten zu Rolland macht Rilke im Briefwechsel mit Lella zehn Jahre später eine markante, ganz grundsätzlich antipolitische Aussage:
Was die Politik angeht, so stehe ich ihr dermaßen fern und mich so außerstande, mir ihre Bewegungen und Gegenbewegungen zu erklären, dass es lächerlich wäre, wenn ich mich über irgendein politisches Ereignis äußerte […] Aber ich nehme doch an, dass auch hier rein menschliche, gewollt humane Absichten nicht viel wert sind. Eine Poesie mit dem Ziel zu trösten, zu helfen oder irgendwelche noblen Überzeugungen zu unterstützen wäre bestenfalls eine rührende Schwachheit.
Poesie soll ohne erkennbare Absicht bleiben. Ansonsten wirkt sie schnell bemüht. So weit kann man Rilke problemlos folgen. Aber warum sollen in der Politik »gewollt humane Absichten«, volontairement humaines, »nicht viel wert« sein? Ist die Politik eines Einzelnen oder einer Gruppe nicht in den meisten Fällen mindestens auch überzeugungsgeleitet und Folge eines politischen Willens? Stehen sich da nicht des Öfteren »gewollt humane« und, beispielsweise, rein machtorientierte, opportunistische und manchmal auch verbrecherische Positionen gegenüber? Rilkes Aussage wirkt bereits hier weniger kokett naiv als ruppig machiavellistisch.
Anders als man vielleicht annehmen könnte, ist die überraschende Übertragung von ästhetischen auf politische Abneigungen und Präferenzen auch kein undurchdachter Ausrutscher Rilkes. Im nächsten Abschnitt des Briefs an Lella verlängert er die Parallele zwischen Kunst und Politik und offenbart dabei noch ganz andere gedankliche Voraussetzungen:
Das Entscheidende ist nicht die gutherzige oder wohlmeinende Absicht, sondern der Gehorsam gegenüber einem autoritären Diktat, das weder das Gute noch das Böse anstrebt (wovon wir so wenig wissen), sondern das uns einfach aufträgt, unsere Gefühle, unsere Ideen und das gesamte Aufwallen unseres Wesens einer höheren Ordnung zu unterstellen, die uns solchergestalt übermächtigt, dass wir sie nie werden begreifen können […].
Wieder ist der erste Halbsatz durchaus nachvollziehbar, aber mit obéissance à une dictée autoritaire formuliert Rilke eine diesmal krude aus dem Bereich autoritärer Politik und Erziehung auf das eigene Schreiben übertragene Theorie künstlerischer Produktion.
Anschließend entfernt sich Rilke noch weiter von seiner herablassend geäußerten, generellen Unzuständigkeitserklärung für politische Ereignisse, indem er den Grenzbereich zwischen Literatur und Politik verlässt und sich ganz auf das Feld der Politik begibt:
Freiheit ist zu wenig; selbst wenn man sie maßvoll und gerecht anwendet, lässt sie einen in der Mitte des Weges zurück, im engen Felde der Vernunft. Ist es nicht dies, was die Diktatoren, die wahren Diktatoren, zeitweilig erkannten, indem sie eine heilsame und sichere Gewalt ausübten?
Une salutaire et sûre violence – man muss wohl fragen: Gibt es überhaupt Diktatoren, die sich nicht als »wahr« und ihre Gewalt nicht als »heilsam« empfinden und sie deswegen nicht »sicher« auszuüben glauben?
Dann begründet Rilke, irrationalistisch gegen die Vernunft argumentierend, seine Akzeptanz der Gewalt »wahrer Diktatoren«, der véritables dictateurs, die er gleich darauf in eine »gewisse Kraft« verwandelt:
Man tut der Natur unrecht, wenn man sie für langsam und nachsichtig hält; wie viel Gewalt, ja Grausamkeit spielt sich in ihrem unschuldigen Schoße ab; man sieht sich gezwungen zu glauben, dass eine gewisse Kraft, die zur Herstellung der Ordnung gebraucht wird, sei es in der Kunst oder im Leben, etwas von dieser tiefen Unschuld besitzt, die wir der Natur zuschreiben, selbst da, wo sie sich mit Schroffheit durchsetzt.
Hier liegt eine weitere markante Zwischenstation dieses ungewöhnlichen schriftlichen Gesprächs. Rilkes Letztbegründung seiner Ansichten erfolgt hier über einen konservativen Naturbegriff. So kann er auch der brutalen Gewalt eines Mussolini »Unschuld«, innocence, zugestehen. Anlässlich der Sonette an Orpheus, die Rilke vier Jahre zuvor geschrieben hat, wird im nächsten Kapitel sichtbar werden, wie wichtig solche geschichtsphilosophischen Ausführungen auch für sein literarisches Werk sind.
Das Interessante im Briefwechsel ist: Der Sinn von Herrschaft und Unterordnung ist für Rilke klar, jener der Freiheit weniger:
Mir scheint, dass die besten jungen Menschen, wie ich sie in Paris sah, und auch in Venedig gekannt habe (jene großartigen Jungen, von denen so viele im Krieg geblieben sind), nicht so sehr die Freiheit nötig haben als vielmehr einen stolzen und freiwilligen Gehorsam, der sie vereinigt und in jedem von ihnen das Bewusstsein ihrer Kraft und Fähigkeiten entwickelt.
Rilke sieht das Bild einer strengen Ordnung vor sich, das mit soldatischem Marschieren in Reih und Glied nicht schlecht erfüllt sein könnte. Wen genau er in Paris und Venedig im Horizont solcher Visionen betrachtet respektive in Erinnerung hat, wird nicht ganz klar. In Venedig könnten dazu die Aufmärsche der militanten Kriegsheimkehrer, der nach wie vor stolzen, aber auch gewaltinteressierten Eliteformationen der »Arditi« passen,6 in Frankreich die ebenfalls rechten paramilitärischen Gruppen, die sich ausgerechnet 1925, während Rilkes letztem, sieben Monate währenden Paris-Aufenthalt, aus der Action française