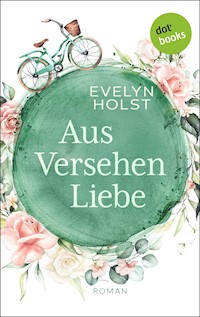Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Haynstraßen-Saga
- Sprache: Deutsch
Die Geschichten der fünf Frauen in der Haynstraße gehen weiter … »Immer wenn das Leben noch schwerer wurde als sowieso schon schwer, wenn wieder neue Gesetze und Verbote verkündet wurden, dann war Tonis Dachstube eine beliebte Zuflucht. Die Wärmflasche an kalten, ungemütlichen Tagen.« 1934: Für die Frauen aus der Haynstraße 7 in Hamburg-Eppendorf sind ihre Kaffee-Treffen in der Dachstube ein Ort der Zuflucht, während der Alltag stetig mehr Risse zeigt. So etwa muss die jüdische Arztgattin Gitte Horwitz schweren Herzens ihrem langjährigen Dienstmädchen kündigen – nun bleibt Gitte allein mit dem Geheimnis, dass ihre Tochter Lea in Wahrheit gar nicht ihr leibliches Kind ist … Die junge Witwe Lily Bromberg hingegen lebt ganz für die lichten, freien Momente im Leben – aber das scheint zunehmend unmöglich, denn sie hat sich in einen Mann der SA verliebt … Ihre Nachbarin Traudel Kappelmann kennt den gefährlichen Balanceakt zwischen zwei Welten nur zu gut: Wie lange werden ihre jüdischen Nachbarinnen noch darüber hinwegsehen können, dass ihr Mann für das neue Regime brennt? Und was bedeutet das für ihren geliebten Sohn, den ein tiefes Band mit Gittes Tochter verbindet? Der zweite Roman in der Hamburger Stadthaus-Saga, die ebenso berührt wie aufrüttelt. Nahbar und zutiefst emotional verwebt die Autorin die Schicksale mehrerer Familien und Generationen – für Fans von Ulrike Schweikert, Wolf Serno und Marion Kummerow.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
1934: Für die Frauen aus der Haynstraße 7 in Hamburg-Eppendorf sind ihre Kaffee-Treffen in der Dachstube ein Ort der Zuflucht, während der Alltag stetig mehr Risse zeigt. So etwa muss die jüdische Arztgattin Gitte Horwitz schweren Herzens ihrem langjährigen Dienstmädchen kündigen – nun bleibt Gitte allein mit dem Geheimnis, dass ihre Tochter Lea in Wahrheit gar nicht ihr leibliches Kind ist … Die junge Witwe Lily Bromberg hingegen lebt ganz für die lichten, freien Momente im Leben – aber das scheint zunehmend unmöglich, denn sie hat sich in einen Mann der SA verliebt … Ihre Nachbarin Traudel Kappelmann kennt den gefährlichen Balanceakt zwischen zwei Welten nur zu gut: Wie lange werden ihre jüdischen Nachbarinnen noch darüber hinwegsehen können, dass ihr Mann für das neue Regime brennt? Und was bedeutet das für ihren geliebten Sohn, den ein tiefes Band mit Gittes Tochter verbindet?
Originalausgabe November 2025
Copyright © der Originalausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Sarah Schroepf
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock /shutterstock AI
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (rb)
ISBN 978-3-69076-108-6
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das jedoch vor dem Hintergrund des Dritten Reichs spielt – und als solches Dokument seiner Zeit von uns veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als diskriminierend und gefährlich verstehen. Dies spiegelt weder die Überzeugungen des Verlags noch der Autorin wider. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die Sie als belastend oder triggernd empfinden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected] .
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Evelyn Holst
Das Haus in der Haynstraße Jahre des Schicksals
Roman
Kapitel 1
Hamburg, Eppendorf, Haynstraße, 1934
»Sie haben den Röhm erschossen!«
Elkan Horwitz knallte die Morgenzeitung mit Schwung auf den Esstisch, Gitte zuckte zusammen, sie hatte ihren Mann nicht kommen hören, »und 950 seiner Männer. Auch den Schleicher und seine Frau.«
»Den SA-Mann?« Sie klang ungläubig. »Mehr Nazi war doch gar nicht möglich, was hat er denn verbrochen?«
»Ich glaube, er wollte eine nationalsozialistische Militärdiktatur«, sagte Elkan, »eine radikale, soziale Umgestaltung.«
»Noch radikaler als jetzt schon?«, fragte Gitte nach. »Wollte er Hitler stürzen?«
»Ich glaube, genau das hat Hitler wohl befürchtet. ›Den jetzt entfesselten Strom der Revolution in das sichere Bett der Evolution weiterführen‹, so ähnlich hat Röhm sich ja ausgedrückt. Röhm und seine Männer wollten also nicht, dass die Revolution auf halbem Wege einschläft. Dass die Gunst der Stunde sozusagen verschlafen wird.«
Elkan griff zum Brotkorb, nahm eine Scheibe heraus und biss hinein. Ohne Butter, seine leichte Magenschleimhautentzündung machte sich wieder bemerkbar, sie vertrug einfach nicht, dass die Zeiten immer düsterer und mordlustiger wurden. Er nachts wach lag und grübelte und nach wenigen Stunden Schlaf wie gerädert aufwachte. Ob trocken Brot da helfen würde?
»Vielleicht war dieser Röhm-Putsch ja das schreckliche Finale, das Ende mit Schrecken«, meinte er, »und wir haben das Schlimmste überstanden, und es bleibt uns ein Schrecken ohne Ende erspart.«
Und wenn nicht, dann müssen wir dieses Land verlassen, dachte er, diese Stadt, in der ich aufgewachsen bin und die ich so liebe, diese Wohnung, in der meine Tochter und meine Enkelin geboren sind. Alles, was mir lieb und teuer ist.
»Elkan, hörst du mir zu?«
»Entschuldigung, ich war in Gedanken, du sagtest …«
»Es gab ja immer mal wieder diese Gerüchte, dass dieser Röhm …
also … mit Frauen nicht viel anfangen konnte«, sagte Gitte, ihr war das Thema unangenehm.
»Ja, er war wohl homosexuell, aber ob ihm das letztlich das Genick gebrochen hat, wer weiß das schon? Über Hitlers erotische Vorlieben wird ja auch allerhand gemutmaßt. Er soll ein Verhältnis mit seiner Nichte Geli Raubal gehabt haben. Auch nicht die feine, arische Art, oder?«
»Ich will nichts hören«, Gitte hielt sich die Ohren zu.
»Aber du hast doch mit dem Thema angefan…« Elkan brach ab, eigentlich mochte er es, wenn seine Liebste hin und wieder etwas etepetete war.
»Du hast recht, das ist wirklich kein Thema für den Frühstückstisch«, Elkan griff nach ihrer Hand und drückte sie.
»Was immer passiert, wir haben uns«, sagte er leise, hob ihre Hand hoch und küsste sie, »meinst du, Margarine ist erlaubt?«
Die Tür wurde aufgerissen, Lea stürmte herein. Alles an ihr wehte. Die blonden Haare, die Bluse aus dem Rock, Gitte hatte es aufgegeben, sie zur Schule zu schicken, in dem, was sie unter adretter Bekleidung verstand. Lea trug ihre Sachen mit einer Lebendigkeit, die adrett nicht möglich machte. Bei keinem anderen Hausbewohner hatte Toni so viel zu stopfen und zu flicken wie bei Lea Horwitz. Die sich jetzt gruß- und auch weiterhin wortlos an den Tisch setzte. Elkan und Gitte wechselten einen »Was ist denn jetzt schon wieder los?«-Blick, Gitte zuckte die Schultern. Frühe Backfischallüren, dagegen war kein Kraut gewachsen.
»Guten Morgen, Lea«, Elkan sah sie auffordernd an, »wäre schön, wenn du meinen morgendlichen Gruß erwidertest. Doch offensichtlich bist du noch nicht ganz wach. Hast du denn gut geschlafen?«
Lea grunzte. Normalerweise war sie morgens eine fröhliche Lerche. Der Grund für ihre schlechte Laune konnte nur einer sein.
Elkan und Gitte wechselten einen besorgten Blick.
»Was ist los, mien Seuten?«, fragte Elkan. »Habt ihr euch gezankt?«
»Wenn du Adolf Kappelmann meinst, diesen Blödian, mit dem ich nie wieder ein einziges Wort reden werde, dann ja, haben wir.«
Adolf. Kein Dolfie mehr. Elkan und Gitte sahen sich an. »Darf man fragen, was passiert ist?«, wollte Gitte wissen.
Lea schwieg, sie suchte nach Worten, etwas, das sie sonst nie nötig hatte. Aber so tief saß ihre Enttäuschung, dass es ihr die Sprache verschlagen hatte.
»Warum darf ich nicht zum BDM?«, fragte sie schließlich. »Ich bin zwölf und ein deutsches Mädel, aber Adolf sagt, die wollen mich nicht.«
Die Erwachsenen schwiegen.
Die Zeiten, sie waren so mühsam geworden. So voller Zwietracht, Zwang und Unerklärlichkeiten. Wie ein Halsband, das sich langsam zuzog. Denn wie etwas erklären, das man selbst für unerklärlich hielt?
»Was willst du denn beim Bund Deutscher Mädel?« Gitte legte so viel Skepsis in ihre Frage, wie sie aufbringen konnte, »die sind doch viel zu langweilig für dich. Sportlich bist du doch viel besser als alle Mädels zusammen. Weißt du was? Wir melden dich beim jüdischen Ruderverein an, die haben einen Liegeplatz in der Alten Rabenstraße, da kannst du mit deinem neuen Rad ganz bequem hinradeln. Was sagst du dazu?«
»Wenn die dich nicht wollen, dann willst du sie auch nicht«, ergänzte Elkan, »das ist eine Sache des Stolzes und du bist ein stolzes Mädel, das bist du doch, oder?«
Lea nickte zögerlich.
»Aber warum?«, wollte sie trotzdem wissen. »Warum wollen die mich nicht? Ich hab denen doch überhaupt nichts getan.«
Elkan und Gitte tauschten einen ratlosen Blick. Immer mehr Warums, auf die es keine Antwort gab. Nur Beschwichtigungen und Halbwahrheiten.
»Weil die Menschen im Augenblick ein bisschen verwirrt sind«, Elkan wartete auf das angedeutete Nicken seiner Ehefrau, bevor er fortfuhr: »Du weißt ja, dass wir einen Krieg hinter uns haben, du hast ihn glücklicherweise nicht miterlebt, aber er hat viel kaputt gemacht und dafür hat uns die Welt bestraft. Weißt du, was der Versailler Vertrag ist?«
»Elkan, ich bitte dich, sie ist zwölf«, Gitte schüttelte den Kopf, »so was lernen sie noch nicht in der Schule.«
»Sollten sie aber«, erwiderte Elkan, »weil genau dieser Vertrag vieles erklärt, für das es sonst keine Erklärung gäbe.«
»Dieser Versch… Versi…«, stammelte Lea und gab auf.
»Versailler«, korrigierte Gitte, »Versailler, französisch, weil er in Versailles unterschrieben wurde. Und diesen Vertrag finden die meisten Deutschen sehr ungerecht.«
»Warum haben sie ihn dann unterschrieben?«, wollte Lea wissen. »Ganz schön dumm.«
»Weil uns nichts anderes übrigblieb, weil wir nämlich den Krieg angezettelt und dann verloren haben«, sagte Elkan, »der Versailler Vertrag war unsere Strafe. Und zwar eine gerechte, wie ich finde.«
Gitte zog scharf die Luft ein. Gefährliches Terrain, selbst im Familienkreis, auf das sich ihr Mann da vorwagte. Lea war eine kleine Plaudertasche, da mussten sie sehr vorsichtig sein. Eine unbedachte Bemerkung, die an die falschen Ohren geriet, an Adolf, an Traudel, an ihren Mann … und Elkan konnte verhaftet werden.
»Da gehen die Meinungen sehr auseinander, das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen.«
Ein Blick von Gitte und ihr Mann verstummte.
»Aber Vati, warum haben wir diesen Krieg denn überhaupt angefangen? Kriege sind doch immer Quatsch, sagt jedenfalls Tante Toni immer.«
Dr. Elkan Horwitz war viele Jahre ein kaisertreuer Patriot gewesen, hatte immer deutschnational gewählt, aber inzwischen hatte sich sein nationaler Enthusiasmus, was den Kaiser anging, deutlich abgekühlt, mittlerweile hielt er den Ex-Monarchen für einen eitlen, ungebildeten Machtmenschen. Dieser aufreizend gezwirbelte Schnurrbart. Diese ordenbehängte, wichtigtuerisch herausgepuffte Brust. Der die Welt ins Verderben stürzte, weil er einen Platz an der Sonne, ein großmächtiges Deutsches Reich wollte, mit Kolonien und deren Bodenschätzen. Was für eine gigantische Fehleinschätzung.
»Vati, Mutti? Dann ist also der Kaiser schuld, dass ich nicht zum BDM darf?«
»Er ist nicht der Hauptgrund, aber einer der vielen Nebengründe.« Elkan hätte das weitere Gespräch gern seiner Frau überlassen, sosehr er die Wissbegier seiner Enkelin auch schätzte, noch mehr drängte es ihn, pünktlich im UKE zu erscheinen. Nicht die kleinste Unregelmäßigkeit, das kleinste Versäumnis konnte und wollte er sich mehr leisten. Die Zeiten hatten sich geändert, nicht zu seinen Gunsten.
Früher war er jeden Morgen mit einem Lächeln auf den Lippen ins Krankenhaus gegangen, jetzt tat er dies immer beklommener. Seit der Machtübernahme waren drei jüdische Kollegen ausgewandert, nach Neuseeland und Palästina. Zehn kleine Negerlein, so kam ihm sein Leben vor. Es wurden immer weniger. Nur noch Lungenfacharzt Dr. Erwin Lauschner, dessen Vater im Krieg gefallen war, und er.
Bis jetzt hatte er verhindern können, dass seine Kinderklinik euphemistisch verlogen in Kinderabteilung umbenannt wurde, so hießen jetzt die Abteilungen in anderen Krankenhäusern, in denen behinderte Kinder in den sogenannten »Gnadentod« geschickt wurden. Es gab eine Abteilung für Rassenbiologie, das neue Gesetz »zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« wurde auch im UKE immer häufiger angewandt und Krankengeschichten, die auf die Behandlung von Schwachsinn, Blindheit, Taubheit und körperlichen Missbildungen hinwiesen, an die Berliner Zentraldienststelle weitergeleitet.
»Das UKE will sich bei der Entsorgung nicht die Hände schmutzig machen«, hatte ein Kollege in der Kantine vermutet, so laut, dass er kurz darauf unter mysteriösen Umständen verschwunden war. Verhaftet, ausgewandert, man wusste es nicht. Man ahnte es nur. Aber auch Ahnungen schlichen sich in die Träume und machten sie zu Alpträumen.
»Elkan, Liebling?« Gittes Stimme war lauter geworden. »Lea wartet immer noch auf eine Erklärung. Ich bin noch zu müde, übernimmst du bitte?«
Es blieb ihm ja nichts anderes übrig. Er seufzte diskret.
»Also, aber nur kurz und knapp, weil ich zum Dienst muss. Wir haben den Krieg angefangen, das hat die Länder, die wir bekriegt haben, natürlich sehr verärgert. Dann haben wir diesen Krieg verloren, deshalb mussten wir unterschreiben, und nun steht eben in dem Vertrag, dass Deutschland sehr viel Geld bezahlen muss und wir unser Heer verkleinern müssen, damit wir keinen Krieg mehr anfangen.«
»Das find ich nur gerecht, aber was hat das mit mir zu tun?«
»Es gibt nun Menschen, leider auch gar nicht wenige, die uns Juden die Schuld geben. Sie glauben, dass wir die Weltherrschaft anstreben und dann alle Nichtjuden …«
Er hielt inne, weil ihm die eigenen Worte im Halse steckenblieben.
»Aber wo ist denn der Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden?«, fragte Lea ratlos. »Auf den Plakaten sind alle Juden hässlich und haben riesige Nasen, aber wir sehen doch ganz anders aus.«
In diesem Moment nahm sich Dr. Elkan Horwitz vor, seinem alten Studienfreund aus der Schweiz einen Brief zu schreiben. Vielleicht war am Berner Hospital eine Stelle für ihn frei. Etwas löste sich in ihm, er lächelte.
»Weißt du was?« Die Wanduhr schlug acht Mal, allerhöchste Zeit, wenn er nicht zu spät zum Dienst kommen wollte, »wir beide melden dich heute noch beim jüdischen Ruderclub an. Und dann pfeifst du auf den BDM. Die haben dich doch überhaupt nicht verdient.«
Als er gegangen war, holte Gitte aus der Küche die Butterdose, deren Anblick sie aus ehelicher Empathie Elkan ersparte. Ihre Magenschleimhaut war zum Glück robuster.
»Mutti, weißt du was?« Lea hatte in Gittes Abwesenheit blitzschnell ihren Teelöffel in das Glas mit Titz Zuckerrübenkraut getunkt und lutschte ihn hingerissen ab, während ihre rosa Zunge auf und ab tanzte. Ein Anblick, den die Erwachsenen unter entspannteren Umständen vermutlich entzückend genannt hätten.
»Was denn?«, fragte Gitte. Sie ist doch noch ein Kind, dachte sie, sie hat doch keine Ahnung, wozu Menschen fähig sind. Wie hieß noch der Spruch, den Elkan jetzt immer öfter zitierte? Der Mensch ist des Menschen Wolf. War es schon so weit?
»Was soll ich wissen?«, wiederholte Gitte.
»Ich finde es richtig blöd, dass wir Juden sind. Kann man das eigentlich noch ändern?«
Es klingelte. Lea sprang auf und linste durch den Spion. Man war vorsichtig geworden in der neuen Zeit.
»Mutti, komm schnell, da ist Tante Esther mit einer fremden Frau. Warum hast du mir nicht erzählt, dass Tante Esther kommt? Darf ich dann heute die Schule schwänzen?« Lea hüpfte aufgeregt durch den Flur und zerrte dann ungeduldig an Gittes Hand.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, dachte Gitte panisch, jetzt hatte ihre Schwester es wirklich getan. Denn natürlich war ihr die fremde Frau nicht fremd. Es war Hanna, ihre Tochter. Leas Mutter. Esther hatte angedroht, die Wahrheit im Notfall zu erzwingen. Jetzt hatte sie die Drohung wahr gemacht.
Hanna hatte sich ihrer viel zu frühen Mutterrolle immer verweigert, und Gitte, die Großmutter, sich in dieser unverhofften und viel zu späten immer selbstverständlicher gefühlt. Und so waren die Jahre vergangen. Und Lea Horwitz ahnungslos geblieben.
»Ich komme«, sagte Gitte. Plötzlich war ihr übel vor Aufregung. Ihr Herz schlug schnell und schmerzhaft. Wie in Trance riss sie die Tür auf.
»Überraschung!«, rief Esther.
Eine Stunde später.
Komische Stimmung, dachte Lea, alle reden irgendwie, aber keiner sagt was Richtiges. Ja, es hatte viel geregnet in Hamburg, in Berlin auch. In Ontaria hat eine Frau Fünflinge auf die Welt gebracht. Die Lebensmittelpreise waren viel zu hoch … Lea gähnte. Warum guckte diese elegante Fremde sie so komisch an?
»Wer bist du eigentlich?«, hatte sie gefragt und die junge, schicke Frau im knielangen, engen Rock und Perlonstrümpfen mit Naht neugierig gemustert. Eine völlig harmlose Frage, wie sie fand, aber die drei Frauen hatten beredte Blicke gewechselt und dann so merkwürdig halbe Satzfetzen gestottert.
»Ich bin Hanna«, hatte die junge Frau schließlich geantwortet und auf eine Weise schräg an ihr vorbeigeguckt, die Lea an Adolf erinnerte, wenn er etwas ausgefressen hatte, von dem er hoffte, dass es niemand bemerkt hatte. Ein Griff in die Keksdose, ein Schluck aus Vatis Flachmann, die heimliche Lektüre eines Mickey-Mouse-Heftes, das er auf der Straße gefunden und sein Vater sofort konfisziert hatte, weil er es aus unerfindlichen Gründen »jüdisch versifft« nannte. Lea unterstützte ihren Freund bei jeder Heimlichkeit, deshalb war ihr sein »schlitziger« Blick, wie sie es nannte, sehr vertraut.
Und diese Hanna guckte sehr »schlitzig«, eigentlich guckten auch Mutti und Tante Esther so. Aber warum? Die Neugier brennt mir unterm Mieder, so hätte es Tante Lily ausgedrückt, und jetzt wusste Lea, wie sich das anfühlte, dafür brauchte sie kein Mieder.
»Bist du eine Freundin von Tante Esther?«, fragte Lea. »Und lebst du auch in Berlin?«
»Zweimal ja«, lächelte Hanna und wünschte sich auf den Mond. Warum hatte sie sich auf diesen Besuch eingelassen? Esther hatte mit Rausschmiss gedroht, aber ein warmes Bett und einen Mann dazu, da war sie sicher, hätte sie in Berlin immer gefunden. Sie hob den Blick, direkt in Leas forschende Augen. Verdammt, sie sieht mir ähnlich, dachte Hanna. Soll ich … den Knoten platzen lassen und einfach … Und dann? Mit dem Satz: »Ich bin deine Mutti«, war es ja nicht getan, und was danach kam – nicht auszudenken!
»Aber ich hab auch mal in Hamburg gewohnt«, sagte Hanna schließlich.
»Und wo war es schöner?«
»Ich finde Berlin am schönsten. Aber Hamburg ist auch schön.«
»Und was machst du in Berlin? Lebt da deine Familie?«
»Ja, Tante Esther, die kennst du ja. Da wohne ich.«
»Hast du keine Familie, wo du wohnen kannst?«
Wortlos zog Gitte ihre Schwester in die Küche.
»Also wann und wer sagt endlich was«, sagte Gitte, als sie die Küchentür hinter sich zugedrückt hatten, »ich halte diese Spannung nicht länger aus. Wir haben einfach viel zu lange gewartet. Ja, ich weiß, mein Fehler.«
Esther hatte sich schweigend eine Zigarette angezündet und nach ein paar gierigen Zügen die Asche auf eine Untertasse geschnippt.
»Wer sagt es Lea?«
»Ihre Mutter«, entschied Gitte, »wie geht es ihr übrigens? Ich weiß im Grunde gar nichts über meine Tochter.«
»Sie wird langsam erwachsen«, Esther ließ ihre Antwort ganz bewusst im Ungefähren, »sie ist jung, Berlin ist eine aufregende Stadt, ich denke, so langsam …«
»So jung nun auch nicht mehr«, seufzte Gitte, »sie geht mit schnellen Schritten auf die 30 zu. Arbeitet sie denn noch in dieser Kanzlei am Ku’damm?«
»Schon lange nicht mehr, das solltest du doch wenigstens noch wissen. Frag sie doch einfach selber mal«, Esther konnte die leichte Gereiztheit in ihrer Stimme nicht unterdrücken, »sie ist schließlich immer noch deine Tochter.«
Esther sah blass und müde aus. War ihr alles zu viel?
Die beiden Frauen schwiegen, aber es war ein ungemütliches, ein angespanntes Schweigen, und Gitte hielt es nicht lange aus.
»Wie geht’s dir sonst so, Schwesterherz? Schwierigkeiten im Beruf? Dein Nachname ist ja sicher nicht hilfreich, oder?«
Esther seufzte tief und drückte ihre Zigarette aus.
»Die Weltbühne gibt es ja schon seit einem Jahr nicht mehr. Statt Kolumnen zu schreiben, lebe ich im Moment aus meinem Sparstrumpf. Aber keine Sorge, mir fällt schon was ein, vielleicht schreib ich Liebesromane wie Courths-Mahler.«
Die Schwestern umarmten sich. Spürten ihre Wärme und ihren gemeinsamen Herzschlag. Ein tröstlicher Moment.
Lea und Hanna saßen sich schweigend gegenüber. Hanna kaute an ungesagten Worten und einer ungewollten Scham und wünschte sich weit weg.
»Und, wie ist die Schule?«, fragte sie schließlich.
»Gut«, sagte Lea.
»Hast du nette Freunde?«
»Hab ich.«
»Und hier, bei deinen … ähem … Eltern, alles gut?«
Was sollte diese alberne Frage? Eine komische Frau, fand Lea, was will die hier?
»Du bist hübsch, aber du bist irgendwie komisch«, sagte sie schließlich, »hast du eigentlich Kinder?«
Forschende Augen, die Hanna kaum aushalten konnte.
»Ich habe eine Tochter«, nur ein nervöses Krächzen war möglich.
»Und wo ist die jetzt?«
Hanna riss ihre Jacke vom Stuhl.
»Meine Tochter ist bei ihrer Großmutter«, mit diesen Worten stürmte sie aus der Wohnung und ließ ein völlig verdutztes junges Mädchen zurück.
Die Schwestern hörten den lauten Knall, mit dem die Wohnungstür ins Schloss fiel, und stürzten in den Salon. Lea stand auf dem Balkon.
»Die Frau ist einfach abgehauen«, sie schüttelte den Kopf, die blonden Locken flogen, »ein komischer Mensch, ich bin heilfroh, dass sie nicht meine Mutti ist.« Sie ging zu Gitte und gab ihr einen feuchten Schmatz auf die Wange, dann war sie weg, damit sie ihren unverhofft schulfreien Vormittag nicht wieder gestrichen bekam.
Zurück blieben zwei ratlose Schwestern, die am Ende waren mit ihrem Latein. Wortlos nahm Gitte zwei Gläser aus dem Schrank, dazu eine Flasche Cognac, und schenkte großzügig ein.
»Worauf stoßen wir an, Schwesterherz?«, fragte Esther.
»Auf gar nichts«, erwiderte Gitte, »Prost.«
Kapitel 2
Hamburg, Eppendorf, Haynstraße, 1935
Traudel Kappelmann lag hellwach neben ihrem entspannt schnorchelnden Ehemann und versuchte, sich wenigstens ein bisschen mitzufreuen. Selten hatte sie ihn glücklicher erlebt als an diesem Abend. Aber es fiel ihr schwer, weil es sie einfach sehr viel Kraft kostete, sich zwischen ihrem immer nationalstolzeren Ehemann und ihrer jüdischen Nachbarschaft zu verhalten und zu behaupten. Sie fühlte sich immer irgendwo dazwischen. Fand nicht alles schlecht und vieles unbegreiflich. Wusste, wie stolz es ihren Wilfried machte, dass Ortsgruppenleiter Herbert Lange, vor dessen Amtsstube in der Erikastraße gleich zwei stolze Reichsflaggen hingen, ihn zu einem vertraulichen Gespräch gebeten hatte. Wie strahlend er ihr danach seine rote Armbinde mit dem Hakenkreuz gezeigt hatte.
»Ich bin jetzt Blockwart, Traudelchen, auf höherer Ebene hat man offensichtlich bei mir besonderen Eifer und lokalen Einfluss als treuem Parteikameraden und Mitglied der Lehrerschaft bemerkt.«
Sie hatte nur die auffallend rote Armbinde bemerkt und überlegt, wie sie auf die Bemerkungen ihrer Nachbarinnen reagieren könnte. Toni würde nur vielsagend die Augenbrauen hochziehen, auch Angelica und Gitte sich vermutlich jeden Kommentar verkneifen, aber ob sie weiterhin in Tonis Dachstube, dem beliebten Treffpunkt der Haynstraßen-Nachbarinnen, erwünscht sein würde? Ihr Ehemann ein Spitzel, es war Traudel mehr als peinlich. Lily war es, die sie am meisten fürchtete.
»Was sind denn deine Aufgaben, Wilfried«, hatte Traudel eigentlich gar nicht wissen wollen.
»Na ja, ich muss darauf achten, dass unsere Nachbarschaft im nationalsozialistischen Geist …«
Traudel versuchte, ein interessiertes Gesicht zu machen.
»… den Völkischen Beobachter liest, den Hitlergruß nie vergisst und, ganz wichtig, auf jeden Fall unsere Rundfunkstunden hört.«
Sie sah ihn an, den Mann, mit dem sie seit 18 Jahren Tisch und Bett teilte.
Dessen Schnauzer sie stutzte, weil er nicht länger zu seinem jüdischen Friseur Bubi Schwarzer gehen wollte. Dessen Vorliebe für Blutwurst und Abneigung gegen Buttermilch sie beim Einkauf und ihrer Menüplanung berücksichtigte. Sie kannte seinen nackten Körper, er kannte ihren. Und trotzdem war er ihr oft so fremd.
»Gibt es Geld?«, fragte sie, nur um etwas zu fragen.
Er schüttelte den Kopf – geradezu entrüstet.
»Was du immer denkst. Es ist ein Ehrenamt, also ehrenamtlich. Eine Ehre. Ich hoffe, das siehst du auch so.«
Wenn sie bloß endlich einschlafen könnte. Nachts werden die Harburger Berge zum Mount Everest, eine Lebensweisheit ihrer Schwiegermutter Helga.
»Schulmeister hast du bis jetzt noch nicht geschafft, mein Junge«, hatte diese das neue Amt ihres Sohnes kommentiert, »aber Blockwart. Ist doch auch was.«
Beim nächsten Mal in Tonis Salon werde ich eine Flasche Eierlikör mitbringen, mit diesem tröstlichen Gedanken schlief Traudel Kappelmann endlich ein.
Am nächsten Morgen.
Wilfried Kappelmann eilte die Treppe hinunter, Lily Bromberg eilte sie hinauf. Beiden war anzusehen, dass sie diese Begegnung gern vermieden hätten. Ein kurzes Nicken, mehr war nachbarschaftlich nicht möglich. Wo diese Schlampe wohl wieder gewesen sein mag?, dachte er. Konnte sie Gedanken lesen? Sie drehte sich um und rief seinem Rücken ein fröhliches »Herzlichen Glückwunsch, Herr Blockwart!« zu. »Auf weiterhin gute Nachbarschaft, und passen Sie bitte gut auf uns auf. Auf mich besonders.«
Dann war sie verschwunden. Und er stand auf der Straße, atmete den kleinen, harten Wutknoten in die Luft und es war ihm eine heimliche Lust, sie zu beobachten, die leise Furcht in den Augen der Nachbarn, die sonst achtlos an ihm vorbeieilten. Die Arme, die gerade noch rechtzeitig hochgerissen wurden.
»Heil Hitler.« Unwillkürlich tastete er nach der Armbinde und schob sie ein Stück nach oben.
Aber Traudel zuliebe wollte er trotzdem eher laut- und geräuschlos operieren. Lieber das Messer im Rücken als die Faust ins Gesicht sein. Schließlich wohnten sie in einer Judengegend, in einer schönen, großen Wohnung. Und bis auf das unverschämte Fräulein Bromberg benahmen sich die anderen Mieter und sein Vermieter, alles Judenpack, eigentlich recht ordentlich.
Traute er sich den Spagat zu, als Blockwart in einem Judenhaus zu wohnen? Er hoffte es. Lieber kleine Wellen schlagen als große Wogen.
Günstig deshalb, dass sein kleiner Notizblock genau in seine Hosentasche passte. So konnte er ihn genauso geschwind und diskret verschwinden lassen wie bei Bedarf wieder hervorholen, und niemand konnte eine dumme Bemerkung machen. Und er es im Zweifel, wenn er es für nötig hielt, bei einer strengen Ermahnung belassen. Bei den Teppichs, falls ihm dort etwas auffiele.
Denn seinen Vermieter zu verärgern, schien ihm trotz allem unvernünftig.
Wilfried Kappelmann war ein scharfer Beobachter, ihm fiel so einiges auf. Die immer wieder schlapp baumelnde Reichsfahne vor dem Schulgebäude zum Beispiel, ein trübetümpeliger Anblick und kein stolzes Zeichen der neuen Zeit, wieso wurde sie nicht jeden Morgen vor Schulbeginn neu und straff gehisst? Der Hausmeister hatte nur mit den Schultern gezuckt, als er ihn, wiederholt im Übrigen, auch schon ohne rote Armbinde, darauf angesprochen hatte.
»Kann ja mal vorkommen, der Fahnenmast ist kaputt und müsste ersetzt werden«, was für eine unpatriotische Einstellung, die bei Gelegenheit geahndet werden musste. Aber es war nicht der Hausmeister, der ihn vorrangig interessierte, es war noch immer Dr. Immanuel Goldmann, der Schulleiter. Der es nur seinem im Krieg gefallenen Vater zu verdanken hatte, dass er nicht längst seinen Stuhl hatte räumen müssen. Als einziger Jude war er noch im Dienst, das wurmte seinen Kollegen Kappelmann. Auch, dass er noch keine neue Wohnung gefunden hatte und seinen Parteigenossen erklären musste, warum er noch immer in einer jüdisch versifften Gegend in einem Haus voller Juden wohnte.
Seine Mutter unterstützte ihn eher halbherzig bei der Suche, Traudel hingegen wollte bleiben. »So eine schöne Wohnung finden wir nie wieder«, von dieser Meinung wich sie nicht ab, »außerdem liebe ich meine Nachbarn.«
Er würde einfach weitersuchen. Auch gegen ihren Willen. Nur das, was er sich in Barmbek, Hamm oder Horn angesehen hatte, wollte er seinen Frauen nicht zumuten. Klein und piefig war alles, was ihm angeboten wurde, vom Kohlgeruch im Treppenhaus und Gemeinschaftsklo auf halber Treppe ganz zu schweigen. Kein Vergleich zur bürgerlichen Haynstraße.
Vieles lief nicht zu seiner Zufriedenheit im Moment. Besonders in der Schule nicht. Die neue Zeit wurde noch nicht von jedem gefeiert und umgesetzt.
Zu viele Lehrer noch, die, obwohl deutschblütig, nicht linientreu waren. Die immer noch nicht wahrhaben wollten, dass jetzt ein neuer, ein frischer, ein manchmal kalter Wind wehte. Was seiner Meinung nach an einem Schulleiter lag, der die Einhaltung linientreuer Pflichten auf eine Weise locker sah, die Kappelmann rasend machte. Erst kürzlich hatte er zusehen müssen, wie eine Kollegin das Lehrerzimmer mit einem geradezu aufreizenden »Ich wünsche allerseits einen guten Morgen« betrat, statt mit dem inzwischen üblichen Heil Hitler. Darauf angesprochen, sagte sie nur:
»Ich bin sicher, dass unser Führer uns in seiner großen Güte auch einen guten Morgen wünscht, aber wenn Sie meinen …« Sie hatte etwas gemurmelt, das er nicht verstanden hatte. Es klang wie Dreiliter oder Heilila, er war sich nicht sicher, aber er wollte auch nicht nachfragen. Zu allem Überfluss hatte sie ihm dabei ins Gesicht gelacht.
Sie hatte dies schon öfter gemacht, auch in Anwesenheit von Goldmann, lange würde er sich das Ganze nicht mehr mit ansehen. Es war nicht der einzige Fehltritt, der auf seinem Notizblock in seiner akkuraten Sütterlinschrift festgehalten war. Nachlässigkeit, wohin er sein prüfendes Auge richtete. Das Buch war schon halbvoll. Nicht in jedem Klassenzimmer hing ein Bild des Führers, und erst kürzlich hatte er zufällig entdeckt, dass der Deutschlehrer seine Oberprimaner einen Aufsatz über Sternstunden der Menschheit schreiben ließ. Von Stefan Zweig! Nach der Bücherverbrennung!
Als er dies dem Schulleiter meldete, meinte dieser: »Ich gehe davon aus, dass Sie mit dem Inhalt dieses Buches vertraut sind?«
»Selbstverständlich«, beeilte sich Kappelmann zu versichern. Was immerhin die halbe Wahrheit war, er hatte es mit feuchtem Zeigefinger durchgeblättert.
»Dann darf ich Sie bitten, mir auch nur eine einzige Stelle zu nennen, die Sie als landesverräterisch empfinden. Wenn Sie so eine Stelle finden, werde ich alle Zweig-Bücher, die sich etwa noch in meiner Schule befinden sollten, persönlich auf dem Schulhof verbrennen. Mein jüdisches Ehrenwort.«
Kappelmann fühlte zu seinem großen Ärger, dass er diesem spitzfindigen, vermutlich versteckt linksradikalen, zumindest sozialdemokratischen Vorgesetzten auf eine Weise unterlegen war, die sein Blut umso mehr zum Kochen brachte, als seine Äußerungen in einem überaus sanften Tonfall gesagt worden waren.
»Und? Wie ist es, darf ich auf eine neue Erkenntnis von Ihnen hoffen?«
Wilfried Kappelmann spürte Goldmanns ironischen, fast mitleidigen Blick wie eine Ohrfeige. Eine schallende.
»Sie wissen schon, dass Sie sich strafbar machen«, war alles, was ihm einfiel, »und es Mittel und Wege gibt …«, er ließ den Satz ausklingen, von dem er hoffte, dass er wie eine Warnung klang.
»Soll das etwa eine Drohung sein? Weil Sie es als frisch gekürter Blockwart melden müssen, dass ich meinen Deutschlehrer einen Aufsatz über die Augenblicke schreiben lasse, in denen sich die Menschheit für immer verändert hat? Nichts passt doch besser in diese Zeit als dieses Thema. Erleben wir nicht gerade jetzt eine Sternstunde nach der anderen?«
Unwillkürlich nickte Wilfried Kappelmann.
»Der 30. Januar 1933 – Hitler wird Reichskanzler. Für viele sicher eine Sternstunde. Im letzten Jahr die Nacht der langen Messer. Unser aller Führer beseitigt den Volksfeind Röhm. Auch wieder eine Sternstunde. Zwei in nur zwei Jahren – Beatus Germaniae! Glückliches Deutschland. Oder sehen Sie das anders, werter Kollege?«
Kappelmann hörte ihn sehr deutlich, den süffisanten Unterton, aber er konnte sich nur mit einem matten: »So betrachtet haben Sie natürlich recht«, aus dem Zimmer schleichen. Und einmal kurz und schmerzhaft gegen die Wand treten.
Einen Tag später.
Aber jetzt umwehte Wilfried Kappelmann eine patriotische Aufgabe. Das Kollegium musste auf Volk und Führer eingeschworen werden. Schwungvoll betrat er die Hegepenne. Auf dem Flur begegnete ihm die junge Kollegin Renate Wünsche. Sofort fiel ihm auf, dass ihre Wangen und Lippen geröteter waren als sonst. Deutlich geröteter. Sie leuchteten geradezu. Aufreizend, wie er fand. Dem Führer hätte es nicht gefallen, er mochte keine geschminkten deutschen Frauen. Es ärgerte ihn, weil er wusste, dass dieses Leuchten nicht ihm galt.
»Guten Morgen«, sagte sie fröhlich, »ist heute nicht ein wunderschöner Tag? Endlich kein Regen mehr. Darf ich Sie zu Ihrer neuen Aufgabe beglückwünschen?«
Er beschloss, den leicht ironischen Unterton zu überhören.
»Haben Sie den deutschen Gruß vergessen, Fräulein Wünsche?«
Sie sah ihn an.
»Ich wusste nicht, dass der Hitlergruß inzwischen Gesetz ist, Herr Kappelmann, sollte ich da eine Wissenslücke haben, klären Sie mich bitte auf.«
Mehr noch als dümpelnde Reichsflaggen und spöttische Judenaugen hasste er es, wenn Menschen, denen er sich überlegen glaubte, anderer Meinung waren und damit recht hatten. Helga hatte ihn kürzlich an einen Tobsuchtsanfall erinnert, den er als Fünfjähriger gehabt hatte, weil er nicht hatte glauben wollen, dass die Welt eine Kugel war. Ein Spielkamerad hatte es behauptet, alle Erwachsenen dies bestätigt. Er glaubte es noch immer nicht. Denn wäre die Erde eine Kugel, würde die Menschheit, die am Rande dieser Kugel lebte, nicht ins Meer rutschen? »Willy, mein Engel, aber es heißt doch Erdkugel, nicht Erdscheibe, das wird schon einen Grund haben«, hatte Helga zu erklären versucht, er hatte sich die Ohren zugehalten.
So wie er es jetzt auch gern gemacht hätte. Denn Kollegin Wünsche hatte leider recht – der Hitlergruß war kein Gesetz. Aber in einem Rundschreiben, unterschrieben vom Gauleiter Karl Kaufmann, wies dieser schließlich ausdrücklich darauf hin, dass »Schüler, die sich auf Anweisung der Eltern weigern, den vorgeschriebenen Gruß zu erweisen, stören, die Schulgemeinschaft schädigen und nicht in der Schule belassen werden können«.
Er hätte gern aus diesem Brief zitiert, aber Renate Wünsche war mit den Worten »Und bis dahin grüße ich, wie ich es für richtig halte« bereits in der Damentoilette verschwunden. Wilfried Kappelmann kochte vor Wut. Zum Glück kannte er die richtigen Leute. Und einer davon wohnte ganz in der Nähe.
»Bist du mit unserem Vorzeigenazi zusammengestoßen?«, fragte Goldmann kurz darauf, aber erst, nachdem er die junge Referendarin zärtlich auf die Stirn geküsst hatte. Mehr trauten sie sich nicht, sie wollten ihre zart keimende Liebe noch geheim halten. Er wollte, sie übte sich in Geduld.
»Als ich ihn gesehen habe, hab ich extra nicht mit Heil Hitler gegrüßt. Ich wollte ihn ein bisschen ärgern. Wie hältst du es nur aus mit diesem Mann? Der nur darauf wartet, dass er sich auf deinem Platz breitmachen kann. Jetzt ist er auch noch Blockwart und wird sein kleines bisschen Macht sicher mit Wonne an uns austoben.«
Immanuel Goldmann trat ans Fenster. Der Blick auf den Schulhof mit den spielenden Kindern beruhigte ihn jedes Mal, wenn ihn auch sonst etwas beunruhigte. Das jugendliche Geschrei, die Bälle, die hin- und herflogen, die Knäuel sich balgender Bengel – all das zeigte ihm, dass zumindest in diesem Augenblick, auf diesem Schulhof, noch ein ganz normales Leben möglich war. Er brauchte diese Momente mehr denn je.
»Machst du dir Sorgen?« Renate Wünsche war hinter ihn getreten und umschlang ihn mit beiden Armen: »Jedes Mal, wenn ich dich umarme, bist du dünner geworden, so kann es nicht weitergehen.«
Er drehte sich um, eng umschlungen standen sie am Fenster. Ihre Beziehung war in den letzten Monaten intensiver geworden, ihr jedoch längst nicht intensiv genug. Sie liebte ihn zärtlich, er ließ sich ihre Gefühle gern gefallen. War es genug? Sie hoffte auf mehr.
»Ich weiß, woran du denkst«, sagte er.
»Du etwa nicht? Dann weißt du auch, dass ich mitkommen würde. Wohin auch immer. Je weiter weg, desto lieber.«
»Du kennst doch meine Lage, Renate.«
»Ja, die kenne ich. Deine Mutter. Dein Beruf. Dein Elternhaus.«
»Dann weißt du ja, warum ich zögere. Ich müsste alles aufgeben. Mein ganzes Leben. Ein Leben, das ich liebe. Trotz allem.«
»Mich müsstest du nicht aufgeben. Und deine Mutter würde ihren Prinzen auch nicht allein lassen, wir wären also schon mal zu dritt.«
Es klopfte an der Tür. Laut. Sie fuhren auseinander.
»Herein!«, rief Immanuel Goldmann.
Die Tür wurde aufgerissen, ein Mann in Parteiuniform trat ein. Sein Gürtel blitzte, sein Parteiabzeichen leuchtete, seine schwarzen Stiefel waren so blank gewienert, dass man sich in ihnen spiegeln konnte.
»Heil Hitler«, sein rechter Arm schnellte in die Höhe, auffordernd sah er die beiden an.
»Ich muss in den Unterricht«, murmelte Renate, die Tür fiel hinter ihr zu.
Sie vermied den Hitlergruß, wann immer möglich, das war ihr kleiner Widerstand.
Die Männer standen sich gegenüber. Hätte der eine nicht Uniform und der andere einen Anzug mit Weste getragen, man hätte sie für Freunde, sogar Geschwister halten können. Gleiche Größe, gleiche stattliche Figur, beide hatten volles Haar.
»Was kann ich für Sie tun, Herr …?« Goldmann hoffte, dass man ihm seine Unruhe stimmlich nicht anmerkte, aber er ahnte, dass dieser Besuch nichts Gutes bedeuten konnte.
»Ich bin Zellenleiter Kurt Bönig«, stellte sich der Uniformierte vor und Goldmann erwartete unwillkürlich ein zweites zackiges Heil!, aber es kam nicht, »eigentlich ist Blockleiter Otto Schulze zuständig, aber er liegt mit einer Grippe im Bett und ist unabkömmlich.«
»Dann muss es ja etwas sehr Dringendes sein«, meinte Goldmann und konnte ihn nicht verhindern, den leicht spöttischen Unterton. Er räusperte ihn energisch weg, zu viel stand auf dem Spiel, das wusste er. Zu viele jüdische Beamte waren arbeitslos, bereits ausgewandert, einige sogar in Umerziehungslagern. Man musste vorsichtig sein.
»Das ist es allerdings«, Kurt Bönig trat einen Schritt zurück und drückte seine ohnehin breiten Schultern noch etwas breiter, »uns wurde mitgeteilt, dass diese Schule, die zukünftige Nationalsozialisten ausbildet, es offensichtlich mit den neuen Regeln unserer Regierung nicht allzu genau nimmt.«
Was ist aus meinem geliebten Deutschland geworden? Es war nicht das erste Mal, dass sich Goldmann diese Frage stellte. Es waren nicht die großen Dinge, die ihn nachts schlaflos und morgens schweißgebadet aufwachen ließen, nicht Krieg, Inflation, politisches Chaos – es waren die kleinen Dinge, die vermeintlich winzigen, die jetzt auf einmal lebenswichtig waren.
Die vielen Vorschriften, Verbote und Erlasse, die Menschen wie ihm das Leben so schwer machten. Wie eine tobsüchtige Hausfrau war die neue Regierung über den Alltag ihrer Bürger hergefallen, hatte unter jedes Möbelstück, in jede Ritze geleuchtet. Wie gegrüßt wurde, was gelehrt wurde, was im Radio gehört werden, was gelesen werden durfte – alles wurde ausgemerzt, was der strengen Nazihausfrau nicht gefiel.
Dass gegen Kommunisten oder Sozialdemokraten vorgegangen wurde, konnte Goldmann zwar nicht gutheißen, aber doch immerhin halbwegs nachvollziehen, auch er hatte immer nationalkonservativ gewählt, aber warum die Juden?
Wann hatte je ein sogenannter Deutschblütiger irgendeinen Nachteil durch einen jüdischen Mitbürger gehabt? Die Orthodoxen waren schon immer unter sich geblieben, die Assimilierten fühlten und dachten deutsch. Palästina war für die meisten ein Landstrich aus der Bibel, der hauptsächlich aus Wüste und malariaverseuchten Sümpfen bestand und als ausgesprochen rückständig galt, keine Gegend, die zu besuchen sie auch nur das geringste Interesse hatten.
»Das ist die Strafe dafür, dass wir Gottes Sohn gekreuzigt haben«, davon war seine Mutter überzeugt; dass diese Straftat fast 2.000 Jahre zurücklag, und dass streng genommen die Römer damals juristisch zuständig gewesen waren, konnte sie nicht umstimmen. Diese mütterliche Gottergebenheit konnte ihr Sohn nicht teilen, und den sehr verbreiteten Glauben an das sogenannte Weltjudentum, das die Weltherrschaft anstrebe, um die arische Herrenrasse zu vernichten, fand er einfach absurd, selten hatte er etwas Abenteuerlicheres gehört. Als Mann, der analytisch dachte, Fakten liebte, fiel es ihm sehr schwer, das »antijüdische Geschwurbel«, wie er es nannte, ernst zu nehmen.
»Wenn mir auch nur ein Nationalsozialist einen einzigen Beweis für diese angebliche Weltverschwörung liefert, würde ich sofort in die Partei eintreten.«
Seine Mutter hatte nur spöttisch gelacht, als er dies am Abendbrottisch kundtat. »Du vergisst, dass du als Jude kein NSDAP-Mitglied werden kannst.«
»Hören Sie mir noch zu?«
Goldmann zuckte zusammen.
»Entschuldigung. Ich war kurz abgelenkt. Meinen Sie unsere Reichsflagge? Unser Hausmeister wird den Fahnenmast noch in dieser Woche reparieren, dann dürfte es keine Probleme mehr geben.«
Einen ganz kurzen Augenblick wusste Zellenleiter Bönig nicht weiter. Sein Freund und Blockwart Otto Schulze hatte ihm von einem Lehrer an der Oberrealschule in der Hegestraße berichtet. Geradezu nationalfeindliche, volksgefährdende, regelwidrige Dinge seien diesem treuen Parteimitglied aufgefallen. Insbesondere der Schulleiter, leider immer noch ein Jude mit Ausnahmegenehmigung, sei geradezu aufreizend locker, was die neue Ordnung beträfe. Ob man da nicht etwas nachhelfen könne? Ein deutlicher Auftritt, eine klare Ansage.
Nachhilfe war Bönigs Lieblingsbeschäftigung. Als Zellenleiter hatte er sechs Häuserblocks unter sich, und er ahnte natürlich, dass die Hausbewohner seines Bereichs im Generalviertel ihn lieber von hinten als von vorn sahen. Denn ihm entging nichts. Kein luschig gehobener rechter Arm, kein gelangweilt genuscheltes Heillliler, kein verunziertes Hitlerplakat. Sein wachsames Auge war überall, auch jenseits seiner Blöcke. Als er kürzlich auf der Mönckebergstraße in der Auslage eines Andenkenladens eine Hitlerfigur mit Winkearm, umrahmt von Weihnachtskugeln mit Hitlerbärtchen, entdeckte, da hätte er natürlich vorbeigehen können. Nicht sein Beritt. Aber er war trotzdem mit einem kräftigen Heil Hitler eingetreten und hatte die Besitzer, zwei ältere Leutchen, energisch darauf hingewiesen, dass Winkeärmchen und Glitzerkugeln eine »Verunglimpfung unseres Führers« bedeuteten. Sie hatten sich angeschaut mit einem Blick, den er als amüsiert deutete, und sich darüber geärgert.
»Sie wissen schon, dass Sie so etwas in ernsthafte Schwierigkeiten bringen kann«, das musste er noch loswerden, bevor er mit einem weiteren Heil Hitler und dem wohligen Gefühl, etwas für die Volksgesundheit getan zu haben, wieder aus dem Laden marschierte.
Immanuel Goldmann betrachtete sein Gegenüber. Schwieg und wartete einfach ab. Aus Gründen, die er selbst nicht deuten konnte, war ihm dieser Zellenleiter auf den ersten Blick nicht unsympathisch wie so viele seiner Parteigenossen. Wer wusste schon, was diesen Mann dazu getrieben hatte, der zu werden, der jetzt vor ihm stand? Druck von oben? Eine schlimme Kindheit, eine Familie, die er ernähren musste, ein noch schlimmeres Kriegserlebnis?
»Unsere Fahne ist es offensichtlich nicht, die Ihren Unmut erregt hat«, nahm Goldmann das Gespräch wieder auf, »ich vermute, es war mein geschätzter Kollege Kappelmann, dem ich schon des Längeren ein Dorn im Auge bin. Und ich verspreche Ihnen, in Zukunft wird an dieser Schule zünftig gegrüßt. Heil Hitler!«
Er rief es so laut, dass die Schulsekretärin Agnes Disse erschrocken die Tür aufriss: »Ist etwas passiert, Herr Dr. Goldmann?«
Er winkte beruhigend ab.
»Alles in bester Ordnung, Fräulein Disse.«
Die beiden Männer sahen sich an. Wussten nicht so recht, wie es weitergehen konnte. Die neuen Zeiten fühlten sich eben manchmal noch ungewohnt an. Es gab neue Macht, neue Vorschriften, neue Opfer und Täter. Man fand sich nicht immer gleich zurecht in dieser neuen Zeit. Jedenfalls Bönig ging es manchmal so. Wenn ihm jemand, den seine Kameraden als Blutsauger und Erzfeind beschrieben, wider Erwarten durchaus sympathisch war. Er nicht fühlte, was er fühlen sollte. Wie gerade jetzt, im Büro des Schulleiters, den sein Parteifreund Kappelmann in den düstersten Farben beschrieben hatte.
Aber alles an diesem Mann war – so deutsch wie er. Keine überspitzte Intellektualität, nichts verschlagen Weltjüdisches. Nur der Name, der konnte nicht jüdischer sein. Aber für seinen Namen konnte ja nun wirklich niemand etwas.
»Betrachten Sie sich bitte als gebührend von mir gewarnt«, sagte Bönig.
Immanuel Goldmann lächelte ihn an.