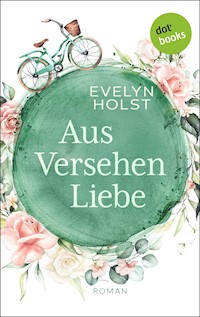Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe in Royalblau: Der spritzig-humorvolle Roman »Ein König für gewisse Stunden« von Evelyn Holst jetzt als eBook bei dotbooks. So ein König ist auch nur ein Mann … Ein Kurzurlaub im schönen Dresden – gibt es etwas Besseres, um seinen notorisch untreuen Gatten zu vergessen? Aber kaum hat Constanze begonnen, sich mit der Geschichte des strahlenden Elbflorenz zu beschäftigen, stößt sie bei Schritt und Tritt auf König August den Starken, der hier vor 400 Jahren nichts anbrennen ließ. Was für ein Widerling, denkt Constanze – dem würde sie gerne die Leviten lesen! Womit sie allerdings nie gerechnet hätte: Dass sie am nächsten Morgen tatsächlich im 17. Jahrhundert aufwacht … und August höchstpersönlich vor ihr steht. Natürlich will Constanze so schnell wie möglich in ihre eigene Zeit zurückkehren. Andererseits: August sieht ziemlich gut aus. Und wie oft gibt es schon die Gelegenheit, einen König zu verführen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der turbulente Liebesroman »Ein König für gewisse Stunden« von Evelyn Holst – für alle Fans von Gaby Hauptmann und Susanne Fröhlich. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
So ein König ist auch nur ein Mann … Ein Kurzurlaub im schönen Dresden – gibt es etwas Besseres, um seinen notorisch untreuen Gatten zu vergessen? Aber kaum hat Constanze begonnen, sich mit der Geschichte des strahlenden Elbflorenz zu beschäftigen, stößt sie bei Schritt und Tritt auf König August den Starken, der hier vor 400 Jahren nichts anbrennen ließ. Was für ein Widerling, denkt Constanze – dem würde sie gerne die Leviten lesen! Womit sie allerdings nie gerechnet hätte: Dass sie am nächsten Morgen tatsächlich im 17. Jahrhundert aufwacht … und August höchstpersönlich vor ihr steht. Natürlich will Constanze so schnell wie möglich in ihre eigene Zeit zurückkehren. Andererseits: August sieht ziemlich gut aus. Und wie oft gibt es schon die Gelegenheit, einen König zu verführen?
Über die Autorin:
Evelyn Holst studierte Geschichte und Englisch auf Lehramt. Nach dem ersten Staatsexamen arbeitete sie dreizehn Jahre als Reporterin für den »Stern«, u. a. als Korrespondentin in New York. Für ihre Reportage »Es ist so still geworden bei uns« wurde sie mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis ausgezeichnet. Seitdem verfasste sie zahlreiche Romane, die auch verfilmt wurden, sowie Originaldrehbücher für Fernsehfilme. Evelyn Holst ist mit dem Filmemacher Raimund Kusserow verheiratet, mit dem sie gemeinsam zwei erwachsene Kinder hat.
Bei dotbooks veröffentlichte Evelyn Holst auch ihre Romane »Aus Versehen Liebe«, »Ein Mann aus Samt und Seide«, »Du sagst Chaos, ich sag Familie«, »Ein Mann für gewisse Sekunden«, »Gibt's den auch in liebenswert?« und »Der Mann auf der Bettkante«.
Ebenfalls bei dotbooks erscheint ihre Hamburg-Krimireihe:
»Die Sünde – Alexa Martini ermittelt«
»Der Verdacht – Alexa Martini ermittelt«
»Das Verlangen – Alexa Martini ermittelt«
***
eBook-Neuausgabe Juni 2022
Dieses Buch erschien bereits 2006 unter dem Titel »August und ich« bei Ullstein.
Copyright © der Originalausgabe 2006 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Kristin Pang, unter Verwendung von Motiven von Sarema / shutterstock.com, BelusUAB / shutterstock.com und Azurhino / shutterstock.com
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-179-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt und geschrieben wurde – und als solches von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Ein König für gewisse Stunden« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Evelyn Holst
Ein König für gewisse Stunden
Roman
dotbooks.
Dieses Buch ist Raimund gewidmet
»Schönheit liebe ich, Charakter widert mich an.«
August der Starke
Prolog
Woran erkennt eine Frau, dass sie geliebt wird? Woran merkt sie, dass sie betrogen wird? Ich glaube nämlich nicht an das Klischee mit den Lippenstiftspuren auf dem Hemd. Welcher Mann ist schon so blöd, sich von seiner Geliebten aufs Hemd küssen zu lassen? Klar, als Geliebte hinterlässt man natürlich gern eine kleine, fiese Duftmarke: »Sieh mal her, du ahnungslose Ehefrau, genau dahin hab ich deinen Mann geküsst, und nicht nur dahin.«
Wenn ich ein Mann wäre (Gott behüte!), der seine Frau betrügt (undenkbar), dann wäre ich hoffentlich ein schlauer Fremdgänger, der die Regeln beherrscht. Also – beim Seitensprung nur schwarze Oberhemden, darauf sieht man keinen Lippenstift. Im Hotel und Restaurant ausschließlich bar bezahlen, Kino-, Theater-, Operntickets immer sofort wegwerfen. Nach dem Schäferstündchen duschen, aber nicht zu lange, denn riecht ein Mann nach einem langen Arbeitstag und einem »Hat leider bis Mitternacht gedauert, Schatz«-Meeting wie eine Rose, werden schlaue Frauen misstrauisch. Also merke: Vor dem Nachhausegehen stets in eine Knoblauchzehe beißen, Seitenspringer haben nämlich garantiert keine Knoblauchfahne. Die allerwichtigste und allergemeinste Regel allerdings heißt: Männer, die fremdgehen, müssen ganz besonders nett zu ihren Frauen sein, dann merken sie nichts! Denn sooo schlau sind Frauen leider doch nicht!
Wenn wir richtig lieben, sind wir blöd. Total blöd.
Hamburg, 22. September 2005
An diesem Tag war die Welt für mich noch total in Ordnung. Da wachte ich, Constanze Graf, genannt Connie, achtunddreißig Jahre alt und an diesem späten, wunderbar sonnigen Septembermorgen leider trotzdem keine Sekunde jünger aussehend – aber das konnte natürlich auch am grellen Licht liegen –, neben meinem Mann Richard auf, grinste zufrieden vor mich hin, drehte mich zu dem noch schlafenden Murmeltier neben mir, küsste den Leberfleck auf seiner linken Schulter und ahnte nicht im Traum, was vergangene Nacht vorgefallen war.
Ich war wie immer früh schlafen gegangen und wusste nicht, dass er sich erst im Morgengrauen auf Zehenspitzen ins Schlafzimmer und mit angehaltenem Atem ins Ehebett geschlichen hatte.
Ob er noch einen Blick auf mich geworfen hatte, wie ich da so arglos in mein Kopfkissen schnorchelte, oder ob er schlaflos neben mir wach gelegen und nachgedacht hatte? Wie ich meinen Richard kannte, war er vermutlich sofort eingeschlafen. Das tat er gern nach einer körperlichen Anstrengung. Bei mir jedenfalls. Vier Sekunden nach seinem Orgasmus, spätestens, lag er mit so weit geöffnetem Mund, dass man theoretisch bis zum Zäpfchen gucken könnte, auf dem Rücken und war im Lummerland.
Selbstverständlich fand ich ihn niedlich, wenn er so ganz wehrlos und ungeschützt neben mir ruhte. Außerdem: Ein Mann, der aussieht wie ein schlaffer Karpfen, ist schließlich ein Mann, der einem ganz allein gehört, oder? Keine Frage, im wachen Zustand sah Richard keineswegs wie ein seekranker Fisch aus, ganz im Gegenteil. Er war durchaus eine männliche Augenweide. Er war groß, hatte breite Schultern und nur einen klitzekleinen Bauchansatz. Seine blonden Haare waren zwar schon etwas ausgedünnt, aber da er sie ratzekurz trug, fiel das nicht so auf. Dafür waren seine Hände genau so, wie Männerhände sein sollen: breite Handflächen mit langen, kräftigen Fingern, die in unserer Anfangszeit auf meinem Körper ganze Flächenbrände entfacht hatten. Tja, auch das hatte deutlich nachgelassen im Laufe der Jahre. Alles in allem hatte ich jedoch Glück mit meinem besten Stück.
Das dachte ich zumindest an diesem Morgen, als ich mich auf leisen Sohlen aus dem Schlafzimmer schlich und die Welt für mich noch in Ordnung war. Ich war eine ganz normale, manchmal einen Hauch gelangweilte, aber im Grunde mit ihrem Leben zufriedene Ehefrau. Dass ich außerdem das ahnungsloseste Schaf auf Gottes weiter Weide war, hatte zwei Gründe: Erstens hatte ich einen festen Schlaf, und zweitens war ich eine Frau, die zu sehr liebte.
Meinen Richard liebte ich, seitdem ich mit vierzehn Jahren im Sportunterricht ganz überraschend meine erste Regel bekommen und er mir in der großen Pause Cameliabinden gekauft hatte. Von seinem Taschengeld und obwohl er zwei Klassen über mir war. »Hier«, sagte er und warf mir die Packung zu. Alle lachten ihn aus, aber ich war ihm wichtiger als sein Männerstolz.
Sein Einsatz hatte sich gelohnt, denn seitdem gehörte ihm mein Herz, inzwischen immerhin vierundzwanzig Jahre. Klar, es pochte längst nicht mehr WUMM, wenn ich nur an ihn dachte, es pochte eher wümmchen, wenn ich mit ihm schlief, aber war das nicht normal? Mein Richard war noch nie das gewesen, was er selbst bei anderen Männern ein wenig abfällig »einen Gefühlskasper« nannte, und als der liebe Gott die Romantik verteilte, hatte er alle anderen vorgelassen. »Tut mir leid, ich habe nur noch ein paar Krümel«, hatte der liebe Gott bedauert, und mein Süßer hatte vermutlich gesagt: »Macht nichts, für meine Frau reicht es.«
Deswegen hatte ich ihm auch, als ich langsam ungeduldig wurde, einen Heiratsantrag gemacht. (»Willst du mich, Richard?« – »Aber klar doch, meine Süße!«) Die Ringe hatte ich ohne ihn ausgesucht, die Hochzeitsnacht verbrachten wir auf einer Parkbank, weil die kleine Vertreterabsteige im Sauerland, in der wir ein Zimmer gebucht hatten, nach Mitternacht bereits geschlossen war. Ein frühes Warnsignal für spätere romantikdürre Zeiten?
Vielleicht. Aber ich war zu beschäftigt, um es zu merken. Ich bekam zwei Töchter, Friederike und Alexa. Die achtjährige Alexa war ein echter kleiner Sonnenschein und (noch) völlig unkompliziert. Für meine Älteste dagegen müsste der Begriff »Pubertätshorror« neu definiert werden. Eigentlich hatte sie mit ihren inzwischen sechzehn Jahren nur noch einen einzigen Gesichtsausdruck. Den des absoluten Überdrusses, was Schule, Eltern, das Leben überhaupt anging, sofern es sich nicht um ihre Clique oder um Klamotten handelte. Auch ihr Sprachschatz war proportional zu ihrem Hormonüberschuss drastisch geschrumpft und bestand eigentlich nur noch aus drei Sätzen: »Nein, ich hab keine Schularbeiten auf. Kannst du mir mal ein bisschen Geld geben? Mein Gott, bist du peinlich, Mama.«
Sie war also im Augenblick, um dies einfach einmal deutlich zu sagen, kein Kind, das ein Mutterherz erwärmte. Ich konnte sie nur aushalten, indem ich tief durchatmete und mir, wenn’s richtig schlimm wurde, ihre alten Babyfotos ansah. Dann staunte ich immer, wie niedlich sie mal gewesen war, bevor sie über Nacht zum Schreckensteenie wurde!
Kleines Beispiel: Am Vorabend fand ich eine halb leere Zigarettenschachtel und ein Kondom in einem ihrer Turnschuhe. Eine Sekunde lang zögerte ich, ob ich das Corpus Delicti nicht einfach in den Müll werfen sollte, doch dann siegte mein pädagogischer Ehrgeiz. Ich ignorierte das Schild an ihrer Tür (»Eltern müssen draußen bleiben«) und trat ohne anzuklopfen in das halb verdunkelte Absolutchaos, das einmal ein nettes Jungmädchenzimmer gewesen war.
Erklärung bitte, junge Dame. Die gehörten ihr nicht, behauptete sie dreist. Wer hat sie in deinen Turnschuh gelegt? Keine Ahnung. Hältst du mich für total bescheuert? Die Antwort lag so deutlich in ihren Augen, dass ich ihr entweder eine Ohrfeige geben oder versuchen konnte, mit einer wachsweichen Drohung einen Hauch von Restwürde zu wahren: »Ich werde mit deinem Vater darüber reden.« – »Ja, tu das, Mami«, lächelte sie, und für einen klitzekleinen Moment verspürte ich den innigen, mörderischen Wunsch ... Gab es eigentlich so etwas wie einen Elternunlustmord?
Egal, ich unterdrückte ihn und knallte die Tür zu.
Da Richard noch schlief, konnte ich leider nicht sofort mit ihm darüber reden, und so grillte ich erst mal meine Tochter weiter, nachdem ich sie aus dem Bett gescheucht hatte.
»Woher kommen die Zigaretten? Wozu brauchst du in deinem Alter Kondome?«
Wie immer änderte sie die Taktik und appellierte an mein Bedürfnis, eine coole Mami zu sein. »Ich bewahr das alles doch nur für eine Freundin auf, deren schrecklich spießige Eltern total ausrasten würden. Bitte Mami, ich hab dich auch ganz doll lieb. Du bist die Allerbeste.«
Ich bin generell eine weiche Mami, und an diesem Morgen war ich sowieso viel zu schwach für Krieg, weil ich bereits seit halb fünf Uhr wach war, um mit Alexa Diktat zu üben. Die drei Stunden bis zum Abmarsch Richtung Schule hatten hoffentlich gereicht, um ihr endlich begreiflich zu machen, dass man Wonne mit zwei n schreibt und wohnen nur mit einem, dafür mit Dehnungs-h.
»Vor doppelten Konsonanten kommt immer ein kurzer Vokal, lang ist er nur, wenn du ihn verdoppelst oder ein h dranhängst, mein Mäusezahn«, knirschte ich um Viertel vor sechs zum achten Mal, schenkte mir die dritte Tasse Tee ein und versuchte, dafür dankbar zu sein, dass sie bis auf diese hartnäckige Rechtschreibschwäche, die sie übrigens nicht von mir hatte, erfreulicherweise noch ein nicht pubertierendes, verschmustes Mädchen war. Eines, das bis vor einem Jahr noch an den Weihnachtsmann geglaubt hatte und sich bisher nicht wie ihre ältere Schwester den Bauchnabel piercen und das Schamhaar herzförmig ausrasieren musste.
Natürlich tat Friederike das alles heimlich, und ich entdeckte es nur, weil sie das Badezimmer nicht abgeschlossen hatte und unser Duschvorhang durchsichtig war.
Heimlichkeit schien bei uns in der Familie zu liegen. Bloß ich hatte keine Geheimnisse, ich breitete mein Innerstes vor den anderen aus wie ein offenes Buch. Alle wussten, dass ich bei Kitschfilmen heulte, zum Frühstück gern Käsebrot mit Marmelade aß, vor großen Hunden Angst hatte, seit mich beim Zeitungsaustragen mal ein Schäferhund gebissen hatte, morgens, bevor ich im Bad war, die Eier abschrecken könnte, wie meine Älteste gern so nett formulierte, und dass ich an den lieben Gott glaubte, den ich mir als alten Mann mit weißem Bart vorstellte, so ähnlich wie den Weihnachtsmann.
Außerdem glaubte ich an die Seelenwanderung, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass etwas so Kostbares wie unsere Seele nur ein Leben hat. Ich wusste, sie wiegt einundzwanzig Gramm, weil amerikanische Wissenschaftler Menschen direkt vor und direkt nach ihrem Tod gewogen hatten und der Unterschied bei jedem genau einundzwanzig Gramm betrug. Ich war davon überzeugt, dass die Seele, wenn wir sterben, unseren Körper verlässt und sich einen neuen sucht. Nicht heute und nicht morgen, sondern irgendwann, wenn sie einen sieht, in den sie gern hineinschlüpfen möchte. Und da die Seele das, was sie bis dahin gelernt hat, nicht verschwenden will, sucht sie sich jemanden aus, dem sie noch etwas beibringen und den sie verbessern kann. Wenn man also Glück hatte, bekam man eine Seele, die schon viel wusste und einen richtig schlau machte.
Ich dachte oft darüber nach, in welchem Körper meine Seele wohl in einem früheren Leben gesteckt hatte und was sie mir in meinem jetzigen beibringen wollte. Ehrlich gesagt, ich hatte keine Ahnung, doch ich war sicher, ich würde es irgendwann erfahren.
Aber das war an diesem Septembermorgen nicht mein Thema. Sondern mein Ehemann Richard, der auch nach dem dritten Weckversuch nur »Lass mich« murmelte und sich tiefer ins Kopfkissen grub, weil er zu der Spezies der »Bismittagsbinichimkoma«-Menschen gehörte.
Der Morgen hatte mich bereits leicht erschöpft, also setzte ich mich auf die Bettkante und betrachtete meinen Schatz. Er sah gut aus, auch mit seinem leicht geöffneten Karpfenmund, aus dem nachts oft so unglaubliche Urwaldtöne drangen, dass ich ihn entweder zweimal kurz und kräftig in die Nase kneifen (Tipp von meinem HNO-Arzt) oder genervt auf dem Sofa schlafen musste. »Guten Morgen, mein Schnurzel«, flüsterte ich, beugte mich über sein zerknautschtes Gesicht, küsste seine noch schlafwarmen Lippen und stutzte. »Hast du dich gebissen?«, fragte ich dann und fuhr mit dem Zeigefinger ganz vorsichtig über die kleine Wunde auf seiner Unterlippe, auf der sich bereits ein dünner Schorf gebildet hatte.
Dabei war mein Mann gar kein Nassrasierer, dem die Klinge ausgerutscht sein könnte, und so nervös, dass er sich die Unterlippe blutig biss, war er eigentlich auch nicht.
»Sind die Kinder weg?«, murmelte er, und als ich »Seit einer Minute« sagte, grinste er und schlug mit geschlossenen Augen die Bettdecke zurück. »Komm, mein Zuckerapfel«, sagte er, und ich kam.
Eine Viertelstunde später standen wir beide unter der Dusche, wohlig entspannt, mit der Welt im Einklang. Ich war es jedenfalls.
»Ich liebe dich, Richard«, flüsterte ich, aber er hörte mich nicht, weil wir einen neuen Duschkopf mit Powerstrahl hatten, der meine kleine Liebeserklärung verschluckte. »Ich liebe dich mehr als mein Leben.« Stimmt das eigentlich?, dachte ich, während ich uns beide mit Badeschaum einrieb. Würde ich für diesen Mann mein Leben geben? Wenn der Arzt zu mir sagen würde: »Ihr Mann wird nur überleben, wenn Sie ihm Ihr Herz spenden«, würde ich dann tatsächlich »Nimm mein Herz, Geliebter!« flüstern und es mir aus dem Leibe reißen?
Eher weniger. Ich würde ihm natürlich eine Niere spenden, aber ich hatte ja auch zwei davon.
»Ich muss übrigens heute nach Berlin«, sagte Richard. »Und ich hab überhaupt keine Lust. Ich würde viel lieber bei dir bleiben.«
Ich küsste ihn und fand diesen Morgen ganz wunderbar. Es beflügelte mich jedes Mal, wenn ich mit meinem Mann schlief. Ich fühlte mich dann jung, begehrenswert, sexy. Wir sollten es viel häufiger tun, dachte ich oft, es tut uns gut. Sex macht jung, schön und attraktiv, auch mit einem Partner, der gelegentlich »Kannst du mir bitte mal neues Klopapier bringen?« aus dem Badezimmer ruft.
Aber dann vergaß ich das Thema wieder, ich war abends müde oder er war auf Dienstreise, als Pharmareferent war er viel unterwegs, und schwupps war wieder ein Monat um. Oder zwei.
An diesem so trügerisch schönen Septembermorgen setzte ich mich, nachdem ich meinen Mann mit einem sanften Kuss auf die Wange verabschiedet hatte, an unseren Küchentisch, um ihm noch ein paar Momente hinterherzuträumen. Klingt irgendwie komisch für eine alte Ehefrau, aber es war so. Nicht immer, doch immer mal wieder überfiel mich dieses Gefühl von absoluter Liebe zu meinem eigenen Mann. Dann vermisste ich ihn richtig, wenn er weg war. Dann hatte ich richtige Sehnsucht nach ihm. Ach ja!
Sehnsucht nach mir hatte er jedenfalls noch nie gehabt. Ging auch gar nicht. Ich war schließlich immer da. Zuverlässig, treu, lieb. Ich war keine Frau, nach der man Sehnsucht haben konnte. Und Richard war kein Mann, der dieses Gefühl zumindest ansatzweise kannte. Alles, was auch nur entfernt mit Romantik zu tun hatte, nannte er »Seelenblähung«. So war er eben, mein Gemahl. Zuverlässig wie eine Schweizer Uhr. Aber kein Mensch, der Sehnsucht kennt.
Dachte ich jedenfalls.
Was sollte ich auch anderes denken über einen Mann, der auf die Frage »Liebst du mich noch?« leise seufzend »Wäre ich sonst mit dir verheiratet, Schatz?« antwortete. Der mir zum Hochzeitstag einen Akkubohrer schenkte, weil er selbst jedes Mal, wenn er ein Bild aufhängen wollte, die Wand zum Schweizer Käse machte? Ein Mann, der zwar keine Ahnung hatte, wie Frauen ticken, der mir jedoch, sofern ich darauf bestand, die Füße massierte, auch wenn ich den ganzen Tag in Turnschuhen herumgelaufen war.
So ein Mann ist eine sichere Bank, glaubt man als Frau. Ich glaubte es jedenfalls. War es überhaupt erstrebenswert, wenn man alles wusste? Lebte es sich nicht sehr viel besser, wenn man die Welt für unschuldiger hielt, als sie war? War Eva nicht viel glücklicher, als sie noch nicht vom Apfel der Erkenntnis genascht hatte?
Fragen, die für mich an diesem Morgen ferner lagen als der Mond, denn ich schwelgte gerade in meinem kleinen Privatparadies, als das Telefon klingelte.
An ihrer hektischen, immer einen Tick zu lauten Stimme hörte ich, dass meine Nachbarin und beste Freundin Bettina Gärtner, die ich immer »Gutelaunekugel« nannte, was sowohl optisch als auch vom Charakter her passte, da sie klein und niedlich war und rote Kringellöckchen hatte, schon ihre erste Krise auslebte. »Wieso bist du noch nicht hier und gehst das Menü mit mir durch?«
Oje, ganz vergessen. »Weil ich gerade aus dem Bett komme«, antwortete ich mit einer Prise Schuldgefühl.
»Aus dem Bett, um diese Zeit?«, rief sie.
»Richard war bis eben noch da«, sagte ich.
Kleine Pause. »Der Monat ist doch noch gar nicht um«, sagte sie lachend, und ich hörte eine Spur Neid heraus. »Hat es sich denn gelohnt? Auf einer Skala von eins bis zehn, was war’s?«
»Sieben plus«, erwiderte ich.
Sie schwieg. Dann: »Mein letztes Mal war höchstens eine drei.« Sie lachte: »Christoph hat eben andere Qualitäten. Abgesehen davon wird er übermorgen vierzig, und die Menüfrage ist noch ungeklärt. Also, was hast du dir Schönes ausgedacht? Ich höre und staune hoffentlich.«
Da ich wirklich gut kochte und sonst nichts Entscheidendes gelernt hatte, lag es nahe, dass ich mit meinem bescheidenen Talent nicht nur meine undankbare Familie beglückte, sondern auch ein bisschen dazuverdiente. Richard war nach abgebrochenem Medizinstudium (Faulheit, zu viele Partys, vielleicht auch ein paar Gehirnzellen zu wenig?) und Friederikes Geburt Pharmareferent geworden, und dass die fetten Jahre vorbei waren, der Kuchen immer kleiner wurde und Ärzte und Apotheker von Jahr zu Jahr schwieriger, hörte ich fast täglich von ihm.
»Früher haben sie mir den roten Teppich ausgerollt, Mäuschen«, erklärte er mit traurigem Blick. »Ich brauchte nur den Bestellblock zu zücken und aufzuschreiben.«
Jetzt saß er oft stundenlang in Wartezimmern herum, die Sprechstundenhilfen vertrösteten ihn, und wenn er endlich vorgelassen wurde, waren die Ärzte und vor allem die Apotheker genervt, weil sie unter der Schraubzwinge einer chaotischen Gesundheitsreform ächzten und die Medikamente immer billiger wurden. Trotzdem musste mein Süßer lächeln und ihnen schon wieder ein neues cholesterinsenkendes Wundermittel anpreisen, auch wenn er selbst ganz genau wusste, dass es um keinen Deut besser war als das alte.
Das Thema nervte und beunruhigte mich. In letzter Zeit kam Richard oft derart schlecht gelaunt nach Hause, dass ich manchmal befürchtete, er würde einfach alles hinwerfen, denn Anfälle von Spontaneität waren ihm nicht fremd. Erst drei Monate zuvor hatte er für 2,50 Euro im Internet ein Grundstück ersteigert, jedoch erst viele Anwaltsbriefe später begriffen, dass es sich um einen schlechten Scherz gehandelt hatte.
Tatsache war: Der Rubel im Hause Graf saß nicht mehr so locker wie früher, deswegen hatte ich kürzlich ein kleines Catering Business namens »Constanzes Kost« eröffnet. Nichts Großes, aber ich kochte jetzt nicht nur umsonst für Freunde, sondern gelegentlich auch für Kunden, die mich dafür bezahlten. Das Geschäft lief gut, was vermutlich daran lag, dass ich extrem billig war. Mehr oder weniger Lady Nulltarif. Aber das würde sich ändern. Bald.
»Hallöchen, bist du noch dran?«, riss mich Bettinas Stimme aus meinen Betrachtungen. »Was passt denn kulinarisch zu vierzig? Steak für starke Kerle oder Kartoffelbrei für die drohenden dritten Zähne?«, kicherte sie.
»Was hältst du von Truthahnpastete als Vorspeise, Ochsenschwanz mit Petersiliensauce und gelben Rüben als Hauptgericht und zum Nachtisch Eierkuchen mit Parmesan gefüllt?«, schlug ich vor, während ich in meinem neuen Lieblingskochbuch Der kulinarische König mit wunderbaren spätbarocken Rezepten blätterte.
Sie schwieg, ich wartete. »Ein bisschen sehr deftig.« Ihre Stimme klang skeptisch. »Ungewöhnliche Zusammenstellung. Woher hast du das?«
»Aus einem neuen Kochbuch«, erwiderte ich und war ein wenig enttäuscht von ihrer Reaktion. »Von August dem Starken. Der hat als Vorspeise einmal 144 Austern gegessen, danach dann Lerchen, Kalbsaugen und Schnepfendreck.«
»Klingt ja superlecker«, sagte Bettina ohne jegliche Begeisterung. »Da kann ich ja noch froh sein, dass du das nicht als Geburtstagsmenü vorschlägst.«
Ich fühlte mich beleidigt. Warum eigentlich? Weil sie keinen Schnepfendreck mochte? »Mach dich bitte nicht über August den Starken lustig«, sagte ich.
Sie fing an zu lachen und steckte mich an. »Sorry, Schatzeline, aber ich hab echt keine Ahnung, wer das ist. Ein Bodybuilder oder ein Freak aus dem Dschungelcamp?«
Ich holte tief Luft. »Das ist echt eine Bildungslücke, meine Liebe. August der Starke war ein Sachsenkönig aus dem 17. Jahrhundert, der mindestens zweihundertfünfzig Kinder hatte«, klärte ich sie auf. »Er war dicker als Ottfried Fischer, sein Ego war größer als das von Dieter Bohlen und er hatte mehr Frauen als Udo Jürgens.« Ich ließ dabei wohlweislich unerwähnt, dass er in allen Büchern als »schön wie Apollo, stark wie Herkules, geil wie ein Satyr und gefährlich wie Jupiter« beschrieben wurde, sonst würde sie ihn nur wieder mit Christoph vergleichen und sofort schlechte Laune bekommen.
Bettina war deshalb nicht beeindruckt. »Klingt ziemlich krank, der Gute. Wieso interessierst du dich auf einmal für den?«
Ich zögerte. »Weil er ...«, fing ich an und wusste plötzlich nicht mehr weiter. »Weil er einfach ein toller Mann gewesen ist. Und weil es solche Männer wie ihn nicht mehr gibt.«
»So einen Freak findest du toll?« Ich hörte, wie sie die Musik lauter stellte, ihre Lieblingsgruppe Rosenstolz sang: »Die Liebe ist tot.« Dann sagte sie: »Ich finde, dein August klingt wie ein übersexualisiertes Dummtier, das sein Leben nur mit Fressen und Ficken, Tschuldigung, verbracht hat. So viele Kinder! Der Potenzprotz des Spätbarocks!« Sie lachte.
Aus mir selbst unerklärlichen Gründen wurde ich mit einem Mal richtig wütend. »Wenn du in der Schule ein bisschen besser in Geschichte aufgepasst hättest, dann wüsstest du, dass August der Starke sowohl den Zwinger als auch diverse Schlösser gebaut hat, dass er die Künste und Wissenschaften gefördert ...«
»Schon gut, meine Süße, wieso regst du dich denn so auf? Hör mal hin, meine Lieblingsstelle.« Sie drehte Rosenstolz lauter. »Ich bin noch da, meine Liebe ist noch längst nicht tot, noch längst nicht tot ...«
Ich saß an meinem Küchentisch und trank meinen kalt gewordenen Tee. Ohne jede Vorwarnung überschwemmte mich ein Gefühl von großer, tiefer Wehmut. So stark war es, dass ich den Hörer an mein Ohr presste und dem Text lauschte: »Meine Liebe ist noch längst nicht tot, noch längst nicht tot ...«
Liebe. Ich spürte sie wie eine heiße Welle, vom Kopf bis zu den Zehenspitzen, es war ein fremdes, ein überwältigendes Gefühl, das mir Angst machte. Weil ich eines plötzlich wusste – so heiß, so leidenschaftlich hatte ich noch nie geliebt. Jedenfalls nicht in diesem Leben. Jedenfalls nicht den Mann, der dieses Leben mit mir teilte. Für diesen Mann in diesem Leben war das Gefühl, das mich gerade durchströmte, ein paar Nummern zu groß. Meine Liebe zu Richard war wie eine Pfütze, und was ich gerade empfand, war wie ein Ozean.
Ein Gedanke schwirrte mir im Kopf herum: Liebte ich meinen Mann zu wenig? War ich trotzdem zu einer Liebe fähig, die ich gar nicht nutzte?
Die ich vielleicht früher genutzt hatte? In einem anderen Leben?
»Alles wird wieder gut, ich bin noch da«, sang Rosenstolz.
»Bist du noch dran?«, fragte Bettina, ihre Stimme kam wie aus einer anderen Welt.
»Dreh mal bitte die Musik leiser«, sagte ich. »Sonst kann ich mich nicht auf das Menü konzentrieren.«
»Ich komm vorbei«, sagte sie. »Du klingst so merkwürdig. Außerdem ist mir gerade langweilig.«
Ich legte auf und versuchte, dieses seltsame Gefühl von Sehnsucht in mir abzuschütteln, das sich da auf einmal in mir festgebissen hatte. Das konnte ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Aber ich war so versunken und mit mir selbst beschäftigt, dass ich, was selten vorkam, keinen Gedanken an meine Familie verschwendete. Was gut war, denn hätte ich in diesem Moment hellsehen können, wäre ich vermutlich ausgerastet.
Doch ich ahnte nicht, dass genau in diesem Moment mein Mann alles andere als mit mir beschäftigt war, Friederike in der Raucherecke ihrer Schule ihre dritte Zigarette rauchte und meine Jüngste gerade ihr Diktat verpatzte, weil sie Wahrheit ohne h schrieb.
Wenig später riss ich das Küchenfenster auf und lächelte Bettina zu, die mir entgegenkam. Sie grinste und hielt eine Pralinenschachtel in der Hand, die ich sofort wiedererkannte, weil ich sie ihr selbst zum letzten Muttertag geschenkt hatte. Sogar die Schleife war noch unversehrt.
»Haben wir beide uns eigentlich vorhin über einen Mann gestritten, der bereits 1733 gestorben ist und der seine Geliebte Constantia ... Mensch, die heißt ja wie du! So ein Zufall.«
Ja, stimmte ich zu, wirklich ein Zufall. Über den ich mir allerdings noch nie Gedanken gemacht hatte. »Woher weißt du das plötzlich alles?«, fragte ich stattdessen.
»Hast eben meine Neugierde geweckt. Wann schwärmst du denn schon mal von einem anderen Mann als deinem Richard? Also hab ich kurz im Internet nachgesehen«, berichtete Bettina stolz. »Wollte wissen, was mir entgeht. Ein geiler Typ, dein August. Davon könnte sich mein Christoph ruhig mal eine Scheibe abschneiden.«
»Ja, August war ein wunderbarer Mann«, sagte ich, und da war es auf einmal wieder, dieses unbeschreibliche Gefühl, das ich mir nicht erklären konnte. Es war, als würde ganz tief in mir drin eine kleine Glocke klingeln. Hörst du mich? Bist du bereit? Ich will dir etwas Wichtiges sagen. Etwas, das dein Leben verändern wird.
Wollte ich es hören?
»Geil, aber grausam«, grinste Bettina. «Schließlich hat er diese Constantia fünfzig Jahre in ein Burgverlies gesperrt und sie dort verrecken lassen.«
»Neunundvierzig Jahre«, korrigierte ich, so als wäre es wichtig, dieses eine Jahr weniger. Doch ich hatte das Bedürfnis, den Bösewicht, den ich nicht böse fand, zu entlasten.
»Na gut, dann eben neunundvierzig Jahre. Das reicht ja wohl, oder? Was für ein Mensch war sie überhaupt, diese Gräfin Cosel? Klingt ein bisschen nach Frau, die zu sehr liebt, oder?« Bettina schnaubte, denn sie gehörte ganz sicher nicht zu diesen Frauen. Dazu war sie viel zu praktisch. Das war die Cosel allerdings auch. Für die damalige Zeit war sie ein richtiges Superweib. Ihre Mutter Anna Margerethe hatte ihr Branntweinbrennen, Bierbrauen und Kräuterkunde beigebracht, mit vierzehn Jahren war sie bereits so reif, dass man sie an den Königshof schicken konnte, damit sie dort »die feine Lebensart« erlernte. Als Hoffräulein auf Gut Gottorf wusste sie die zickige Prinzessin Sophie Amalie bei Laune zu halten. Sie überwachte die Kammerzofen, sorgte dafür, dass die Hofschneider die prunkvollen Gewänder in Ordnung hielten, das Silbergeschirr immer blank geputzt war und die Speisen in der richtigen Reihenfolge serviert wurden. Dazwischen hatte die junge Constantia viel Zeit, um zu reiten, zu fechten und den jungen Männern den Kopf zu verdrehen. Tja, und dann blieb auf einmal ihr »monatliches Blut« weg, wie man es damals schamhaft ausdrückte, ihr Bauch wölbte sich, der Hof tuschelte, wer war wohl der Vater?
»Connie, wo bist du?« Bettina wedelte mir mit den Händen vorm Gesicht herum. »Vergiss jetzt mal die Gräfin, die muss wirklich schwer einen an der Waffel gehabt haben. Zum Glück ist das nicht unser Problem.« Sie lachte und reichte mir die Pralinenschachtel. »Statt Honorar, mein Herz, ganz frisch aus der Schokoladenfabrik.«
Ich sagte erst mal nichts, weil ich sie nicht in Verlegenheit bringen wollte, dann konnte ich mir die beiläufige Bemerkung »Witzig, genau so eine hab ich dir zum letzten Muttertag geschenkt« doch nicht verkneifen.
Sie verzog keine Miene. »Und dieser August muss ein Herz aus Stein gehabt haben«, lenkte sie schnell ab.
»Er wird schon seine Gründe gehabt haben«, entflutschte es mir zu meinem eigenen Erstaunen. Ich verspürte tatsächlich Verständnis dafür, dass er die große Liebe seines Lebens einfach eingekerkert hatte. »Sie hat ihn ja auch aufs äußerste provoziert.«
»Ist sie fremdgegangen?«, wollte Bettina wissen.
»Sie hat nie einen anderen Mann auch nur angesehen«, sagte ich. »Aber sie hat ihm nicht gehorcht. Sie war einfach zu aufmüpfig.«
»Das ist ja wohl kein Grund, eine Frau lebenslänglich hinter Kerkermauern dahinvegetieren zu lassen«, regte Bettina sich auf. »Ich denke, du bist emanzipiert. Dabei bist du vermutlich nur ein Königsgroupie, das auf eine goldene Krone und ein paar Glitzersteine abfährt. Ein Weib, das gern an der Macht schnuppert. Gib es zu.« Sie grinste.
Sicher meinte sie es nicht so, doch ihre Bemerkung ärgerte mich. Ich wusste, dass sie dieses Thema nicht ernst nahm, aber für mich war es auf eine Weise wichtig, die ich leider nicht mit ihr teilen konnte. Tatsache ist, ich war der totale Geschichtsfan, seit meiner Schulzeit war ich von vergangenen Zeiten fasziniert, und seit ein paar Monaten begeisterte mich vor allem der Spätbarock.
»Mami schwelgt wieder in Gold und Glitzer«, frotzelten meine Töchter immer, wenn ich mich wieder mal in einen alten Geschichtsschmöker vertieft hatte.
»Vermutlich, weil ich die Gegenwart nicht besonders glanzvoll finde«, antwortete ich dann. »Oder habt ihr ausnahmsweise mal selbst eure Zimmer aufgeräumt?« Was an meinen wohlerzogenen Töchtern natürlich abperlte wie Öl von der Regenhaut.
»Ich gebe gar nichts zu«, erwiderte ich deshalb so heftig, dass mich Bettina ganz erstaunt ansah. »Weil du keine Ahnung hast, was für eine tolle Zeit der Spätbarock gewesen ist.«
»Schon gut, ich glaub dir ja«, sagte sie beschwichtigend. »Reg dich bloß nicht auf. Dein August war der Größte.«
»Und ob er das war, meine Liebe. Er war der Sonnenkönig von Sachsen und Warschau, von 1670 bis 1733 der absolute Superstar, Brad Pitt und Robbie Williams in einer Person. Er lebte in vierundzwanzig Schlössern, feierte rauschende Feste mit seinem Volk. Er hatte ein Prunkbett mit einem Baldachin, der aus zwei Millionen kostbaren Federn bestand. Kein Mann der kleinen Gesten, kein Ehemann mit Reihenhaus, kein Korinthenkacker.«
»Willst du damit etwa auf meinen Herrn Gemahl anspielen, nur weil er unseren Hochzeitstag vergessen hat?«, seufzte Bettina.
Ich beschloss, das Thema zu wechseln. Was ging uns August der Starke an? »Ich kann dir natürlich auch ein italienisches Buffet zaubern«, sagte ich und stopfte mir eine Praline in den Mund, wobei ich unerwähnt ließ, dass die Schokolade inzwischen hellgrau geworden war. »Oder ein syrisches. Ich habe nur das Lieblingsessen von August dem Starken für etwas ganz Besonderes gehalten. So besonders wie dein Christoph. Natürlich trotzdem in keiner Weise vergleichbar.« Schleim, schleim.
Bettina schüttelte den Kopf. »Du bist ja richtig besessen von diesem Mann. Hast du mal was mit dem gehabt, in einem anderen Leben vielleicht – Constantia?« Sie kannte natürlich mein Faible für das Thema Seelenwanderung und hatte mich schon oft damit aufgezogen. »Was war ich denn früher, Meerschweinchen oder Kleopatra?«, frotzelte sie gern.
Ich verzichtete inzwischen darauf, ihr immer wieder zu erklären, dass die Seelenwanderung laut Lehrbuch meistens eine Kurve nach oben nimmt, also von Mücke zu Pferd zu Mensch zu König wandert und nicht umgekehrt. Ich hielt es in dieser Frage mit dem Hinduismus und glaubte, dass alles, was ich tat, und jeder Gedanke Spuren auf meiner Seele hinterließ. Böse Menschen haben deshalb schwarze Seelen, gute Menschen weiße. Meine Seelenfarbe schätzte ich auf mittel- bis dunkelgrau, je nach Tagesform. In Indien würde man meine Leiche nach Puri bringen, einem Wallfahrtsort am Meer, wo Tag und Nacht Bestattungsfeuer lodern. Falls Richard mein trauernder Witwer wäre, würde er Holz aufschichten, mich darauf betten und anzünden. Meine Asche würde zum Kosmos zurückkehren – der Körper zur Erde, das Blut zum Wasser, der Atem zum Wind, das Sehvermögen zur Sonne, der Verstand zum Mond.
Ich fand, das klang wunderschön.
Wenn die Hitze groß genug wäre, würde mein Schädel platzen und meine Seele freigeben. Falls nicht, würde ihr Richard mit einem kleinen Beil zur Freiheit verhelfen. Und wohin sie dann flog, meine Seele, hatte ich im Grunde selbst in der Hand. War mein Leben gut und richtig, so suchte sie sich ein höheres Wesen aus oder einen (noch) besseren Menschen, war es schlecht, so landete sie in einem Warzenschwein oder in einem Kaktus und müsste sich wieder hocharbeiten. Ich glaubte daran, dass jeder sein künftiges Schicksal beeinflussen und für eine gute Wiedergeburt sorgen konnte. Deswegen bemühte ich mich, in diesem Leben besonders nett zu sein. Nichts gegen Warzenschweine, aber Mensch zu sein war einfach spannender, als sich im Wildpark »Schwarze Berge« von den Besuchern mit Trockenfutter voll stopfen zu lassen.
Leider wusste man nicht, wer man früher einmal gewesen war oder später einmal sein würde. Die Seele befand sich im Hier und Jetzt und verriet weder, woher sie kam, noch wohin sie ging.
»Vielleicht hatte ich tatsächlich mal eine Affäre mit August dem Starken«, sinnierte ich, und je länger ich darüber nachdachte, desto anregender erschien mir diese Vorstellung. Mein Typ wäre er durchaus gewesen. Ich mochte Männer, die wie echte Kerle aussahen. Metrosexuell war bereits ein Schimpfwort für mich, als sich David Beckham noch mit blonden Strähnchen und Lipgloss auf dem Fußballplatz wälzte. Ich war nun mal altmodisch und mochte es lieber, wenn ein Mann nach frischem Schweiß duftete und nicht nach Faltencreme und Haarwuchsmittel. Und August war so richtig nach meinem Frauenherzen. Ein Mannsbild durch und durch: groß, breitschultrig und – ganz wichtig – er trug keine dieser schrecklichen Lockenperücken, die zu seiner Zeit so beliebt waren und jeden Mann aussehen ließen wie einen albernen Pudel. Sein Haar, so zeigte jedes Gemälde von ihm, war dunkelbraun, dicht und lockig, die Augenbrauen kräftig, das Kinn markant. Deswegen hieß er ja auch August der Starke und nicht August die Trichterbrust.
»Also, von der Bettkante geschubst hätte ich ihn mit Sicherheit nicht«, sagte ich. »Meiner Meinung nach hat er was. Ganz eindeutig. Was denkst du?«
Bettina lachte. »Nee, nicht mein Fall. Ich mag diese schwule spätbarocke Mode nicht. Ein Mann in Seidenstrümpfen und Schnallenschuhen ist nichts für mich. Ein Kerl muss die Hosen anhaben.«
Wir lachten.
Wir liebten es, zu sündigen, wild und verrucht zu sein – natürlich nur in unserer Phantasie.
Vor ein paar Tagen hatten wir uns ausgemalt, wie es wohl in einem Harem wäre. Ein großer Palast, in jedem Zimmer eine Frau und am Abend kommt der Scheich vorbei und wählt sich eine Gefährtin für die Nacht.
»Würdest du mit August fremdgehen, wenn er heutzutage leben würde?«, fragte Bettina an diesem unschuldigen Septembermorgen, griff sich eine Praline und spuckte sie diskret in ihr Taschentuch, das sie anschließend auf meiner Küchenbank vergessen würde. »Wenn er jetzt vor dir stehen und dich auf seinen starken Armen ins Schlafzimmer tragen ...«
»Hör auf! Ja, vielleicht.« Ich musste grinsen. »Ich bin sicher, dass er ein guter Liebhaber war. Sieh dir nur mal seine dicke, lange Nase an, die sagt doch alles.«
»Glaubst du, dass August ein besserer Liebhaber war als Richard?«
Ich überlegte.
Besser als mein Ehemann? Der leider schon eine klitzekleine Tendenz zur Drittelglatze hatte? Eine Zeit lang kämmte er sein Resthaar sogar quer, bis ich es ihm strikt verbot. Aber immer wenn ich überlegte: »Na ja, so ganz der Traumprinz ist er auch nicht mehr«, dann dachte ich weiter: Bin ich denn noch die Prinzessin? Teile ich noch das Rote Meer, wenn ich ein Restaurant betrete? Habe ich es je geteilt? Na also. Sei dankbar, dass du ihn hast, meine Liebe, rief ich mich dann zur Besinnung. Jede zweite Frau über vierzig hat keinen Mann, kriegt scharfe Frustfalten um den Mund und knutscht ihre Katze.
»Männer wie August den Starken gibt es nicht mehr, die sind genauso ausgestorben wie Frottee, Trockenpulver und Laufmaschendienste«, beendete ich das Thema. »Was also soll ich denn nun für Christoph, den zweitbesten aller Ehemänner, kochen: italienisch oder syrisch?«
»Italienisch«, beschloss Bettina. »Wie du weißt, ist Christoph auf kulinarischem Gebiet ein bisschen konservativ. Leider nicht nur da«, fügte sie schnell hinzu, vermutlich, weil ihr wieder einfiel, dass sie mir mal erzählt hatte, er halte Oralsex für Sex mit Zahnpasta. »Und mach die Antipasti nicht zu fettig. Wir kommen langsam in das Alter, in dem wir auf unsere Gesundheit achten müssen.«
»Antipasti ohne Öl ist wie Apfelkuchen ohne Sahne«, widersprach ich. »Fang jetzt bloß nicht auch noch mit diesem neumodischen Gesundheitsgefasel an. Im Spätbarock haben die Leute auch gegessen, was ihnen geschmeckt hat. Da gab es noch gar kein Cholesterin.«
»Dafür lagen sie spätestens mit fünfzig in der Kiste«, lachte Bettina. »Hab ich auch aus dem Internet. Und dein August ist zwar dreiundsechzig geworden, aber der Gute war zum Schluss so zuckerkrank, dass er kaum noch laufen konnte. Ein paar Zehen ...«
»... mussten ihm amputiert werden, das weiß ich doch«, fiel ich ihr, schärfer als nötig, ins Wort, was wahrscheinlich daran lag, dass ich diese Vorstellung unappetitlich fand und das Gespräch jetzt ganz dringend beenden wollte. Der Wochenmarkt rief, ich musste Gemüse für die Antipasti und Wein einkaufen, Mittagessen für die Kinder kochen, Wäsche bügeln. Der Tag brüllte mir ein lautes »Komm in Wallung, Constanze« entgegen.
»Vielen Dank für die Pralinen«, sagte ich deshalb und schob meine Freundin zur Tür hinaus. »Beim nächsten Mal will ich dann aber ein paar Scheinchen sehen.«
Ich sah ihr nach und stellte fest, dass der Himmel noch immer unverschämt blau war. Sogar ein paar Schäfchenwolken glaubte ich zu erspähen. Ein richtig schöner Tag, dabei war gar nichts Besonderes passiert. Nur ein bisschen Sex mit dem eigenen Ehemann. Doch es reichte, um meine Laune zu heben. Nicht die heiße Nummer machte mich glücklich, denn so heiß war sie nicht gewesen, sondern das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, das nur Richard in mir auslösen konnte. Bevor mein zärtliches Gefühl für ihn nachließ, rief ich ihn an und sprach auf seine Mailbox: »Es war sehr schön mit dir, mein Schatz, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag in Berlin. Ruf mich an, wenn du im Hotel bist.« Zum Abschluss setzte ich noch ein kicherndes »Tu nichts, was ich nicht auch tun würde« hinzu.
Zehn Stunden später, kurz vor Mitternacht
Himmlische Ruhe. Keine dröhnenden »Suckmydickcunt«-Rapbässe aus Friederikes, kein Jeanette-Biedermann-Gedudel aus Alexas Zimmer. Die schönste Zeit des Tages. Meine Töchter lagen im Bett, Alexa schlief, Fiete telefonierte noch und würde am nächsten Morgen, wenn ich sie wecken wollte, im Koma liegen und sich weigern aufzustehen. Sicher würde sie wieder zu spät in die Schule kommen und ich müsste einen ärgerlichen Brief ihres Klassenlehrers unterschreiben. Auf jeden Fall würde sie, nachdem sie aus dem Bett getaumelt war, und zwar egal, wie spät es schon wäre, zum Föhn greifen und sich die Haare kaputtföhnen. Sie hatte dicke, dunkle Locken, wollte aber lieber wie Jenny Elvers-Elbertzhagen aussehen. Danach würde sie, egal, wie kalt es draußen war, halb nackt das Haus verlassen wollen. Und ich würde etwas von »Nierenbeckenentzündung, wenn du so weitermachst« zetern, und sie würde »Mama, ich weiß, was ich tue« zurückzetern und damit wäre die Diskussion dann beendet.
Der liebe Gott hatte mich nun einmal friedlich konzipiert, denn als er Streitsucht und Aggression verteilte, schubste mich jemand aus der Schlange. Vermutlich war ich in meinem letzten Leben eine bisexuelle Meuchelmörderin und sollte in diesem für meine Sünden büßen.
Ich lächelte und holte das abgegriffene Gedichtbändchen des Mystikers Djalal al Din Rumi aus dem dreizehnten Jahrhundert heraus. Seit Wochen trug ich es in meiner Handtasche neben losen Tampons, Lippenstiften und Zitronendrops mit mir herum. Nun schlug ich es auf und las darin:
Ich starb als Stein und wurde eine Pflanze.
Ich starb als Tier und ward ein Mensch.
Warum sollte ich mich fürchten?
Hat der Tod mich je vermindert?
Einmal noch als Mensch werde ich sterben, um emporzufliegen
mit den seligen Engeln; sogar das Engelhafte
werde ich aber verlassen müssen.
Alles vergeht außer Gott.
Wenn ich meine Engelsseele geopfert habe,
werde ich das werden, was kein Mensch je erkannt hat.
Oh, lass mich nicht sein! Denn Nichtsein verkündet:
Zu ihm werden wir zurückkehren!
Es war eins meiner Lieblingsgedichte, ich fand es sehr tröstlich und schön. Und ich glaubte jedes Wort.
Das Telefon riss mich aus meinen Gedanken.
»Hallo, mein Schatz, keine Panik, aber ich hatte einen kleinen Blechunfall ...«
Als ich drei Minuten später auflegte, musste ich lächeln, denn weil Richard so flüsterte, hatte ich »Brechdurchfall« verstanden und ihm warme Cola aus der Minibar empfohlen. Er war fast beleidigt, weil er dachte, ich veräppele ihn. Also entschuldigte ich mich und flüsterte: »Hab dich lieb, mein Schnulli« – mein üblicher Telefonabschied.
Eigentlich sagte er dann immer: »Ich dich auch, mein ebenfalls Schnulli.« Das Wort Liebe ging ihm irgendwie ganz schlecht über die Lippen. Aber ich wusste ja auch so, dass er es tat. An diesem Abend murmelte er jedoch nur: »Hmmm, okay. Schlaf gut«, und legte auf.
Ich schlüpfte in mein Bett, das ich am Morgen frisch bezogen hatte, weil es für mich nichts Schöneres gab, als an einem Kopfkissen zu schnüffeln, das nach Wäschesteife und Waschpulver riecht. Frische Bettwäsche ist die Erotik der müden Hausfrau. Außerdem ist sie total beruhigend, wenn man alleine schläft. Was ich gern tat. Und Richard nie sagen würde, denn er hielt getrennte Schlafzimmer für den Anfang vom Ende. Warum eigentlich? Keiner schnarchte, keiner schwitzte, keiner fühlte sich gestört, wenn ich mit meinen Büchern raschelte, denn ohne zu lesen konnte ich nicht einschlafen. Ich verschlang fast alles, was sich zwischen zwei Buchdeckel pressen lässt: Kitschromane, Krimis, Biographien.
Im Augenblick war ich völlig hingerissen von dem historischen Roman Gräfin Cosel über meine Namensschwester Anna Constantia von Brockdorff, die von 1680 bis 1765 gelebt hatte. Was für ein Leben, was für eine Liebe, was für ein Schicksal!
Dagegen war mein eigenes kleines Leben so langweilig wie ein Wartezimmer ohne Lesemappe. Reihenhaus, Ehemann, Urlaub immer auf Mallorca oder in Dänemark. Doch die Cosel!
Sie heiratete blitzschnell einen alten, fiesen, aber reichen Knacker, verliebte sich in August, ließ sich für ihn scheiden und wurde seine »Königin zur Linken«, wie man damals die königlichen Mätressen nannte. Er überhäufte sie mit Geld, Gold und Grundbesitz, acht Jahre lang, bis er sie unter Hausarrest stellte, auf der Flucht abfing und in den feuchten Turm der Burg Stolpen einschloss. Weil sie zu aufmüpfig wurde und ihr Liebster sie irgendwann zu anstrengend fand. Außerdem hatte er natürlich längst eine Neue. Die natürlich jünger, blonder und blöder war als sie.
Aber Constantia hatte nie aufgehört, ihn zu lieben. Als ihr Liebster zweiunddreißig Jahre vor ihr starb, ohne sie ein einziges Mal in ihrem Turm besucht zu haben, da trug sie Witwenkleidung. Liebe oder Schwachsinn?
Wenn Richard mich auch nur eine Stunde in unseren Keller sperren würde, wären wir geschiedene Leute. Andere Zeiten, andere Lieben, dachte ich, sank in meine nach Pfirsich-Weichspülung duftenden Kissen zurück und fing an zu lesen:
Anna starrte ihn an und fand keine Worte. »Hört zu, Gnädigste«, fuhr August fort und warf den Sack Gold mit solchem Schwung hin, dass er aufplatzte und die Dukaten klirrend über den Fußboden rollten. »Ich kann Euch mit Gold überhäufen, mit Würden und Titeln.« Dabei zog er zwei Hufeisen hervor, brach sie in den Händen auseinander und schleuderte die Stückchen auf den Goldhaufen. »Ich kann aber das«, fügte er hinzu, »was sich mir widersetzt, zermalmen wie dieses Eisen.«
Ich klappte das Buch zu und schlug die Bettdecke zurück. Warm wurde mir auf einmal, richtig heiß. Mir war, als würden mir die Gefühle aus dem Buch direkt unter die Haut schlüpfen. Was für eine Wucht, was für eine Leidenschaft! Mein Körper kribbelte, wie von tausend Schmetterlingsflügeln berührt.
Auf meinem Nachttisch klingelte das Telefon. Ich griff danach und stellte fest, dass ich eine Gänsehaut auf den Armen hatte.
»Warum flüsterst du?«, fragte ich, als ich die krächzige Stimme meines Mannes erkannte. »Geht’s dir wieder besser?«
Als ich nach ein paar Minuten auflegte, schickte ich ihm zärtliche Gedanken durch die Leitung. Er hatte mir nur noch einmal Gute Nacht sagen wollen. Was für ein lieber Mann! Kein starker August, kein Mann, der Hufeisen zerbrechen oder mich mit Gold überhäufen konnte, aber einer, der nachts in seinem Hotelbett keine Pornos anschaute, sondern seine Ehefrau anrief. Einer, der mir nicht die Sterne vom Himmel holte, dafür jedoch die Selterskisten aus dem Keller. Jedenfalls, wenn ich lange genug nervte. Oder mit Sexentzug drohte. Mit einem Lächeln auf den Lippen schlief ich ein.
Hamburg, 24. September 2005
»Was ist los, mein Schatz? Kopfschmerzen nach dem Blechunfall?« Ich war ganz die liebevoll besorgte Ehefrau, als ich meinem Göttergatten die obere Brötchenhälfte mit Butter und Honig bestrich und ihm den Teller direkt unter die Nase schob. Die untere Hälfte aß ich selbst, obwohl ich die obere auch lieber mochte, doch er sah so gramzerfurcht aus an diesem Morgen, dass ich ihm dieses kleine Opfer gern brachte. »Ich muss am Wochenende ganz überraschend nach Dresden«, seufzte er. »Ein Kongress, den ich leider nicht absagen kann.«
»Das ist doch super«, freute ich mich. »Um die Mädchen kann sich Mami kümmern, dann komme ich mit und absolviere das Damenprogramm. Und abends lassen wir beide es dann mal so richtig krachen. Sex im Hotel macht mich immer besonders scharf.«
Stille. Mein Süßer räusperte sich und zog die Stirn in Dackelfalten, während sein Kiefer malmte, wie immer, wenn er nachzudenken schien. Er fühlte sich offensichtlich unwohl, nur warum? War es ihm peinlich, dass ich am Frühstückstisch von Sex sprach? Aber dafür war seine Reaktion ein bisschen heftig. Sein Gesicht glühte, leichter Schweiß trat ihm auf die Stirn, zu allem Elend verschluckte er sich auch noch und prustete halbnasse Honigbrötchenkrümel über den Tisch. Einer traf unsere Älteste am Hals.
»Igitt, Papa, voll der Ekel«, kreischte Fieti, während sie über den Tisch zu dem Käsebrötchen griff, das ich ihr gerade in Butterbrotpapier einwickeln wollte. »Hat hier mal jemand am Tisch ein paar Euro für eine arme Schülerin? Ich brauche dringend neue Ohrringe.«
Sie trug genau das, was ich ihr streng verboten hatte. Rock in höchstens Gürtellänge, Bauchregion total nackt, dafür geschminkt bis unter die Haarwurzeln. Sie ahnte nicht, wie sehr mir die Hand juckte. Ich musste sie richtig festhalten, damit sie mir nicht ausrutschte und als fette Backpfeife in ihrem Gesicht landete. Reste meiner alten Seele als Meuchelmörderin? Eher normaler Mutterfrust.
»Geht’s noch ein bisschen langsamer?«, sagte sie, während sie das Brötchen wieder auswickelte und mit einem genervten »Von dem Käse krieg ich Pickel« auf den Tisch zurücklegte. Ich hielt meine Hand so fest, dass es wehtat.
Richard, der seine Tochter wie die meisten Väter noch immer für eine kleine, süße Prinzessin hielt, griff in die Hosentasche und holte einen Zehneuroschein heraus.
Blitzschnell schnappte sie ihm den Schein aus den Fingern. »Danke, mein allerliebster Papi, der allerbeste von der ganzen Welt«, flötete sie, und ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen, verschwand sie. Ihre Hormone, die man regelrecht dampfen sah, schwebten wie eine rosa Wolke hinter ihr her.
»Weißt du noch, wie niedlich sie mal war?« Meine Stimme klang genauso nostalgisch, wie ich mich fühlte.
»Das ist sie doch immer noch«, meinte Richard. »Ich weiß wirklich nicht, warum du immer so zickig bist.«
Ich schwieg. Jedes Wort von mir war jetzt sinnlos.
»Also, was Dresden angeht«, fuhr er fort. »Ich hätte dich natürlich sehr gern dabei, das weißt du, aber es gibt diesmal kein Damenprogramm, ein Vortrag jagt den anderen, langweilig wird’s werden. Komm lieber beim nächsten Mal mit.« Ehe ich erwidern konnte, dass ich mich sehr gut allein in Dresden zu beschäftigen wisse, klingelte das Telefon.
»Familie Graf«, meldete ich mich, obwohl ich, wie meine oberschlaue älteste Tochter mir jedes Mal erklärte, ja gar keine Familie war, sondern nur eine Einzelperson, aber ich fand es netter so. »Familie Graf«, wiederholte ich, weil ich nichts hörte. Klack, aufgelegt. »Deine Geliebte«, grinste ich, »du sollst sie zurückrufen.«
»Zu witzig«, sagte er, und seine Stimme klang leicht genervt.
»Verstehst du denn keinen Spaß?«, fragte ich.
»Doch«, murmelte er. »Sagt eine Frau zum Gynäkologen:
›Ich hab einen Knoten in der Brust.‹ – ›Wer tut denn so was?‹, erwidert der Arzt. Komisch, oder?«
»Darüber macht man keine Witze«, fauchte ich.
Eine Sekunde später läutete es wieder. Ich nahm den Hörer ab und sagte nichts. Irgendwie fühlte ich Richards Blick, und ich hätte schwören können, dass er etwas Lauerndes hatte. Ich sah Gespenster, aber welche?
»Wer ist denn da?« Bettinas Stimme klang supergestresst, im Hintergrund hörte ich die streitenden Quietschstimmen ihrer sechsjährigen Zwillinge, die sie der Einfachheit halber Lea und Leander genannt hatte. Wenn sie also »Lea, Lea, sofort aufhören!« kreischte, dann fühlten sich stets beide angesprochen.
»Ganz ruhig, Bettina.« Es war so laut, dass ich den Hörer auf Abstand hielt. »Deine Geburtstagsplatten sind so gut wie fertig, dein Wein wird geliefert, alles easy, entspann dich. Wie fühlt es sich denn an, mit einem alten Sack von vierzig das Ehebett zu teilen? Was hast du ihm geschenkt?«
Wie die meisten Ehemänner ist nämlich auch Christoph extrem schwierig zu beschenken. SOS – Socken, Oberhemden, Schlipse – kaufte Bettina ihm sowieso, sonst würde er vermutlich nur noch in Cordhosen und Holzfällerhemden herumlaufen. Seine Spielsachen für den spätberufenen Heimwerker (Bohrer, Kreissäge) besorgte er dagegen selbst, um sie dann doch nie zu benutzen. Aber er saß gern vor männlichen Geräten, nahm sie auseinander und streichelte sie. Bücher las er grundsätzlich nicht, obwohl, als sie sich kennen lernten, »Die Entdeckung der Langsamkeit« von Sten Nadolny auf seinem Nachttisch lag und das Lesezeichen irgendwo im ersten Kapitel steckte. Da steckte es dann zehn Jahre später immer noch.
»Ich schenke ihm ein Romantikwochenende auf Rügen«, seufzte sie. »Wenn wir jemanden finden, der uns die Brut abnimmt.« Sie schwieg bedeutungsschwer, doch ich reagierte nicht.
Lealea war eine extrem anstrengende Combo, und wenn sie zu Besuch waren, blieb kein Auge trocken und kein Stein auf dem anderen. »Monsterduo« nannte ich sie heimlich, nachdem die beiden mir in einem unbeobachteten Moment alle Lippenstifte abgeknickt hatten und ich ihnen dafür leider nicht die Hälse umdrehen konnte.
»Meine Mutter ist zur Kur«, sagte Bettina, »und meine Schwiegermutter kennst du ja.«
O ja, eine enkelungeeignetere Oma als die lebenslustige Gertrud Gärtner, die nach dem Tod ihres Mannes jeden Tag mehr aufblühte, war undenkbar.
»Neuer Lover?«, fragte ich und schwor mir, nicht weich zu werden.
»Ist es nicht unglaublich?«, seufzte Bettina.
»Wie viele Jahre jünger diesmal?«
»So um die dreißig«, sagte sie. »Deshalb hat sie sich wieder Fett absaugen lassen und jetzt geht es ihr nicht so gut.«
»Hat sie doch schon dreimal.« Ich konnte es nicht fassen, Gertrud war zweiundsiebzig.
»Sie ist süchtig nach ihrem früheren Selbst«, seufzte Bettina.
»Danach will sie ihre Implantate auswechseln lassen. Eine Nummer größer. Bitte, Connie, bitte, bitte, bitte.«
»Nein«, sagte ich, »auf keinen Fall.«
Als ich auflegte, hatte sie ihre Satanszwillinge für eins der nächsten Wochenenden auf mich abgewälzt, außerdem hatte ich ihr versprochen, bereits am Nachmittag zu kommen, um ihr bei den Vorbereitungen für die Geburtstagsparty zu helfen. War ich denn bescheuert? Ja, eindeutig. Dabei war es erst 7.45 Uhr.
»Mama, ist mein Nutellabrötchen fertig?« Das war Alexa, und ehe ihr Vater sich darüber aufregen konnte, dass sie frühmorgens nicht an einer Tofusprosse kaute, biss sie ins Brötchen, warf uns eine Kusshand zu und war verschwunden.
»Wissen unsere Kinder eigentlich, was Vitamine sind?«, fragte Richard, und als ich ihn gerade darauf hinweisen wollte, dass er selbst auch lieber Schokoladeneis mit Sahne als getrocknete Apfelringe mit Hirseflocken aß, klingelte sein Handy. Und klingelte. Ein vorwurfsvolles Klingeln.
Er blickte auf sein Display, runzelte leicht die Stirn und steckte es in die Tasche.
»Willst du nicht rangehen?«, fragte ich erstaunt. »Es könnte doch ein Kunde sein. Ein Millionenauftrag könnte dir durch die Lappen gehen.«
»Nee, das ist nur dieser nervige Apotheker aus Hannover«, sagte er lässig. »Bekomme ich noch einen Kaffee, mein Zuckerapfel?«
Ich mochte es, wenn er mir blöde Kosenamen gab, Mäuseschnäuzchen war mein Favorit. Daher fragte ich nicht weiter nach, sondern griff zur Kaffeekanne und bediente ihn.
»Bettina schenkt Christoph ein Romantikwochenende auf Rügen«, verkündete ich und biss in den kleinen Brötchenrest, den meine Familie mir übrig gelassen hatte. »Wäre doch auch für uns eine gute Idee.«
Mein Süßer grummelte in die Zeitung und sagte nichts, vermutlich gruselte es ihn hinterm Sportteil.
»Wir könnten einen Tag eher nach Dresden fahren«, schlug ich vor. »Nur wir beide. Wie früher. Was meinst du?«
Er meinte gar nichts, legte die Zeitung weg und stand auf.
Seine Körpersprache war irgendwie verdächtig.
Sein abgewandter Blick, als er aufstand und an mir vorbei aus der Küche ging. Sein gemurmeltes »Nun sei nicht sauer, Tintenfischchen, beim nächsten Mal nehm ich dich wieder mit«, als er seine Aktentasche unter den Arm klemmte. Es konnte ihm auf einmal gar nicht schnell genug gehen. Stress im Job, Beginn der männlichen Menopause? Denkbar war alles.
Tintenfischchen war neu, vermutlich lenkte mich das ab und stimmte mich wieder so sanft, dass ich ihn zur Wohnungstür begleitete, mich auf die Zehenspitzen reckte (Richard war 1,88 Meter lang, ich war eine Lineallänge kürzer), ihn auf die Wange küsste, ihm »Sei heute Abend bitte pünktlich, die Feier fängt um sieben an« mit auf den Weg gab und mich dann mit dem Schlachtruf »Na, du Schlampe, jetzt wirst du aufgeräumt« meinem Haus widmete. Das glich nach dem Verlassen meiner Lieben nämlich einer Verkehrskreuzung, auf der es zu einer Massenkarambolage gekommen war.
Während ich also meiner Familie liebevolle Gedanken hinterherschickte, vermutlich, weil sie mich in den nächsten Stunden nicht ärgern konnte, klingelte das Telefon zum dritten Mal an diesem Morgen. Ich stolperte über das Staubsaugerkabel, knallte auf die Tischkante, riss den Hörer hoch, hörte wieder Atmen und brüllte: »Falls dies ein schweinischer Anruf ist, dann nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass ich erstens sehr glücklich verheiratet bin und deshalb zweitens sexuell nicht unbefriedigt. Bitte rufen Sie doch woanders an, wenn Sie einen Triebstau haben.«
Ich knallte den Hörer auf und war hochzufrieden mit mir.
Das hatte gesessen!
Ich legte eine Reggae-CD von Bob Marley auf. »I wanna love you and treat you right, every day and every night.« Mit Schwung tanzte ich durch die Wohnung, hob Fietis herumliegende BHs und Tangas vom Boden auf, stellte in Alexas Kinderzimmer alle Plüschtiere auf ihrem Hochbett in Positur, leerte sämtliche Hosen- und Jackentaschen meines Mannes und wunderte mich kurz, dass sie bis auf ein Taschentuch alle leer waren.
Normalerweise fischte ich immer haufenweise Parktickets und Lokalrechnungen heraus, mein Mann war offensichtlich auf seine alten Tage ordentlich geworden, wie schön.
Nachdem das Haus wieder bewohnbar aussah, holte ich die Platten für die Antipasti zu Christophs vierzigstem Geburtstag aus dem Keller. Sie waren mir wirklich besonders gut gelungen, stellte ich zufrieden fest, nachdem ich alles vom Auberginenpüree bis zum Vitello Tonnato einmal durchprobiert hatte. Die eingelegten Paprika mit Frischkäsefüllung schmeckten wahrhaft köstlich, aber die Lachsrouladen mit Pesto waren auch nicht von schlechten Eltern.
Ich liebte Essen, ganz besonders mein selbstgekochtes. Vielleicht sollte ich es auch mal mit Fettabsaugen probieren, das Röllchen um meine Taille war mir irgendwie ein bisschen zu anhänglich geworden. War mein Körper nicht in der letzten Zeit, ohne meine Einwilligung, zu einer Art birnenförmigem Wäschesack mutiert? Immer weiter südwärts gewandert, ohne meine Einwilligung? Aber Richard liebte jedes Pfund an mir, das hatte er mir jedenfalls glaubhaft versichert, als er mich bei meiner letzten kritischen Bestandsaufnahme vor dem Spiegel erwischt hatte. Und wer, wenn nicht mein eigener Ehemann, konnte das schließlich beurteilen?
12.15 Uhr
Mein Haus sah aus wie neu, ein Zustand, der sich, eine Minute nachdem meine Töchter nach Hause gekommen wären, blitzschnell ins Gegenteil verwandeln würde. Aber noch waren die Zimmer jungfräulich, die Stille umfing mich wie ein Streicheln, und ich beschloss, mich mit einem halben Lesestündchen zu belohnen.
Dazu gönnte ich mir einen Milchkaffee mit fettarmer Milch und Süßstofftablette, ein Getränk mit so gut wie Minuskalorien, weshalb ich mir dazu ein Stückchen Pflaumenkuchen aufwärmte, weil Obst auch so gut wie keine Kalorien hat. Die Gräfin Cosel lockte. Ich schlug das Buch auf, suchte meine Seite, lehnte mich zurück und versank in einer fernen Welt:
»Ihre Bindung zum König wurde umso fester, als zwei Töchter zur Welt kamen. Selbstbewusst meinte die Dame, eine ihresgleichen fände August nie und nimmer. Sie allein sei imstande, alle seine Freuden zu teilen und weder vor Schüssen, waghalsigen Ritten noch vor Zeltlagern zurückzuschrecken.
Und dennoch hatte das Herz sie während ihres Warschauer Aufenthaltes nicht umsonst gewarnt, betrogen zu werden. Der König war, unter Vorwänden ihr fernbleibend, mit der Tochter einer französischen Geschäftsfrau ein Verhältnis eingegangen, in deren Laden die Offiziere Wein trinken kamen. Als sie davon erfuhr, drohte ihm Anna mit der Pistole. Der König lachte dazu, küsste ihr die Hand und erwirkte Vergebung. Und er mochte sie trotz seiner Seitensprünge wahrhaftig, von allen Mätressen war sie ihm die liebste, sie allein wusste ihn immer wieder aufzurichten, mit ihr allein war er glücklich.«i
Ich klappte das Buch zu und war auf einmal so tief enttäuscht von August, dass ich meine Verärgerung bis in die Haarwurzeln spürte. Warum regte ich mich so auf? Vermutlich war es seinerzeit völlig normal, wenn Männer permanent fremdgingen. Alice Schwarzer hatte damals ja noch gar nicht gelebt, um die Frauen daran zu erinnern, dass sie auch ein paar Rechte hatten.
Außerdem war August der Starke der absolute Superstar des Spätbarocks. Zar Peter, der schwedische Karl XII., Friedrich der Große – alle waren sie Waisenknaben gegen ihn, kein anderer Monarch konnte ihm, was Kriegs- und Abenteuerlust, was Charme und Sexappeal anging, das Wasser reichen. Klar, dass er viele Groupies hatte. Klar, dass er sich die Frauen nahm, wie sie sich ihm anboten. Hätte ich sicher auch gemacht, wenn ich in einem meiner letzten Leben August gewesen wäre.
Trotzdem war mir auf einmal die Lust am Weiterlesen vergangen. Ich fühlte mich so traurig, als hätte er mich betrogen. Mit einem Mal spürte ich die Verzweiflung der Gräfin, ihre wütende Ohnmacht bis in den hintersten Winkel meiner Seele. Ein grauenhaftes Gefühl von Verrat, von dem Mann, den man liebte und der einen wiederliebte, betrogen zu werden.
Warum braucht er andere Frauen, wir sind doch so glücklich, dachte ich. Reiche ich dir nicht, August? Bin ich nicht die Schönste und auch Klügste im ganzen Land?
Ich zuckte zusammen. Mein Arm war feucht. Ich hatte die Kaffeetasse beim Lesen schräg gehalten und die lauwarme Brühe war über meinen Arm geschwappt. Der Alltag hatte mich wieder, ich rief mich zur Ordnung.