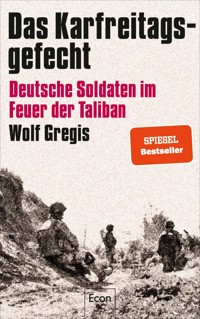
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine wahre Geschichte über Mut und Kameradschaft, Versagen und Verzweiflung, Triumph und Trauer Das verlustreichste Gefecht in der Geschichte der Bundeswehr fand am Karfreitag, dem 2. April 2010, bei Kunduz statt. Deutsche Soldaten gerieten in einen Hinterhalt und kämpften mehr als acht Stunden gegen eine Überzahl von Taliban. Drei Soldaten fielen, fünf wurden verwundet, sechs afghanische Soldaten kamen durch »friendly fire« der Deutschen ums Leben. Zwei Tage später benutzte der damalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg zum ersten Mal die Worte »Krieg in Afghanistan«. Wolf Gregis hat in zahllosen Gesprächen, aus Bildern, Videos und Dokumenten erstmals die Geschichte des bedeutendsten Gefechts der Bundeswehr im Detail rekonstruiert und erzählt sie hautnah aus den unterschiedlichen Perspektiven der Beteiligten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Karfreitagsgefecht
Wolf Gregis, geboren 1981, absolvierte eine Offiziersausbildung bei der Bundeswehr und diente 2008/2009 im Auslandseinsatz in Afghanistan. Er studierte Germanistik, Geschichte, Bildungswissenschaften und Kommunikationswissenschaften. Als Lehrer unterrichtet Wolf Gregis Deutsch und Geschichte an einem Rostocker Gymnasium.2022 begründet er mit Helm ab – Ein Veteranencast den größten nicht-institutionellen Podcast zu den Themen Bundeswehr, Soldaten und Veteranen in Deutschland. Darüber hinaus macht er in verschiedenen Medienkampagnen wie #20JahreDesinteresse auf die Lage deutscher Veteranen aufmerksam.
Das Karfreitagsgefecht. Deutsche Soldaten im Feuer der Taliban erzählt erstmals vollständig die Ereignisse jenes Frühlingstages in Kunduz. In 24 Interviews hat Wolf Gregis 70 Stunden Audiomaterial zusammengetragen, zahllose Originalvideos, -bilder und -dokumente aus Afghanistan gesichtet. Er hat alle Erlebnisschilderungen miteinander abgeglichen, durch öffentliche Dokumente angereichert und den wahrscheinlichsten Ablauf des Gefechts rekonstruiert. In diesem Buch verwebt er das gesammelte Material zu einer zusammenhängenden und mitreißenden Erzählung dieses Gefechts, das über die Bundeswehr hinaus einen besonderen Stellenwert eingenommen hat. Der Leser begleitet die deutschen Soldaten durch die schwerste Prüfung ihres Lebens und erlebt hautnah mit ihnen Vorahnungen, Überforderung, Fehlentscheidungen, Aussichtlosigkeit, aber auch Kameradschaft, Hoffnung, Mut, Triumph und Trauer.
Wolf Gregis
Das Karfreitagsgefecht
Deutsche Soldaten im Feuer der Taliban
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© 2025 Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 BerlinAlle Rechte vorbehalten, insbesondere und ausdrücklich die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG.Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]: Christian Seeger, BerlinCovergestaltung: Grafik-Design Büro Morian & Bayer-Eynck, Coesfeld – unter Verwendung eines Fotos von Markus GötzKarten: © Peter Palm, BerlinAutorenfoto: © Frank TaszarekE-Book powered by pepyrusISBN: 978-3-8437-3537-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Kapitel 1»Das Scheißding kommt mit zurück.«
Kapitel 2»Wir müssen hier weg.«
Kapitel 3»Sieht ziemlich übel aus.«
Kapitel 4»Aufsitzen!«
Kapitel 5»Naef, bist du noch bei uns?«
Kapitel 6»Was?! Da vorne seid ihr?«
Kapitel 7»Ich halte die Stellung!«
Kapitel 8»Du sorgst dafür, dass er überlebt!«
Kapitel 9»Holen Sie die da raus.«
Kapitel 10»Hoch! Hoch! Hoch!«
Kapitel 11»Hier kommen wir nicht mehr raus.«
Kapitel 12»Komm, halt durch. Du schaffst das.«
Kapitel 13»Schmeißt endlich die Bombe!«
Kapitel 14»Wir haben hier noch einen gefunden.«
Kapitel 15»Lasst uns irgendwie helfen!«
Kapitel 16»Wir können den Dingo bergen.«
Kapitel 17»Ich halte die Stellung weiter.«
Kapitel 18»Das wird uns mindestens ein Jahr kosten.«
Kapitel 19»Ihr habt keine Schuld.«
Kapitel 20»Morgen fliegt der General nach Kunduz. Kümmern Sie sich.«
Kapitel 21»Versprich mir das, Mario.«
Epilog
Anhang
Quellenverzeichnis
Hauptbeteiligte und ihre Zuordnung
Glossar
Karten
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Motto
»Zu erinnern und zu mahnen ist kein Widerspruch.«
Oberfeldwebel Bongi
Prolog
Flammen lodern auf. Dunkelgrauer Qualm schlägt der Kamera entgegen. Die Videoqualität ist schlecht: pixelig und verwackelt. Von einer veralteten Kamera aufgenommen oder Abertausende Mal ins Internet hochgeladen, konvertiert, runtergerechnet und weitergeschickt. Doch die Flammen sind deutlich zu erkennen. Sie fressen an einem schwarzen Klotz in zwanzig Meter Entfernung. Dürre Weiden behindern die Sicht, aber die lodernden Feuerzungen vor, hinter, unter und in dem übermannshohen Koloss zeichnen sich klar ab. Ihr roter Widerschein flackert und leuchtet den grauen Untergrund hell aus. Der Wind treibt dunklen Rauch und schwarzen Ruß vor sich her, bläst ihn über den sandigen Boden und zwischen engen Lehmmauern hindurch dem Kameramann entgegen.
Der Mann ist aufgeregt. Er hastet dem brennenden Koloss entgegen. Sein Atem geht stoßweise, während er das Objektiv auf die Flammen richtet. Die Kamera schwenkt im Takt seiner Schritte nach rechts, als würde ein Bein bei jedem Schritt einknicken. Der Mann keucht in die Kamera. Er schiebt sich nach vorne, so schnell es irgend geht. Der kastenförmige Brandherd ist sein Ziel, die Kamera sein Auge. Er ruft: »Allahu Akbar!« Allah ist größer. Und er ist nicht alleine. Man hört andere: »Allahu Akbar!« Einmal. Zweimal. Immer wieder.
Aus dem Qualm vor ihnen schält sich ein Fahrzeug, über zweieinhalb Meter hoch. Ein mächtiger Kasten. Flammen schlagen aus allen Türen, aus dem Fahrzeugboden, dem Heck. Ein Gummireifen brennt, schmilzt, tropft auf den Boden. Die Stimme haucht ehrfürchtig: »Mashallah, Mashallah.« Wie Allah wollte.
Der Kameramann erreicht das Heck des Fahrzeugs, filmt dessen rechte Seite. Metallplatten und stählerne Blenden liegen verstreut herum, durch ungeheure Kräfte abgesprengt. Die massive Motorhaube hat der Druck nach vorne weggeklappt, die Seitentüren herausgerissen. Das Erdreich auf der Beifahrerseite ist aufgewühlt. Der überhohe Vorderreifen steckt in einem Sprengtrichter fest. Er ist bis über die Felge im Sandboden versunken, als hätte sich der tonnenschwere Koloss aus voller Fahrt stürzend ins Erdreich gegraben. Seine Silhouette ist nun unverkennbar. Mit schwerer Schlagseite, aufgesprengt und ausgebrannt ist hier ein dreizehn Tonnen schwerer Dingo zu Fall gekommen. Das seitlich aufgebrachte Eiserne Kreuz ist längst den Flammen zum Opfer gefallen, aber es besteht kein Zweifel: Hier brennt ein deutsches Fahrzeug.
Die Kamera bleibt stehen und zoomt ins Innere. Der Brand hat nur ein schwarzes Loch hinterlassen. Qualm quillt daraus hervor. Dann umkreist die Kamera das Fahrzeug. Von vorne sind die Schäden noch deutlicher sichtbar. Aus jedem Riss, jedem Stahlplattenstoß, jeder Panzerniete steigt Rauch auf. Aus dem Motorraum quellen Schläuche und Riemen wie Eingeweide.
Immer mehr Männerstimmen sind zu hören. Sie überschlagen und vermischen sich. »Alhamdulillah! Alhamdulillah!« Allah sei Dank. »Mashallah, Mashallah. Alhamdulillah.« Menschen treten ins Bild. Kämpfer mit dunkler Haut, in langen Hemden und weiten Hosen. Sie schultern russische Granatwerfer und Kalaschnikows über ihren Kampfwesten und langen Gewändern. Manche haben ihre Kopfbedeckung abgenommen und pressen sie ehrfürchtig gegen die Brust. Andere reiben ihre Kopftücher und starren in die Flammen. Wieder andere begutachten die Metallteile am Boden. Einer der bärtigen Männer, mit Brille, Kalaschnikow und Kampfweste, ganz in schwarz und mit weißem Kopftuch, lächelt freundlich in die Kamera. Sein Daumen geht nach oben.
Schnitt.
Die Kamera hält auf eine Blutlache am Boden. Dunkelrot ist sie, fast braun. Sie scheint zu glänzen, als ob sie noch feucht wäre. Über einen halben Meter misst sie, Liter müssen geflossen sein. An drei Rändern ist die Lache zertreten. Stiefel haben kleine Äste und Zweige in das Blut getragen. Nur an einer Seite gibt es einen geraden Verlauf. Dort muss der Blutende gelegen haben. Die Kamera schwenkt den Boden ab. Männer in schwarzen Lederschuhen oder Sandalen treten gegen weiche Klumpen im Sand. Ausrüstungsteile? Uniformfetzen? Fleischbrocken? Die Kamera schwenkt und zoomt zu schnell. Der Mann ist zu aufgeregt. Schwarz-braune Klumpen überall.
Schnitt.
Ein Mann in langem, dunkelgrünem Gewand und beigen Sandalen stellt eine leere Munitionskiste aufrecht hin. Sie sieht unbeschädigt aus. Weitere Kämpfer stellen sich um sie herum wie um eine Stele, während die Kamera heranfährt. Orangefarbene Gefahrenzeichen weisen darauf hin: Hiermit wurde ein todbringender Inhalt transportiert.
Schnitt.
Ein Junge, etwa vierzehn Jahre alt, nähert sich von rechts. Zwischen den Bäumen tritt er mit einem Gegenstand in den Händen hervor, der durch die Bildpixel kaum zu erkennen ist. Auch er ist aufgeregt. Die ersten Schritte springt er fast heran. Ein Stolpern, dann fängt er sich. Eine gestickte weiße Kappe sitzt gerade auf seinem Kopf. Das Tuch um seine Schultern ist ordentlich gebunden. Er weiß: Was er gefunden hat, ist von großer Symbolkraft. Der Junge verleiht dem Moment die größtmögliche Würde. Stolz trägt er in seinen Händen einen Helm heran. Die Form ist unverkennbar, die schmale Krempe, die Weitung an den Ohren, der Nackenschutz: der Gefechtshelm M92 der Bundeswehr. Mit Schlämmkreide getarnt in den Farben des afghanischen Sandes. Der Rand über dem linken Auge ist abgestoßen. Unter der Kreide kommt das Olivgrün zum Vorschein, das man zu Hause trägt, in Deutschland, auf dem Exerzierplatz und der Standortschießanlage, überstrichen mit der Farbe des Hindukusch.
Der Mann mit den beigen Sandalen greift nach dem Helm, reißt ihn dem Jungen fast aus den Händen und setzt ihn auf die Munitionskiste. Dann dreht er die Rückseite des Helms in die Kamera. Wo er rechts unversehrt scheint, ziehen sich links Kampfspuren von der Höhe des Auges über die Schläfe seitwärts bis zum Nacken. Zwischen Ohr und Nacken ist der Helm aufgebrochen. Von oben nach unten zieht sich ein langer Riss, gelbes Kevlar bricht daraus hervor. Wie Dämmwolle, verrußt und dreckig. Was immer diesen Helm getroffen hat, ungeheure Kräfte haben sein Inneres nach außen gestülpt.
Die Kamera zoomt an Helm und Munitionskiste heran und verharrt. Männer stehen um die Stele herum. Auch sie verharren. Musik wird eingespielt, blecherne orientalische Klänge. Ein Wummern setzt im Hintergrund ein und drückt auf die Ohren. Der Motor eines schweren Diesels? Rotorengeräusche? Das Feuern von großkalibrigen Waffen?
Dann wird das Talibanvideo schwarz ausgeblendet. Es ist der 2. April 2010. 17:33 Uhr. Karfreitag.
Kapitel 1»Das Scheißding kommt mit zurück.«
Die Suche nach der verlorenen Drohne
Karfreitag, 2. April 2010, gegen 12:00 Uhr, am Rand des Vororts von Isa Khel.
Naef kämpfte am Bediengerät. Eine Windböe hatte die Drohne erfasst. Jetzt verlor er die Kontrolle. Wie hoch sie flog, wo genau sie gerade in der Luft schwirrte, er wusste es nicht mit Sicherheit. Er spürte nur: Sie entglitt ihm. Nicht einmal in welche Richtung, konnte er sagen.
Es war sein erster Einsatz der Mikado in Afghanistan. Der Lehrgang lag Monate zurück, geübt hatte er zu Hause nicht. Anderes hatte Vorrang, es ging immerhin nach Afghanistan. Auch für ihn zum ersten Mal. Kämpfen, Schießen, Sanität, das hatte Vorrang. Im Frühjahr 2010 in den Einsatz nach Kunduz zu gehen, bedeutete für eine Fallschirmjägerkompanie eines sicher: Feindkontakt.
Und jetzt entglitt ihm die Drohne. Über Isa Khel im Chahar Darreh. Ausgerechnet Isa Khel. Darauf hatte er sich nicht vorbereitet.
Naef ruckte an den Steuerhebeln, suchte nach markanten Geländepunkten, doch mit der Videobrille auf dem Kopf hatte er die Orientierung schon verloren. Ohne Übung verlor man leicht die Übersicht, vor allem, was den eigenen Standort betraf. Was die Drohne sah, sah man auch, aber wo stand man im Verhältnis zur Drohne, wenn sie sich drehte? Die Übertragung war spiegelverkehrt, und schon dreißig Grad Hitze in der Mittagssonne machten dem sensiblen System zu schaffen. Es war für Mitteleuropa konstruiert worden. Schwarz-weiß flimmerte die Übertragung auf Naefs Netzhaut: ein stakkatoartiges und unregelmäßiges Zucken auf und ab, dass einem schlecht werden konnte. Ein abgehacktes Rucken bei jeder Lenkbewegung, sodass das Gehirn die Informationen aus Auge und Gleichgewichtsnerv nur schwer abstimmen konnte. Naef drohte ins Wanken zu geraten. Farbschlieren behinderten die Sicht, zogen sich quer durchs Bild, als hätte man zu lange in die Sonne gestarrt. Aber Naef gab nicht auf. Auch nicht gegen den Wind.
Die 1300 Gramm leichte Drohne rang mit dem schweren afghanischen Wind. Vom Hindukusch im Süden fegte er durch das fruchtbare Tal des Kunduz River. Er trug den Staub und Sand des Landes durch die zwölf Kilometer breite Oase zwischen den Hängen der Ost- und Westplatte hindurch wie durch einen Windkanal. Und jetzt hatte er die Mikado-Drohne erfasst. Die vier kleinen Elektromotoren hatten ihm nichts entgegenzusetzen. Naef spürte, wie die Drohne den Kampf verlor.
Der Oberfeldwebel zog die Videobrille vom Kopf und blinzelte. Die Farbe kehrte zurück in seine Augen. Vor ihm erstreckten sich linker Hand grüne Felder bis zum Fluss. Es war April, der Weizen in seiner Schossphase stand bereits kniehoch. In schmalen Streifen von oft kaum hundert Meter Länge reihte sich Parzelle an Parzelle. Baumreihen markierten die Bewässerungsgräben dazwischen. Jene zerschnitten das Gelände, machten es unübersichtlich. Die Gräben machten es gefährlich. Manche waren über zwei Meter tief, selbst Riesen wie Naef, den nur drei Zentimeter von der Zwei-Meter-Marke trennten, konnten in ihnen verschwinden. Ganze Kompanien hätte man darin unbemerkt verschieben können. Auf ihren nächtlichen Streifen rund um die befestigten Höhen 431 und 432 hatten seine Kameraden die Gräben oft genug selbst genutzt. Der Feind tat es auch.
Der ruhte noch in Isa Khel. Zumindest war es ruhig an diesem Freitagmittag. Für die Afghanen war der Freitag, was der Sonntag für Christen war: ein heiliger Tag. Die Ortschaft lag vor Naef, aber kaum etwas bewegte sich. Wahrscheinlich waren alle noch zu Hause. Nicht, dass er viel vom Ort hätte sehen können. Lehmmauern versperrten den Blick auf den Ortskern von Isa Khel. Er stand hier am Rand eines namenlosen Vororts. Vierhundert Meter in der Länge, einhundert in der Breite lag er wie ein mittelalterliches Torhaus vor der Kreuzung in den Hauptort. Wie dieser war er drei Meter hoch ummauert.
Wenn die Afghanen Grundstücke absteckten, pflanzten sie Bäume und ließen sie jahrelang wachsen. Sie hatten Zeit. Wenn die Setzlinge groß und stark genug, aber noch biegsam waren, beschnitten sie die Äste und nutzten sie als natürliche Bewehrung für den Lehm, den sie Schicht um Schicht auftrugen. Am Ende stand eine massive Compoundmauer, ein meterdickes Bollwerk. Jedes Dorf eine Festung aus Mauern und labyrinthischen Gassen: schmal, unübersichtlich, jede Bewegung kanalisierend. Ausweichmöglichkeiten gab es nicht.
Deshalb hatte Naef die Mikado hier gestartet. Er war das Auge seiner Kompanie. Die schwere Infanteriekompanie schob sich in seinem Rücken, vierhundert Meter entfernt, Meter um Meter voran. Belgische Kampfmittelräumer und deutsche Pioniere suchten die Straße Little Pluto Richtung Süden nach Sprengfallen ab. Die Little Pluto galt als Hauptschlagader des Distrikts. Wer sie beherrschte, beherrschte den Distrikt. Naefs Zug aus Seedorf, der nach dem NATO-Alphabet Golf genannt wurde, sicherte die Belgier bei der Räumung. Zwei Schützenpanzer Marder aus dem Hotel-Zug der Panzergrenadiere aus Oberviechtach schepperten in Schrittgeschwindigkeit hinterher und überwachten das Vorfeld. Die schweren 20-Millimeter-Bordmaschinenkanonen schwenkten das Gelände ab. Wo das Rasseln der Panzerketten zu hören war, zeigte sich kein Feind. Dem Schnellfeuer der 20-Millimeter-Kanonen war kein Taliban gewachsen.
Nur der Foxtrot-Zug blieb außen vor. Wieder einmal. Ein Teil war zwei Kilometer entfernt auf der Höhe 431 abgestellt und beobachtete die schläfrige afghanische Landschaft. Der andere Teil saß siebenhundert Meter entfernt auf der Höhe 432 und starrte auf die Felder im Westen.
Die Kompanie hatte die Höhe 432 vor zwei Wochen in mehrtägigen Kämpfen genommen und angefangen, sich dort einzugraben. Schanzen spart Blut, lautete seit jeher eine Soldatenweisheit. Der Hügel war der am weitesten vorgeschobene Posten der internationalen Schutztruppe im Unruhedistrikt Chahar Darreh, ein Combat Outpost im Indianerland, wie man hier sagte. Schon lange hatte sich niemand mehr weiter nach Süden gewagt. Aus gutem Grund. Wo sich die Straße aus Isa Khel mit der Little Pluto kreuzte, begann das Talibangebiet. Feindesland. Ihre Hochburgen lagen dort: Isa Khel und Quatliam. Jeder wusste das. Aber heute rollte die 1. Infanteriekompanie in ihren Vorgarten.
»Wo geht es hier zur Feuereröffnungslinie?«, hatten die jungen Männer nach ihrer Ankunft in Kunduz gescherzt. Seitdem hatten sie den Grenzstein Meter um Meter nach vorn gesetzt. Fallschirmjäger und Panzergrenadiere – mehr Kampfkraft konnte man in einer Infanteriekompanie nicht vereinen. Und heute drangen sie wieder ins Talibangebiet ein.
Hauptfeldwebel Nils Bruns hatte sich frühzeitig mit den zwei Gruppen seiner Oberfeldwebel Naef Adebahr und Stefan Rindfleisch, den alle nur Fleesch nannten, von der Hauptkolonne getrennt. Über einen schmalen Umgehungsweg waren sie an den Rand des Vororts vorgestoßen. Sie konnten sich nicht sicher sein, ob der Weg frei von improvisierten Sprengfallen war, aber dass die Einheimischen ihn ebenfalls nutzten, war ein gutes Zeichen. Seiner Kompanie vorgelagert, hatte Naef die Mikado aufgebaut und gestartet. Frühzeitig Feindbewegungen aufzuklären, war sein Auftrag. Alles wie geplant. Aber dann verlor er die Kontrolle über die Drohne.
Naef suchte mit bloßem Auge den Himmel ab. Es war mittags, und die Sonne stand hoch. Zwar bedeckten Wolken den Himmel wie eine blaugraue Tapete, aber die Temperaturen begannen trotzdem zu drücken. Gestern waren sie schon auf 43 Grad geklettert. Die Wolken heute boten kaum Linderung. Aber sie waren trotzdem Naefs Glück. Gegen die grelle afghanische Sonne hätte er nichts gesehen.
Wo war die Mikado? Eine schwarzgrüne Drohne mit einem Körper von nicht einmal zwanzig Zentimetern Durchmesser. Den sie umgebenden dünnen Drahtring hätte er auf die Entfernung sowieso nicht gesehen. Fünfhundert Meter Reichweite sollte sie mindestens haben, tausend nach Herstellerangaben. Unter diesen Witterungsbedingungen schaffte sie vielleicht dreihundert oder vierhundert. Naef scannte den Himmel ab.
Da entdeckte er die Mikado im Osten, geradewegs hinter dem Vorort. Sie trudelte bereits abwärts. Naef lehnte sich nach hinten und schlug die Joysticks am Bediengerät hart an, aber das Funksignal war längst abgerissen. Wie sehr er auch zog, die Drohne war verloren. Der Wind drückte sie zu Boden. Jenseits einer Baumreihe in vierhundert Meter Entfernung ging sie nieder. Wo genau, konnte er nicht erkennen. Zweiundzwanzigtausend Euro, aber keine automatische Rückholfunktion. Einfach abgestürzt.
Naef drehte sich zur Straße in seinem Rücken. Die Kompanie schob sich in der Ferne langsam voran. Ein IED-Sweep war Puzzlearbeit. Eine Ostereisuche nach Sprengsätzen. Der Wind wehte das Grummeln der Marder-Motoren herüber. Irgendwo in der Kolonne rückte auch Mario Kunert vor.
»Golf, hier Whity«, funkte Naef seinen Zugführer an, »die Mikado ist abgestürzt. Ich wiederhole, die Mikado ist abgestürzt.«
Keine Reaktion.
Naef schaute zu seinem stellvertretenden Zugführer hinüber, etwa hundert Meter entfernt. Nils richtete sich auf und sah zu Naef. Der Funk blieb still. Naef warf einen Blick auf seine Männer. Alle hielten ihre Beobachtungsbereiche ein. Da setzte er sich in Bewegung und meldete Nils den Absturz.
»Wo ist das Ding runtergegangen?«
»Hinter der Baumreihe. Fünfhundert Meter vielleicht.«
Endlich rauschte der Funk. Aus dem SEM 52 schnarrte Marios Stimme: »Whity, weißt du, wo das Ding liegt?«
»Grob«, antwortete Naef. »In dem Bereich hinter dem Vorort. Hinter einer Baumreihe. Fünfhundert Meter vielleicht.«
Stille.
Nils und Naef warfen einen Blick die Straße Richtung Isa Khel hinunter. Links begrenzten sie die hohen Mauern des Vororts. Strommasten spannten Leitungen darüber. Rechts des Sandwegs standen Pappeln aufgereiht. Sie waren hoch und dicht gewachsen und bildeten eine Art natürliche Leitplanke. Hinter ihnen fiel die Straße steil in einen vollen Wassergraben ab. Ein bis zwei Meter breit, verlief er neben der Straße wie ein Burggraben. Auf dessen anderer Seite wuchs eine weitere Baumreihe empor. Eine halbhohe Mauer trennte den Graben von den Feldern dahinter. Es gab keine Ausweichmöglichkeiten: links unüberwindbare Mauern, rechts ein unüberwindbarer Graben. Nicht mal ein Dingo oder Marder hätten hier rechts oder links durchbrechen können.
Irgendwo voraus, hinter vierhundert Metern geschlängelter Straße, musste sich das Feld öffnen, auf das die Drohne gestürzt war. Offenes Gelände zwischen Isa Khel und dem Vorort. Aber so weit war noch niemand vorgedrungen.
Der Funk rauschte. Ihr Zugführer meldete sich zurück: »Whity, stell eine Gruppe für die Suche zusammen. Versuch, das Ding zurückzuholen.«
Maik Mutschke hockte südlich des Vororts in Stellung, gut hundert Meter von Nils und Naef entfernt. Der Stabsgefreite hatte sich eingerichtet, um die Ackerstreifen vor ihm zu überwachen. Auf seinem Arm ruhte das G3 mit Zielfernrohr. Nach den ersten Gefechten 2008 im urbanen Gelände hatten einige Bundeswehr-Einheiten angefangen, die alten Sturmgewehre aus den Depots anzufordern. Das neuere G36 war handlich, leicht, präzise, aber unterkalibrig. Mit 5,56 Millimetern war gegen einen Gegner hinter afghanischen Compoundmauern nichts auszurichten. Da mussten schwerere Waffen her. Die Kampfeinheiten setzten Zielfernrohre auf das G3 und erhöhten damit nicht nur die Reichweite, sondern auch die ballistischen Reserven ihrer Züge. Maik war nicht nur der Nahsicherer für seinen Oberfeldwebel Fleesch, sondern auch der Marksman der Gruppe. Als er sechzehn war, hatte ihn die Bundeswehr noch abgelehnt. Er war zu jung. Erst nach seiner Lehre als Kfz-Mechaniker nahm sie ihn. Heute war er einer der Besten.
Und jetzt beobachtete der Brandenburger mit einem Sturmgewehr in der Hand afghanische Felder bei Isa Khel. 23 Jahre war er alt. Eine Baumreihe durchschnitt die Äcker vor ihm. Vor zwei Wochen hatten sie von dort Feuer bekommen. Aber heute war alles ruhig. Kaum jemand war zu sehen. Mal ein einzelner Bauer, der sein Feld kontrollierte, aber sonst niemand.
»Maiki!«
Maik drehte sich um. Sein Gruppenführer Fleesch schritt von hinten auf ihn zu. Der kantig geschnittene Vollbart und sein mit Nebelgranaten, Magazinen, Mehrzwecktaschen und Funkgerät prall gefüllter Chest-Rig-Brustgurt gaben ihm ein bedrohliches Aussehen. Er hatte sich nicht etwa für ein Einsatz-Selfie so zurechtgemacht. »Afghanistan Fighter« stand auf dem Patch auf seinem rechten Oberarm. Er trug ihn zu Recht. Er war nicht zum ersten Mal am Hindukusch.
»Maiki, pack mal dein Zeug zusammen. Du gehst jetzt zu Whity und unterstützt ihn bei der Suche.«
Die Hauptgefreiten Jan Nillies und Alex Kania hockten auf der anderen Seite des Vororts in Stellung und beobachteten nach Nordosten. Vor ihnen lag eine sechs Meter tiefe Senke, durchzogen von Baumreihen und Gräben. Auf der anderen Seite begrenzten die Bäume wie ein Vorhang ihre Sicht. Irgendwo dahinter war die Drohne niedergegangen.
»Nillies«, beorderte Fleesch auch Jan heran. »Du gehst auch nach vorne zu Naef. Er stellt einen Spähtrupp zusammen. Ihr sollt die Drohne holen. Du gehst als Sani mit.« Jan zuckte mit den Achseln, richtete sich auf und trottete mit Fleesch zurück. Er war der Sani, einer der beiden Sanitäter. Hauptfeldwebel Rönckendorf war sein Vorgesetzter. Ihr Kraftfahrer hatte sich vor dem Einsatz ein Bein gebrochen, jetzt liefen die beiden ohne Fahrzeug mit.
Es war nicht leicht für Jan. Er trug das bordeauxrote Barett, kam aber aus dem Sanitätszug. »Du bist kein Springer. Du bist kein Falli«, hatten die Mannschafter der Kampfkompanie zu ihm gesagt. Und meinten: »Du bist kein richtiger Soldat.« Jan hatte es so hingenommen. Er war der Sani, er spielte sich nicht auf, er lief mit. Oft ohne zu wissen, wo er war. Es war ihm egal. Er wurde gerufen, wenn er gebraucht wurde. Bei dem Gefecht vor zwei Wochen war er nicht gefordert worden. Die Kompanie hatte es taktisch überlegen geführt und die Höhe 432 ohne Gefallene und Verwundete genommen. Seitdem hatte der Brustumfang der Männer deutlich zugenommen.
Hauptfeldwebel Ralf »Ralle« Rönckendorf und er hatten sich nach diesem Gefecht auf die Golf-Halbzüge aufgeteilt. Das hielten sie für klüger, nachdem während des Gefechts die ersten RPG-Granaten über ihre Köpfe hinweggezischt und hinter ihnen auf dem Acker explodiert waren. Damit nicht beide mit einem Treffer ausgeschaltet werden konnten. Erst im Februar, im Vorgängerkontingent, hatte es einen Sanitäter erwischt. Als eine Granate über ihm explodierte, schützte ihn nur der Gefechtshelm vor dem tödlichen Schrapnell-Regen. Der Rest ging ins Fleisch. Granaten unterscheiden nicht zwischen Sanitäter und Kämpfer.
Jan sammelte sich mit den anderen bei Hauptfeldwebel Nils Bruns an der letzten Mauerecke vor dem Vorort. Mit fünf Soldaten würde Oberfeldwebel Naef Adebahr den Vorort passieren und nach der Drohne suchen. Darunter Maik Mutschke, Jan Nillies und Hauptgefreiter Martin Augustyniak. Martin war mit fast dreißig Jahren nicht nur älter als die anderen Mannschafter, er war auch größer als meisten. Selbst als die meisten Fallschirmjäger. Irgendetwas zwischen Maschine und Bär. Kaum zu glauben, dass er ein guter Tänzer war. Er war ein gern gesehener Soldat im Golf-Zug.
Martin leckte sich die Unterlippe. Ein kleiner blutiger Cut durchzog sie. Bei der Annäherung an den Vorort hatte er sich die Panzerfaust dagegen geschlagen. »Das fängt ja schon mal gut an«, hatte Jan ihm zugezwinkert, aber Martin hatte das beiseitegewischt.
Naef meldete sich mit seiner Gruppe Richtung Isa Khel ab. Sechs Soldaten in Schützenreihe, um die Mikado zu suchen. Ihr Gruppenführer hielt das Bediengerät in den Händen. Er musste nur das Signal finden, die Drohne holen und wieder zurückkehren.
Die Temperaturen stiegen weiter. Von den warmen Böen, die die Mikado abgetrieben hatten, war hier unten nichts zu spüren. Mauern und Bäume riegelten den sandigen Boden an den Seiten und nach oben hin ab. Das machte es erträglich.
Zwei Pkw mochten einander auf der schmalen Straße gerade so passieren können. Die Dingos und Transportpanzer der Kompanie konnten es auf keinen Fall. Für sie war es eine Einbahnstraße. Ganz zu schweigen von den Mardern.
Nach vierhundert Metern erreichten sie das Ende des Vororts, und das Gelände öffnete sich. Die Straße mündete in eine Kreuzung. Hier ging es nach Norden, wo in zweihundert Metern weitere Gehöfte lagen, nach Osten und Süden. Ostwärts geradeaus ging es in den Kern Isa Khels. Dazwischen lag das Drohnenfeld.
»Kack Drohne«, sagte Naef und überblickte das Gelände. Er schaute nach Norden, wo die Birken- oder Pappelreihe stand, hinter der die Mikado niedergegangen war. Von hier aus sah das Gelände ganz anders aus als aus der Luft. Wo konnte das Teil nur liegen? Der Oberfeldwebel stand am Rand der ihm bekannten Welt.
Ihr Kompaniechef war nach dem letzten Gefecht im März zur Gesprächsaufklärung in den Vorort eingerückt. Die vordersten Teile der Sicherung hatten hier an dieser Kreuzung gelegen. Niemand in der Kompanie war je weiter vorgedrungen. Niemand von den letzten Kontingenten der Schutztruppe überhaupt. Das hier war kein Indianerland mehr, das hier war Feindesland. Selbst beim Ausweichen waren sie das letzte Mal noch beschossen worden.
»Was nun?«, drängten die Jungs hinter ihm. Das Bediengerät zeigte keinen Ausschlag. Sie mussten weiter vorgehen. Vielleicht war die Mikado weiter abgetrieben als gedacht.
Bescheuert, dachte Naef und sah auf das Feld. Das Getreide stand kniehoch, der Wind ging in Wellen darüber. Von drei Seiten war es von Compounds, Mauern, Bäumen und Gräben umgeben. Sie erlaubten dem Feind jede beliebige Annäherung und Beobachtung.
Naef wusste, die Taliban hatten hier Stellungen ausgebaut. Alle wussten das. Sie hatten sie nach dem 15. und 16. März gesehen, als die Kompanie die Taliban überrumpelt, die Höhe 432 besetzt und ihre Finger nach Süden, nach Isa Khel und Quatliam, ausgestreckt hatte. Die Deutschen hatten damit den alten Status quo aufgekündigt: Ihr dort, wir hier.
Die Taliban legten MG-Stellungen an, Wechselstellungen, Laufgräben, Waffenverstecke, Munitionsdepots. Es hieß auch, die Häuser wären mit Sandsäcken und Schießscharten zu Festungen ausgebaut worden. Noch einmal würden sich die Taliban wohl nicht überrumpeln lassen. Isa Khel war ihr Stronghold, ihre Hochburg. Es ging das Gerücht, einer von dort hätte in der Region das Sagen: Shirin Agah. Es hieß, als Kommandeur halte er die Talibankämpfer zusammen und führe den Widerstand. Er würde sich seinen Vorgarten nicht noch einmal von der Bundeswehr zertrampeln lassen.
Naef wollte nicht herausfinden, wie weit Shirin Agah zu gehen bereit war. Er sah über das kniehohe Weizenfeld. Allein der Bereich, in dem die Mikado abgestürzt war, maß mindestens dreihundert Meter Kantenlänge. Eine grünschwarze Drohne mit einem Körper von zwanzig Zentimeter Durchmesser. Der Oberfeldwebel schüttelte den Kopf. Aber Befehl war Befehl.
»Naef, was sollen wir jetzt machen? Wo ist das Ding?«
Naef sah auf das Bediengerät. »Ich weiß es nicht.« Er blickte auf das Feld und die Lehmwände Isa Khels. »Wir folgen der Straße nach Osten. Eng angelehnt an die Mauern rechts. Beobachtungsbereiche wie bisher. Passt auf Türen, Fenster, Einfahrten auf. Und dann haltet die Augen nach dieser Kackdrohne offen. Sie liegt irgendwo links im Feld.«
»Wir nehmen Isa Khel im Alleingang?«, fragte Martin Augustyniak.
»Wenn es sein muss.«
Martin lachte. Der Riese war eine unverwüstliche Frohnatur.
Naef setzte sich in Bewegung. Er verließ den Schatten der Bäume und überquerte die Kreuzung. Die Männer folgten ihm. Mir fliegen hier gleich die Beine weg – dieser Satz kam ihm wieder in den Sinn. Als er vor etlichen Wochen in Kunduz ankam, hatte er ihn anfangs bei jedem Schritt außerhalb des Feldlagers gedacht. Mir fliegen hier gleich die Beine weg, so groß war seine Angst vor IEDs gewesen. Die improvisierten Sprengfallen waren die tückischste Bedrohung in Afghanistan. »Lieber drei Feuergefechte als ein IED«, hatte Vinz aus dem Foxtrot-Zug gesagt und den Kameraden damit aus der Seele gesprochen. Jetzt war aber mehr zu fürchten als nur eine Sprengfalle.
Der freundliche beige Ton der Lehmmauern rechts war trügerisch, die hohen Fenster waren gefährlich. Es musste nur einer eine Granate fallen lassen, und alles war vorbei. Die Mikado hätte die Bewegungen hinter den Mauern aufklären sollen, jetzt waren die Soldaten auf ihre eigenen Sinne angewiesen. Und allein.
Nils und Fleesch standen mehr als einen halben Kilometer hinter ihnen, die Kompanie mit all ihrer Feuerkraft rumpelte noch mal anderthalb Kilometer dahinter ahnungslos im Schritttempo auf der Little Pluto voran. Der Spähtrupp war auf sich allein gestellt.
Er zögerte nicht. Dreihundert Meter hinter der Kreuzung führte ein Weg ins Ortsinnere von Isa Khel. Eine Gruppe von Jugendlichen, teils in Gewändern und Tüchern, teils in Lederjacken und mit traditionellen weißen Kappen, lungerte an der Ecke herum. Sie lachten und beäugten die herannahenden Deutschen. Der Taliban-Spähtrupp, ging es Jan Nillies durch den Kopf.
Die Soldaten setzten ihren Weg fort. Während die Männer die Umgebung beobachteten, schwenkte Naef die Fernbedienung am Feld entlang. Er suchte das Signal der Mikado. Wie viel Zeit war seit dem Start vergangen? Dreißig Minuten hielt der Akku. Die waren längst vorbei, aber die Hoffnung auf ein Signal starb zuletzt.
Sie waren das Feld der Länge nach abgelaufen. Vor ihnen verschwand der Sandweg zwischen den Mauern von Isa Khel. Wie durch ein Tor führte er ins Innere des Ortes. Maik Mutschke sah auf Entfernung Männer an den Türen stehen. Sie traten nicht auf die Straße. Aus den Torrahmen, aus den Türen starrten sie ungläubig auf die sich nähernde Gruppe. Als würden sie es nicht fassen können, dass sich ausländische Soldaten, überhaupt irgendwer in Uniform, hierhin vorwagen würde. War es denn nicht bekannt? Das hier war Isa Khel, nicht Kunduz, nicht Mazar-e-Sharif, nicht Kabul – Isa Khel.
Dann knallte es. Als Maik das erste Haus passierte, schlugen die Türen und Fenster vor ihm mit einem mächtigen Wumms zu. Wo eben noch rechts und links der Einfahrt in den Ort Männer von den Türschwellen aus das Geschehen zu begreifen versuchten, war plötzlich niemand mehr zu sehen.
»Naef!«, rief Maik den Oberfeldwebel an. »Da geht es in den Ort. Ich habe ein ungutes Gefühl. Wie weiter?«
Naef sah auf die Engstelle am Ortseingang, drehte sich zum Feld und prüfte ein letztes Mal das Bediengerät in seinen Händen. Nichts. So ein Schwachsinn, die Drohne finden wir nie.
»Golf, hier Whity«, funkte er Mario Kunert an.
Keine Reaktion.
Irgendetwas stimmte mit dem Funk nicht. »Eins, hier Whity«, probierte er es bei Nils. »Wir finden die Drohne nicht. Wir kommen jetzt zurück.«
Die Gruppe passierte wieder die Kreuzung zum Vorort, und die Anspannung fiel ab. Hier fühlte es sich bereits deutlich sicherer an.
Martin Augustyniak war sichtlich gut aufgelegt. »Wisst ihr was? Wir haben Isa Khel im Alleingang genommen. Wir sind mal eben komplett durch Isa Khel gegangen.« Da konnte auch Naef sich ein Grinsen nicht verkneifen. Ja, zu Fuß durch Isa Khel. Ist noch einmal gut gegangen.
Zurück bei Nils gliederte er die Männer wieder in ihre Gruppen ein, berichtete seinem stellvertretenden Zugführer von seinen Beobachtungen und verstaute die verbliebene Drohnenausstattung.
Endlich meldete sich ihr Zugführer. »Whity, hier Golf, kommen.« Marios Stimme klang hart über den Funkkreis des Zuges.
»Hier Whity.«
»Nimm dir einen Dingo zur Überwachung mit und dann gehst du noch mal vor zum Feld. Check das noch mal ab, ob du die Drohne nicht doch findest.«
»Nicht dein Ernst!«
»Das Scheißding kommt mit zurück.«
»Was? Das ist völliger Schwachsinn!« Naef kniff die Augenbrauen zusammen, seine Muskeln spannten sich an.
»Wegen einer Scheißmikado!«, fluchte Nils.
»Wegen mir brauchen wir das Ding nicht zu holen. Scheiß der Hund was drauf, wie viel Tausend Euro das Kackding kostet. Das ist Isa Khel!«
»Er will es wissen«, Nils strich sich über das Käppi. »Er will es wirklich wissen.«
»Dann sollen die Afghanen das Ding doch einsammeln. Da können die eh nichts mit anfangen. Da ist nichts drauf gespeichert. Dann kaufen wir das Teil eben auf dem Kuddelmarkt zurück.«





























