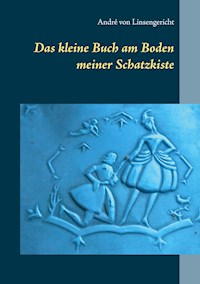
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein schneereicher Wintertag am Nordrand des Spessarts. Auf dem Dachboden eines alten Fachwerkhauses wird eine Schatzkiste geöffnet, in der sich ein kleines Buch befindet, das der Protagonist einst von seiner Urgroßmutter bekommen hatte. Was alles recht idyllisch beginnt und in einer verwunschenen Welt zu geschehen scheint, entwickelt sich jedoch ganz anders als erwartet. Manchem wird das Thema vielleicht anrüchig erscheinen, doch das wird ganz schnell verfliegen. Versprochen! Der Autor André von Linsengericht scheint zu flunkern, doch die Ernsthaftigkeit und Genauigkeit dieses Nicht-Romans verblüffen immer wieder. Es wird einer jedem von uns innewohnenden unsichtbaren Wahrheit Achtung geschenkt und auch Gehör verliehen. Diese Wahrheit existiert tatsächlich schon solange es Menschen gibt. Außerdem wird endlich die Weltformel gelöst. Eine logische Definition, die ihresgleichen sucht und erklärt, wie das Universum wirklich entstand. Und dann wird noch ein kleines Geheimnis gelüftet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Matteo (1999-2016), damit der Himmel lacht!
Inhaltsverzeichnis
Präludium
Edition
Klassifikation
I.
Vom generellen Gesichtspunkt aus
II.
Vom speziellen Gesichtspunkt
Schlußbetrachtung (Historia 1966)
Über die Verwendung des Furzes (Historia 1869)
Anhang (Historia 1869)
Nachwort des Herausgebers (Historia 1966)
Nachwort zur Neuauflage 1966 (Historia 1966)
Fremdwörterverzeichnis (Historia 1966)
Nachwort (Elmar Gotthardt, Historia 1995)
Postludium
Präludium
Es waren diese Winter vor über vierzig Jahren, als es am Nordrand des Spessarts so viel schneite, dass wir den ganzen Tag auf unseren Schlitten draußen waren. Und immer, wenn die langen Unterhosen anfingen zu frieren, staksten wir heim; die gestrickten Handschuhe waren schon längst nass und eiskalt und hingen am Gürtel. Zuhause bitzelten die Finger am Herdfeuer. Es gab warmen Kakao und zur Weihnachtszeit die leckersten Plätzchen der Welt, und abends waren wir einfach nur müde.
Zur guten Nacht gab es Geschichten vom Vater. Am Morgen gab es eine Geschichte von der Urgroßmutter. Sie war trotz ihrer knapp 100 Jahre geistig noch über alle Maßen agil und ich saß oft am warmen Küchenofen und hörte ihr zu, denn ich ging nicht in den Kindergarten. Und wenn sie dann ihre einnickenden kurzen Schläfchen machte, dann hatte ich den Quelle-Katalog in der Hand und blätterte ihn Seite für Seite um. Vielleicht liebe ich deshalb große Bücher und habe selbst auch schon so ein schweres Opus verfasst. Das vorliegende hier ist deutlich kleiner, im Vergleich zu meinem großen Buch ist es ein Furz.
So manches Mal klaute Urgroßmutter von den Zigaretten meines Opas, ihres Sohnes, der im Krieg gelernt hatte, Zigaretten in der Tasche seiner Soldatenjacke mit nur einer Hand zu drehen. Und er konnte auch rückwärts rauchen, das heißt mit der Glut im Mund. Er erklärte es mir nicht, später habe ich einmal gehört, dass die Soldaten auf Nachtwache nicht entdeckt werden sollten. Ob das aber stimmt, weiß ich nicht. Und Jahre danach habe ich das mal ausprobiert und mir, bis es endlich gelang, gehörig den Gaumen verbrannt, denn der Trick war, dass das nur mit den Lippen und Zähnen zu machen ist. Mit den Fingern die Zigarette umgedreht hineinstecken und dann rauchen, das konnte jeder. Beim Schreiben und Lesen dieser Zeilen fällt mir auf, dass man ja Vorbild sein muss und solche Dinge in der heutigen Zeit überhaupt nicht erzählt werden dürfen. Doch was soll ich denn machen, es ist meine Vergangenheit und die rede ich mir schon an genug Stellen schön genug.
Urgroßmutter paffte nur, keine Lungenzüge, wedelte mit der Hand den Rauch hinaus zum Fenster und warf die Kippe in den Ofen. Ich duzte sie nicht, sondern „Ihrzte“ sie. Das heißt, ich fragte nicht: „Wie geht es Dir?“ Ich fragte: „Wie geht es Euch?“ Das war damals so, und aus heutiger Sicht gesehen, finde ich das sehr schön. Es hat etwas Respektvolles. Und wer jetzt denkt, dass ich einem adligen Geschlecht entstamme, dem sei versichert: Ja, wir hier am Nordrand des Spessarts stammen alle von Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa, ab! Er ließ für seine Königin Beatrix von Burgund die Stadt Gelnhausen bauen, die eigentlich auch Beatrix-Stadt genannt werden müsste, doch darum geht es hier nicht.
Manchmal paffte auch meine Oma mit, also die Schwiegertochter meiner Urgroßmutter. Doch das durfte niemand wissen. Außer mir. Vielleicht kann ich daher im Rauchen nichts Verderbliches finden. Ab und zu eine am Fenster paffen. Das ist wie sonntags in die Kirche gehen. Es hilft nicht, tut aber gut.
Urgroßmutter war eine großartige Geschichtenerzählerin, nicht nur im Winter. Die anderen mochten nicht lange bei ihr sitzen bleiben, denn sie trank, vor allem morgens, immer ein Glas Rotwein, in das sie ein rohes Ei klepperte. Das Gebräu sah aus wie Kakao, und beim Trinken zog das Eiweiß Fäden, die sie mit dem Handrücken schmatzend wegwischte. Das ekelte die anderen. Mir machte das aber nichts aus. Vielleicht wurde sie ja aufgrund dieses Zaubertrankes so uralt; uralt und geistig jung. Auch ihr Witz war verwegen, doch damals wusste ich nichts davon. Ich wusste damals auch nicht, dass „Witz“ von Wissen kommt und „Humor“ Feuchtigkeit bedeutet.
Urgroßmutter trank auch Kaffee und dies ist wichtig im Hinblick auf meine Schatzkiste. Wenn der Kaffee ihr zu heiß war, kippte sie einen Teil in die Untertasse und schlürfte diesen ab. Dabei fiel ihr jedoch nahezu immer das obere Gebiss auf die Untertasse. Auch das ekelte die anderen, mich wiederum nicht, denn sie musste dann grinsen und lachen. Und ich tat es ihr nach.
Ich kenne Fotos von ihr, als sie jung war: eine sehr hübsche Frau. Wäre ich ein Mädchen geworden, welch eine Schönheit hätte die Welt gesehen. Doch genetisch wird ja so einiges vererbt, was man nicht will, und man muss es durch eifrige Disziplin in die notwendigen Bahnen zügeln. Mein äußerliches mütterliches Erbe (denn von den Frauen wird es vererbt!) ist der üppige Haarwuchs, der bereits im Alter von 21 Jahren geheime Ratsecken sprießen ließ und dann zu einer mönchischen Tonsur wuchs. Doch da meine Haare nicht vollständig aufgaben, solche zu sein, ist es seit Jahren ein täglich morgendliches Unterfangen, vereinzelte Streuner im spiegelnden Gegenlicht zu suchen. Ertasten geht nicht, sie sind zu flaumig, vor allem im Bereich über dem Neocortex. Beim Stammhirn wächst noch einiges, doch ich mag nicht, dass zu viel Stammhirn überhandnimmt. Und je älter ich werde, desto mehr ähnle ich meinen Kinderfotos: kaum Haare auf dem Kopf. Und die Zähne sind auch nicht mehr im Original vollständig. Ich war manchmal zu verbissen. Damals hatte ich noch keine Zähne. Und somit auch keine Haare auf ihnen. Und wenn ich so ein Kinderfoto von mir betrachte, dann sehe ich lachende Augen und ich sehe, wie der Schalk auf meiner rechten Schulter tanzt. Manchmal auch auf der linken. Je älter ich werde, desto lustiger werde ich. Ich bin glücklich darüber, denn das Kind von damals hat überlebt.
Wie gesagt, die anderen wollten nicht gerne bei der Urgroßmutter sein, ich aber umso mehr, denn ihre Geschichten verzauberten mich. Doch von diesen Geschichten will und muss ich ein anderes Mal berichten, denn hier gibt es heute nur vom „Kleinen Buch am Boden meiner Schatzkiste“ zu berichten.
Meine Urgroßmutter konnte auch lesen und sie hatte dieses kleine Buch, das besonders war und ihr und mir Tränen des Lachens beim Vorlesen brachte. Ich lernte die deutsche Sprache mit diesem Büchlein, lange bevor ich zur Schule ging.
Kurz vor ihrem Tod fragte ich sie, woher sie denn dieses Buch hatte, doch sie wusste es nicht. Es war alt und anscheinend eine Übersetzung aus dem Lateinischen, sagte sie. Vielleicht wollte ich deshalb schon in der Schule Latein lernen. Als ich sie zum letzten Mal lebendig sah, schenkte sie mir das kleine Buch. Ich war 9 Jahre alt. Und das Büchlein kam in meine Schatzkiste. Da war noch viel mehr Besonderes drin.
Nach all den Jahren, nach den vielen Jahren meiner Wanderung durch die Welt, schneite es an Weihnachten wieder einmal am Nordrand des Spessarts, und als ich meinen alten Schlitten nahm und mit langer Unterhose, Jeans, gestricktem Pullover und ohne Handschuhe hinaus auf die alten Wege der Rodelbahnen ging, da kam der Zauber der Vergangenheit über mich und wirbelte mir jenes kleine Buch wieder in den Sinn.
Ich rodelte schnell nach Hause, wärmte rasch die Hände am noch immer vorhandenen Holzofen in der Küche und stieg dann auf den Dachboden unseres alten Fachwerkhauses. Dort war die Zeit stillgestanden. Die riesige Holzbank mit den Kartoffelsäcken und Leinentüchern darin stand unverrückt noch auf ihrem Platz. Darauf konnte man zu dritt nebeneinander sitzen und der Sitz war ein Deckel, darunter viel Platz war. Es roch nach Kindheit.
Als ich vor über 30 Jahren das Haus und die Heimat verlassen hatte, versteckte ich vorher die wichtigsten Dinge meiner Kindheit und Jugend in meiner Schatzkiste und diese in einen Ledersack und das Ganze in die Holzbank. Darüber packte ich wieder die Kartoffelsäcke und Leinen. Es war noch ein Zettel dabei, dass dies nicht weggeschmissen werden dürfe, falls es jemand anderes als ich in die Hände bekäme. Man weiß nie, was Mütter, Großmütter, Urgroßmütter immer finden und dann als „altes Zeug“ für unwert erachten und der Caritas abgeben.
Doch auf den Dachboden ging niemand. Er war ein heiliger Ort, der sich selbst schützte.
Ich öffnete die Holzbank, räumte die Kartoffelsäcke und das Leinen heraus und fand schließlich unbeschadet den Ledersack und darin meine Schatzkiste. Und da ich neben vielen Lastern auch das der Emotionalität habe, kam nach einer ordentlichen Gänsehaut ein leichter, langer Augenregen. Wer je vorhaben sollte, mit mir in die Oper zu gehen, dem rate ich ab: „E lucevan le stelle“ und es tropft mir über die Wangen den Bart hinab auf das bebende Parkett.
Bevor ich näher auf den Inhalt meiner Schatzkiste eingehe, sei mir erlaubt, sie zu beschreiben. Sie wiegt leer 1489 Gramm. Ja, ich habe sie gewogen, damit die Wissenschaftlichkeit und auch die Ernsthaftigkeit der vorliegenden Abhandlung und Edition von vorneherein deutlich zum Vorschein kommt. Dies umso mehr, da meine Schatzkiste selbst eine Geschichte hat, die mir vor dem Wiederentdecken jedoch gänzlich unklar war.
Sie hat die äußeren Maße: Länge 35 cm, Breite 25 cm, Höhe 20 cm. Sie ist aus mattiertem Weißblech, gestanzt und reliefiert, mit geschrägten Kanten. Auf die einzelnen Reliefs komme ich gleich zu sprechen. Der Deckel ist an zwei angenieteten Scharnieren mit dem Korpus verbunden. Auf der rechten Seite des Deckels befindet sich bei 8 cm (vom hinteren Rand) ein Loch, in dem eine Niete ein kleines 16-gliedriges Kettchen hält, das einst zu einem im Korpusrand (ebenfalls bei 8 cm) befindlichen Ringlein führte, um den Deckel zu halten. Heute ist das Kettchen zur kurz, um diese Aufgabe noch wahrnehmen zu können; es sind wohl im Lauf der Jahre immer wieder Kettenglieder verloren gegangen oder gar ein ganzes Stück abgebrochen. Dennoch ist es noch zum Teil da und vielleicht werde ich es reparieren.
Was ist nun zu sehen? Ich mache es kurz: Oben auf dem Deckel kniet ein galanter Mann mit einem barocken Rock links vor einer vor ihm stehenden eleganten Dame mit extrem schmaler Taille, einem riesigen aufgeplusterten knielangen barocken Rock und einem kleinen Hütchen auf dem Kopf, dem eine Vogelfeder aufgesteckt zu sein scheint. Sie gibt ihm ihre linke Hand. Der Herr ist hutlos und hat gewelltes Haar. Das Ganze findet auf einem Ast statt, welcher als Standfläche für die beiden dient. Am linken Rand sprießt ein kleines Bäumchen, rechts, teils noch unter dem Rock der Dame ein kleiner Ast mit einem Vögelchen, das zu zwitschern scheint. Etwas links über dem Herrn flattert ein Putto und zielt mit seinem Bogen einen Pfeil auf das Paar. Es gibt noch wenige ornamentale kleine Reliefierungen, doch sind diese inhaltlich nicht wichtig.
Auf der Vorderseite ist unsere Dame wieder zu sehen, diesmal jedoch allein. Sie trägt den üppigen Rock, hat die schmale Taille und hier ist nun auch ein Mieder zu erkennen. Oder ist es ein Jäckchen mit kurzen Ärmeln, die am Oberarm berüscht sind? Auch hier bildet ein großer Ast den Untergrund und somit die Standfläche für unsere Dame, die auf dem rechten Standbein sich leicht nach links dreht und etwas Rundes (ein Taschentuch?) in der linken Hand hält. Ihre rechte Hand hält einen Hochzeitsstab. Rechts sehen wir einen kleinen Baum und links, nicht ganz auf dem Boden stehend, sondern eher auf einer Wolke schwebend, einen beinhohen schmalen Käfig mit einfacher Kuppel. Ohne Vogel!
Drehen wir die Kiste, dann haben wir auf den vier geschrägten Ecken mittig je einen sechszackigen Stern. Jeweils auf der rechten und linken Seite befindet sich das gleiche Relief: im Zentrum ein nach links fliegender Putto mit langgestrecktem Körper, dessen Beine deutlich unterschieden sind. Er sieht aus wie der fliegende Supermann, nur nackt. Er lächelt den Betrachter an und hält in seinen nach vorne gestreckten Händen ein Band, an dem sehr gut zu erkennen zwei Herzen hängen. Unter ihm auf einem Ast sitzt in der Mitte ein Vogelpaar. Der linke Vogel ist etwas größer und wirkt männlicher. Die beiden sind Brust an Brust und schnäbeln.
Und nun zur hinteren Seite. Ebenfalls bildet ein Ast die Basis der Darstellung. Vier Wurzeln gehen aus ihm zu einem abgesägten Stamm, der als Sitzfläche für einen jungen eleganten Mann dient. Das rechte Bein ist galant hinter das linke geschlagen und die Kniehose ist deutlich zu erkennen. Er spielt eine längliche Laute und trägt ein „barockes“ Halstuch. Auch der Rock ist ansatzweise zu erkennen. Bei der Griffhand sind die Ärmelaufschläge zu sehen. Er lächelt; die Mimik ist nicht gepunzt, sondern nachträglich geritzt. Hutlos fällt das Haar links hinter den Rücken. Aus dem Baumstumpf wächst links ein kleiner Zweig mit Blättern, rechts ein größerer Zweig, auf dem ein Vöglein sitzt, das den Musizierenden anschaut.
Kommen wir nun zur Interpretation der Reliefs: Es geht um die romantische Liebe! Ohne jeden Zweifel. Heinrich Heine sagte vieles dazu in seinem lyrischen Intermezzo. Vieles wäre auch hier dazu zu sagen, doch die Zeit haben wir jetzt nicht, denn wir müssen noch auf das Innere meiner Schatzkiste schauen, denn noch muss die Frage beantwortet werden, welchen Zweck diese Kiste hatte, bevor sie die meinige wurde.
Ich öffne den Deckel und finde auf dessen Rückseite oben folgende Zeilen gedruckt, was vermutlich mit einem Stempel erfolgte:
Erinnern Sie sich günstig, daß Ihnen diese Schatulle von der FirmaKaffee-Schilling, Schilling & Sohn, Bremenüberreicht wurde, und daß Sie von diesem Import-Haus und erster Kaffee-Rösterei zu denkbar niedrigsten Preisen, denkbar besten gebrannten Kaffee, sowie Tee und Kakao aus erster Hand erhalten.
Meine Schatzkiste war demnach ein Werbegeschenk der Firma Schilling & Sohn aus Bremen und muss wohl (das habe ich mittlerweile recherchiert) um 1925 entstanden sein. Die Geschichte der Firma habe ich mir angeschaut, sie ist recht spannend, da sie nicht mit Kaffee, sondern mit Tabak beginnt und ich hier wieder auf meine Urgroßmutter verweise. Wer Näheres erfahren möchte, dem gebe ich es hier, mit der ersten Fußnote dieser Abhandlung.1
Ich war also an jenem verschneiten Wintertag am Nordrand des Spessarts auf dem Dachboden meines Geburtshauses, schloss die Holzbank wieder und setzte mich hin, die Schatzkiste neben mich. So etwas wie Ehrfurcht überfiel mich. So viele Jahre hatte ich sie nicht geöffnet. Der Augenregen war durch die innere Aufregung verebbt. Mutig hob ich erneut den Deckel und sah all meine Schätze.
Was war da nicht alles drin! Es würde hier viel zu weit führen, mehr als auch nur einen Satz zu den einzelnen Gegenständen zu schreiben. Meine erste Mundharmonika: Ich hätte so viel über sie zu sagen. Drei Klappmesser, das mit Horn hat einen Korkenzieher. Sie stammen von meinem Urgroßvater mütterlicherseits. Er hatte immer blaue Hände. Ein Fläschchen Underberg: keine Ahnung mehr, was es damit auf sich hat. Ich werde es nicht aufmachen, sollen die Kräuter noch bis in die Ewigkeit in sich selbst gären. Mehrere Federn: vor allem Bussard, Eichelhäher, Rabe. Dann der Schädel eines Stallhasen. Den erinnere ich noch gut, denn wir hatten ja Schweine, Hasen, Hühner und Ziegen. Und ich stibitzte hin und wieder Knochen von den geschlachteten Tieren, in diesem Fall von einem Rammler, den ich gar nicht mochte. Ein Leinenbeutelchen mit Klickern. Andere nennen es Murmeln, für mich waren es Klicker, was ja auch logischer ist: Murmeln murmeln beim Aufeinanderstoßen nicht, sondern es gibt helle Klicks, sie klickern also, ergo: Klicker. Onomatopoetisch (lautmalerisch) nennt man das, doch ich schreibe das an dieser Stelle nicht, um besserwisserisch zu sein oder zu wirken, sondern weil es im weiteren Verlauf dieser Abhandlung noch eine wichtige Rolle spielen wird.
Ich holte einen Satz gebrauchter Gitarren-Saiten hervor. Sie gehörten zu meiner Ibanez-Westerngitarre, die ich mit 14 Jahren für viel Geld gekauft hatte. Bin damals Werbung austragen gegangen und hab jeden Pfennig gesammelt. Bei uns gab es noch die Hausschlachtung. Ein stattlicher Metzger kam in der Winterszeit zu uns und schlachtete die Sau. Im Lauf der Jahre entwickelten sich





























