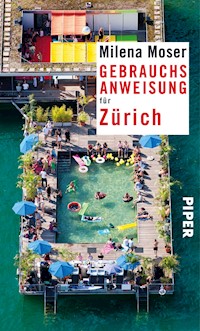9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit die etwas chaotische Paula in die Redaktion eingetreten ist, herrscht helle Aufregung. Sie verpaßt einen wichtigen Termin, liebt den Klatsch, und dann platzt auch noch eine Briefbombe im Büro. Als Paula schließlich in die Leserbriefredaktion strafversetzt wird, beginnt sie, den Dingen auf den Grund zu gehen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Milena Moser
Das Leben der Matrosen
Ein Zeitungsroman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Seit die etwas chaotische Paula in die Redaktion eingetreten ist, herrscht helle Aufregung. Sie verpaßt einen wichtigen Termin, liebt den Klatsch, und dann platzt auch noch eine Briefbombe im Büro. Als Paula schließlich in die Leserbriefredaktion strafversetzt wird, beginnt sie, den Dingen auf den Grund zu gehen …
Über Milena Moser
Milena Moser wurde 1963 in Zürich geboren. Sie absolvierte eine Buchhändlerlehre und schrieb für Schweizer Rundfunkanstalten. 1990 erschienen ihre Kurzgeschichten «Gebrochene Herzen oder Mein erster bis elfter Mord». Ein Jahr später schrieb sie ihren ersten Roman, «Die Putzfraueninsel», der sich schnell zum Bestseller entwickelte und dessen Kino-Verfilmung preisgekrönt wurde. Es folgten weitere erfolgreiche Romane. Seit 2015 lebt Milena Moser in Santa Fe, New Mexico.
Inhaltsübersicht
Für Rosa Zimmermann, auch bekannt als Eva Uhlmann, in Liebe
1
Paula Perroquet stand vor verschlossenen Türen und konnte nicht hinein. Das paßte zu dem Tag, der damit begonnen hatte, daß sie sich mit Hilfe einer Kanne kochenden Kaffees Verbrennungen zweiten Grades auf der Bauchdecke zuzog (einer Körperpartie, für die sie noch nie viel übrig gehabt hatte). Sie preßte ihr «Badge», ein kreditkartenähnliches Ding, das ihre Kollegen nur lässig im Vorübergehen ungefähr in Richtung Tür zu halten pflegten, am Seiteneingang gegen das rote Sensor-Auge. Nichts. Sie trat einen Schritt zurück und versuchte es noch einmal, mit einem aggressiven Ausfallschritt. Hoffentlich sah sie niemand. Sie kam sich ziemlich dumm vor.
Schließlich gab sie auf und ging um das Gebäude herum zum Haupteingang, wo der Portier mit väterlicher Strenge sein Amt versah. «Sie schon wieder!» Zum drittenmal demonstrierte er ihr die Handhabung des Badge («Locker aus dem Handgelenk»), zum drittenmal wies er sie darauf hin, daß Verlust oder Beschädigung desselben mit 30 Franken gestraft würden. Dann ließ er sie, eher widerwillig, wie ihr schien, zum Hauptportal herein. «Morgen müssen Sie es aber können!» Es war ihr dritter Arbeitstag bei der «Zeitung».
Er meint es nicht so. Er hat nichts gegen dich persönlich. Und der Sensor auch nicht.
Paula versuchte sich zu orientieren. Sie war zur Not in der Lage, vom Haupteingang aus zu ihrem Büro in der Lokalredaktion zu finden, nicht aber zum Dienstbüro, wo die morgendliche Ressortsitzung stattfand. Jedenfalls nicht geradewegs.
Das Redaktionsgebäude hatte den Grundriß eines Schiffes, was auf die interne Sprache abfärbte. «Backbord!» rief ihr ein vorübereilender Kollege zu – was entweder rechts oder links bedeuten mußte. Während sie durch schlecht beleuchtete Gänge, über ihr unbekannte Halbtreppen und eigenwillige Abzweigungen irrte, erinnerte sie sich an eine Geschichte, die sie über die «Mogamma» geschrieben hatte, das Verwaltungsgebäude in Kairo, in dessen labyrinthischem Inneren schon Leute verschwunden sein sollen. Man vermutet, sie seien hinter blinden Türen verhungert, jedenfalls wurden sie nie mehr gesehen.
Diese Geschichte war eine der besten, die sie als freie Journalistin verfaßt hatte. Jahre war es her. Einen Nervenzusammenbruch und eine Scheidung später konnte sie froh sein, die Teilzeitstelle in der Lokalredaktion der «Zeitung» bekommen zu haben. Bei der Bewerbung hatte sie geschummelt: ihre Freundin, die Schriftstellerin Nicole Müller, hatte ihr beim Formulieren des Bewerbungsschreibens geholfen und ihr einige unveröffentlichte Texte als Arbeitsproben zur Verfügung gestellt.
«Frau Perroquet!» Paula blieb stehen, «Die Zeitung» von heute schützend vor der Brust.
Frau Zimmermann, Leiterin des Sekretariats der Chefredaktion, rief sie in ihr Büro. Paula fühlte sich ertappt. Sie war sich ziemlich sicher, daß Frau Zimmermann den Bewerbungsschwindel durchschaut hatte, ihn aber aus Gründen, die nur sie kannte, nicht meldete. Frau Zimmermann arbeitete seit über vierzig Jahren bei der «Zeitung», sie hatte fünf Chefredakteure überdauert und sich an eine Chefredakteurin gewöhnt (nahm Paula jedenfalls an): Ruth-Maria Vollenweider, die erste Frau, die bei der «Zeitung» diesen Posten bekleidete. Man nannte sie «Maggie» – nicht, wenn sie es hörte.
Rosa Zimmermann schaute eine Weile zu, wie Paula auf dem Stuhl hin und her rutschte. Sie trug eine breitrandige Brille mit dicken Gläsern, hinter denen sie prüfend, aber nicht unfreundlich blickte. Wenig schien ihr zu entgehen.
«Ich habe hier Geld für Sie», sagte Frau Zimmermann schließlich. «Sie sind noch nicht im Computer erfaßt. Deshalb bekommen Sie ihren ersten Lohn in bar.» Paula reagierte nicht sofort.
«Brauchen Sie ihn etwa gar nicht?»
«Doch, natürlich. Ich habe nur nicht damit gerechnet.»
Frau Zimmermann zog es vor, auf diese Bemerkung nicht einzugehen. Statt dessen reichte sie Paula einen Umschlag.
«Zählen Sie ruhig nach.»
Paula zählte. Nach drei Arbeitstagen bereits Geld ausbezahlt zu bekommen, gehörte eindeutig zu den angenehmeren Seiten des Angestelltendaseins. Vor allem, wenn man bedachte, daß sie in dieser Zeit nicht viel mehr geleistet hatte, als sich mit dem Computersystem herumzuschlagen, den Kaffeeautomaten zu überlisten und sich die vielen neuen Namen nicht nur zu merken, sondern sie auch richtig mit Gesichtern zu verbinden. Sie hatte mit Leuchtstiften in allen lieferbaren Farben gespielt, die ihr, eine weitere Annehmlichkeit, zusammen mit Bergen von anderem Büromaterial zur Verfügung gestellt wurden. Minutenlang schaute sie aus dem Fenster ihres Büros auf die Sihl, die braun und träge dahinfloß und sie, wenn sie die Augen zusammenkniff, entfernt an den Nil erinnerte. Sie könnte Korrespondentin in Kairo sein. Aber sie war es nicht.
Sie hatte in Kairo gelebt. Sie hatte in Spreitenbach gelebt, in Uster und in Kilchberg. Jetzt lebte sie in Zürich, zum erstenmal in ihrem Leben. Was sie davon halten sollte, wußte sie noch nicht recht. Marlon lebte in Zürich. Das natürlich.
Eine Gruppe von Getränkeautomaten kam in Sicht, von hier aus war das Dienstbüro leicht zu finden. Paula zündete sich eine Zigarette an. Die Kaffeenische mit den drei runden Tischen im Bug des Schiffes wurde «der Letten» genannt. Es war einer der wenigen Orte in der ganzen Redaktion, an denen geraucht werden durfte. Die Chefredakteurin war militante Nichtraucherin, und viele, die froh waren, überhaupt eine Gemeinsamkeit mit ihr zu finden, schlossen sich ihr darin an. Maggie gehörte zu den Frauen, in deren Gegenwart Paula sofort Laufmaschen und andersfarbige Haaransätze wuchsen, und unwillkürlich fragte sie sich, ob sie auch saubere Unterwäsche trug. Dinge, die Ruth-Maria Vollenweider nie passieren würden.
Paula drückte ihre Zigarette aus und nahm sich vor, am Donnerstag mit ihrem Therapeuten über Maggie zu sprechen. Dann überlegte sie kurz, ob sie vor der Sitzung, die jeden Augenblick beginnen würde, eine halbe Beruhigungstablette oder ein Stück Schokolade zu sich nehmen sollte. Sie entschied sich für letzteres.
In der Sitzung wurde kurz die aktuelle Ausgabe der «Zeitung» kritisiert und dann besprochen, was für die nächsten Tage geplant war. Paula hatte, seit sie bei der «Zeitung» arbeitete, noch kein einziges Mal das Wort ergriffen. Einmal mußte es sein.
«Achmed von Wartburg spielt am Mittwoch im Café Zähringer zum Tango auf», sagte sie betont munter. «Ich dachte, das könnte interessant sein.» Sie war versucht, in ihren nächsten Satz einen der Fachausdrücke einzubauen, die sie aufgeschnappt hatte, zum Beispiel «fahren» – «wir müßten das ja nicht allzulang fahren» –, aber sie war sich doch zuwenig sicher, wie man das Wort wirklich gebrauchte. Statt dessen fügte sie hinzu: «Er war immerhin mal Stadtpräsidentschafts-Kandidat. Das könnte doch ganz interessant sein.»
‹Du wiederholst dich›, nörgelte in ihrem Kopf die Stimme, die immer nörgelte. Paula versuchte sie zu ignorieren, was ihr mit Tabletten leichter gelang als mit Schokolade. Zu ihrem Erstaunen wurde der Vorschlag angenommen. «Donnerstag?» fragte Karl, der an diesem Tag Dienst versah. Als sie ihr Kürzel «pp» auf den Plan setzte, fühlte sie sich zum erstenmal seit langer Zeit wieder lebendig. Jetzt mußte sie nur noch jemanden finden, der sie ins Café Zähringer begleitete.
2
Marlon wollte nicht mit ins Café Zähringer.
«Da gehen nur Öko-Freaks hin», erklärte er. Außerdem heiße er nicht mehr Marlon, sondern Mark. «Marlon ist ein Hippie-Name.» Paula erinnerte sich wehmütig, wie sie den Namen vor etwas mehr als vierzehn Jahren ihren Freundinnen gegenüber hatte verteidigen müssen, die ihn als «Macho- Namen schlechthin» bezeichnet hatten.
«Trotzdem nett, daß du angerufen hast. Vielleicht findest du ja eine Freundin, die mit dir hingeht? Wir sehen uns dann am Wochenende.» Ihr Sohn behandelte sie wie ein Kind. Aber das war nichts Neues.
Paula hatte ohne Pause gearbeitet und auf dem Heimweg nicht daran gedacht einzukaufen. Sie war noch immer damit beschäftigt, sich in der Stadt zurechtzufmden. Unten in der Straße befanden sich ein Käseladen und ein teuer wirkendes Feinkost-Geschäft, doch Paula fühlte sich außerstande, das Haus noch einmal zu verlassen. Ihr Kühlschrank war leer bis auf einen halbvollen Topf mit Hühnersuppe, den ihr Dr. Gallati, einer ihrer neuen Nachbarn, am Abend ihres Einzugs gebracht hatte. Da dieser Abend bereits mehr als eine Woche zurücklag, hegte sie ernsthafte Zweifel an der Genießbarkeit der Suppe. Sie leerte sie in die Toilette. Dabei gedachte sie der Krokodile, die gemäß einem unverwüstlichem Gerücht in der Kanalisation hausten, und wünschte ihnen guten Appetit.
Paula wusch den Suppentopf aus und trug ihn in den fünften Stock, den nur Dr. Gallati bewohnte. Er hatte alle drei Wohnungen gemietet und betrieb ein PR-Büro – was immer das bedeuten mochte.
Jedenfalls war er ein sehr freundlicher Mann und ein gutaussehender dazu, eine seltene Kombination nicht nur in Zürich, aber hier vor allem. Soviel war Paula in einer guten Woche bereits klargeworden. Ob Dr. Gallati wohl Lust hatte, sie ins Café Zähringer zu begleiten? Sie mußte zugeben, er erinnerte sie an ihren ersten Ehemann, Charles Zwingli, Marlons Vater. Charles war ihre erste Liebe gewesen, und ihre Mutter behauptete heute noch, ihn zu verlassen sei der monumentalste von vielen Fehlern gewesen, die Paula in ihrem Leben gemacht habe. Tatsächlich hatte Charles sie verlassen und nicht umgekehrt, aber dies ihrer Mutter klarzumachen hatte Paula irgendwann in den letzten zehn Jahren aufgegeben.
Plötzlich wurde Dr. Gallatis Tür geöffnet, und der schönste Mann, den Paula in ihrem Leben je gesehen hatte, stand vor ihr, dunkelhäutig, mit Rastazöpfen und in recht gewagter Höhe abgeschnittenen Hosenbeinen; vermutlich nicht älter als zwanzig.
Sie konzentrierte sich darauf, dem jungen Mann ins Gesicht zu schauen, und fragte nach Dr. Gallati.
Der junge Gott, der sich als Ernesto vorstellte, bat sie herein, küßte ihr galant die Hand und schrie dann über die Schulter nach Hugo. Hugo, dachte sie, das hätte gepaßt. Hugo und Paula Gallati grüßen als Verlobte.
«Bitte», sagte Ernesto höflich, «setzen Sie sich doch. Möchten Sie etwas trinken?»
«Gern.» Sie war versucht, um ein Gläschen Geriavit zu bitten. Nichts macht älter, als von schönen jungen Menschen gesiezt zu werden. Paula bemühte sich, Ernesto nicht allzu aufdringlich auf die Beine zu starren. Nach schätzungsweise viertausend Aerobicstunden könnten ihre Beine auch so aussehen. Vielleicht auch nicht. Aerobic sei ohnehin nicht nur ungesund, sondern auch überflüssig, behauptete Jane Fonda, und die mußte es ja wissen.
Dr. Gallati kam mit nassen, aber frischgekämmten Haaren aus dem Badezimmer.
«Mögen Sie zufällig Tango?» fragte er.
Ernesto, der erst so getan hatte, als wolle er sie begleiten, berief sich in letzter Minute auf noch vorbeikommende Freunde und blieb zu Hause – Hugo behauptete, er habe es von Anfang an darauf angelegt.
«Er ist Salsa-Musiker. Er haßt Tango.»
Als sie im Café Zähringer vor einem Linsensalat saßen, wurde ihnen von einem sympathischen, wenn auch recht langsam sprechenden Kellner mitgeteilt, Achmed werde erst um halb elf auftreten – wenn überhaupt.
Zu spät für den Redaktionsschluß. Viel zu spät.
Hugo nahm Paulas Hand. «Jetzt kommen eben die chinesischen Vasen zum Zug.»
3
Karl, der immer noch am Dienstpult saß, blieb ganz ruhig, als Paula anrief.
«Dann nehmen wir eben die chinesischen Vasen», sagte er. Hundert Zeilen über chinesisches Porzellan habe er immer vorrätig, eben für den Fall, daß ein eingeplanter Text im letzten Moment gestrichen werden mußte. Was allerdings seit Jahren nicht mehr vorgekommen sei. Und wenn, dann wegen Computerkatastrophen, Stromausfällen, Viren. Daß eine Journalistin einfach vergaß, sich zu informieren, wann eine Veranstaltung angesagt war, und deshalb den Redaktionsschluß verpaßte, das sei, soweit er sich erinnern könne, noch nie vorgekommen.
«Woher hast du das gewußt», fragte Paula, als sie an den Tisch zurückkam, «das mit den chinesischen Vasen?»
«Ich habe dreizehn Jahre lang bei der ‹Zeitung› gearbeitet», antwortete Hugo knapp. Er sah nicht so aus, als wollte er mehr darüber sagen. Paula hätte ihm auch nur mit Mühe zuhören können; die Stimme in ihrem Kopf, die sie als unfähige Nuß und dummes Huhn beschimpfte, war zu laut.
Karl redigierte die chinesischen Vasen und beschloß dann, eine Pause einzulegen. Beim Kaffeeautomaten traf er Rosa Zimmermann, die, wie immer in nächtlicher Mehrarbeit, das interne Mitteilungsblatt verfaßte, «Die Zigeunerpost». Er gab ihr eine kurze Zusammenfassung von Paulas Fehlleistung.
«Ich weiß nicht, ob wir dieses Fräulein behalten können», zitierte er einen längst vergangenen Chefredakteur. Rosa lächelte etwas schief, denn dieser Spruch hatte vor vierzig Jahren wiederholt auch ihr gegolten.
«Gib ihr eine Chance», sagte sie, «sie ist eine gute Journalistin – im Grunde.»
Im Cafe Zähringer wurde kein Alkohol ausgeschenkt. Paula betrank sich mit Kaffee. Achmed von Wartburg hatte unterdessen zu singen begonnen. Breitschultrig, schwarz gekleidet, das Hemd über großflächigen Tätowierungen offenstehend, das Gesicht verzerrt. Er krümmte und wand sich auf seinem Stuhl. Auf dem Plakat, das gleich neben ihm an der Säule klebte, sah er im Gegensatz dazu sehr jung und beinahe schüchtern aus; die Sonne schien ihm ins Gesicht. «El Tigre Tanguero». Ein kleiner Plüschtiger bewachte die Noten, die auf dem Instrumentenkoffer lagen.
«Loco, loco, loco!» schrie Achmed.
Dumm, dumm, dumm, sang die Stimme in Paulas Kopf. Sie verstand kein Spanisch, aber sie wußte genau, was er meinte. Loco, loco, loco war jemand, der Stimmen hörte, loco, loco, loco war sie.
«Dieses Lied ist universal», unterbrach Achmed im Plauderton die beinahe beklemmende Stille und kündete die «Zürcher Version» an. Paula nutzte die kurze Pause, um einen weiteren Kaffee zu bestellen.
Er sang von zwei halben Sohlen, auf die Füße genagelt, und von Hemdstreifen, direkt auf die Haut gemalt.
«Das ist natürlich ein Stilfehler», flüsterte Hugo, «Das heißt auf Zürichdeutsch nicht ‹Hömli›, sondern ‹Hämp›!» Paula schüttelte irritiert den Kopf.
«‹Hämp›!» wiederholte Hugo, als beiße er ein Stück aus der Luft.
«Lieb mich doch, weil ich spinne», sang Achmed. Es sei ein Trugschluß, zu glauben, man würde mehr geliebt, wenn man berühmt sei, hatte er einmal gesagt. Ob man mehr geliebt wird, wenn man spinnt? Paula war nicht berühmt, aber eindeutig verrückt. Vielleicht liebte sie ja jemand dafür. Es kam ihr nicht sehr wahrscheinlich vor. Sie wollte noch einen Kaffee bestellen, aber Hugo hielt sie zurück.
«Mach dich nicht vollends verrückt», sagte er und freute sich sichtlich, als sie laut darüber lachte. Achmed kündete das letzte Lied an, «einen vollkommen untypischen, weil hoffnungsvollen Tango: ‹A pesar de todo›. Trotz allem geht es weiter, trotz allem scheint morgen wieder Sonne», erklärte er mit sanfter Ironie. Er schien dabei direkt Paula anzuschauen, aber das konnte durchaus auch eine Täuschung sein. Trotzdem war sie einen Augenblick lang bereit, ihm zu glauben. Dann wurde die Tür zum Café aufgestoßen, und ohne jedes Gefühl für magische Momente krähte eine junge Stimme: «‹Die Zeitung› von morgen! ‹Die Zeitung› von morgen!»
4
Rosa Zimmermann betrat die Redaktion als erste. Wie jeden Morgen erlebte sie einen Augenblick gerechter Überlegenheit, als sie an dem noch leeren Büro der Chefredakteurin Ruth-Maria Vollenweider, besser bekannt als Maggie, vorüberging. Seit diese im Amt war, seit bald zwei Jahren, waren Rosas Tage noch länger geworden. Maggie hatte die unselige Angewohnheit, den Tag mit einem Dauerlauf zu beginnen – und zwar im Morgengrauen.
«Der Morgen ist das Ruderblatt des Tages», pflegte sie zu sagen.
«Sie müssen es ja wissen», antwortete Rosa dann unbeeindruckt. Sie würde sich von diesem unorthodoxen Tun bestimmt nicht anstecken lassen. Ihre Vorstellung von Sport bestand darin, daß sie gelegentlich einer heruntergefallenen Mozartkugel hinterherjagte und sie notfalls bis unter ihr Pult verfolgte. Doch Maggies anstrengende Gewohnheiten zwangen sie, ebenfalls früh aufzustehen. Weder in Krieg noch Frieden würde sie sich dabei erwischen lassen, wie sie das Haus nach ihrer Vorgesetzten betrat.
Rosa sortierte den ersten Schub Post, der bereits in die Redaktion gebracht worden war. In der Hauspoststelle wurde seit fünf Uhr gearbeitet (Rosa hatte Maggie mit Mühe davon überzeugen können, daß es wenig Sinn hatte, vor dem Eintreffen der Post mit der Arbeit beginnen zu wollen). Um zwanzig nach sechs wurde die Post zum erstenmal verteilt, und pünktlich um halb sieben joggte Maggie in einem edlen grauen Trainingsanzug in die Redaktion. Diese Frau brachte es fertig, kilometerweit zu laufen, ohne im geringsten zu schwitzen oder auch nur ihre Frisur durcheinanderzubringen.
Rosa öffnete die Post und verteilte die Briefe auf verschiedenfarbige Mappen. Zwei Umschläge, die ihr wenig sympathisch erschienen (der eine mit Hakenkreuzen bekritzelt, der andere an die «Schefschlampe Vollenweider» adressiert), legte sie ungeöffnet auf einen Stapel mit ähnlichen Mitteilungen. Eigentlich war sie ja dafür, Derartiges ungelesen wegzuwerfen, wie sie es immer gehalten hatte. Aber im Gegensatz zu ihren Vorgängern wollte Maggie ganz genau darüber informiert sein, wer sie haßte. Es waren nicht wenige.
Paula setzte sich während der morgendlichen Besprechung so, daß ihr Ressortleiter, Bernhard Weber, sie nicht sehen konnte. Wie auf eine stillschweigende Verabredung hin hatte niemand das Debakel mit ihrem Bericht über Achmed von Wartburg erwähnt, und aus Dankbarkeit hatte sie auch nicht darauf bestanden, ihn doch noch zu schreiben. Sie schlug das Konkurrenzblatt auf und versuchte, keine Blicke auf sich zu ziehen.
«Was nun das Knabenschießen angeht», sagte Bernhard, «ich habe hier die Liste mit den Finalisten. Für den Fall, daß das Mädchen gewinnt, sollte noch einmal jemand hingehen.»
Wenig Reaktion. Tobias, der bereits den besten Teil des Wochenendes auf dem Albisgüetli verbracht hatte, winkte ab. Paula las zum elftenmal dieselbe Überschrift und wunderte sich nicht sehr, als Bernhard die Liste vor sie hinlegte. «Das könntest du doch übernehmen», sagte er freundlich, aber bestimmt. Paula nickte. Sie nahm die Liste. Eigentlich mochte sie Kirchweihfeste jeder Art, sie hatte sogar eine – meist uneingestandene Schwäche – für panikerzeugende Achterbahnen (jahrelang hatte sie ihren Sohn Marlon, der sich jetzt Mark nannte, und andere verängstigte Kinder als Vorwand mißbraucht, um diesem Vergnügen frönen zu können). Manche Einheimische nannten den Anlaß respektlos das «Knaben-Erschießen». Der Ausdruck gefiel ihr, und sie fragte sich, ob sie es wagen konnte, ihn zu verwenden. So dauerte es eine ganze Weile, bis sie in dem letztgenannten Finalisten «Mark Zwingli, 14 Jahre, aus Zürich» ihren Sohn erkannte.
Marlon? Schützenkönig?
Sie raffte ihre Sachen zusammen und sprang auf. «Ich fahr gleich hin!»
Bernhard kommentierte ihren Übereifer nicht, den er als Versuch abtat, ihr bisher wenig versprechendes Auftreten gutzumachen. Er schenkte zwei Tassen von dem wohlriechenden, starken Kaffee ein, den er in seinem Büro selbst zubereitete und mit ausgewählten Mitarbeitern teilte, und brachte sie, auf ein wenig Anteilnahme hoffend, zu Rosa Zimmermann. Rosa schätzte seinen Besuch ganz richtig ein.
«Hast du Ärger?» fragte sie.
«Maggie hat mich übers Wochenende viermal angerufen.»
«Nicht, um dir einen schönen Tag zu wünschen», vermutete Rosa. Noch nie hatte ihre inoffizielle Rolle als Vermittlerin sie soviel Zeit und Nerven gekostet wie in den letzten zwei Jahren.
Bernhards Laune besserte sich erheblich, als sein Blick zufällig auf den Umschlag mit der Anrede «Schefschlampe» fiel. «Laß mich das öffnen», rief er, «das ist genau das, was ich jetzt brauche!»
Bevor Rosa ihn daran hindern konnte (sie schätzte prinzipiell keine Kompetenzübertretungen), hatte er den Umschlag schon aufgerissen. Mit ohrenbetäubendem Krachen flog das Büro in die Luft.
5
Der schwere Geruch nach geschmolzenem Käse legte sich über die typische Kirchweih-Mischung der Düfte von Zuckerwatte, Magenbrot und verkohlter Bratwurst. Nachdem es in letzter Zeit ungewöhnlich kalt gewesen war, war es nun plötzlich sehr heiß. Wenigstens kam es Paula so vor. Vielleicht litt sie auch unter Hitzewallungen. Vielleicht kam sie in die Wechseljahre. In England sei das einer jungen Frau mit neunzehn passiert, hatte Paula in einer dieser Klatschpostillen gelesen, die sie verstohlen, aber mit Leidenschaft auf dem Weg zur Arbeit las.
Unglaubliche Menschenmassen wälzten sich von der Tramhaltestelle zur Kirchweih im Albisgüetli hinauf. Paula kam nur sehr langsam vorwärts. Jemand stieß sie an, und sie fiel mit der gepolsterten Schulter ihrer einzigen eleganten Jacke gegen einen dicken Mann, der auf einem Kartonteller eine Riesenportion Raclette vor sich her trug – getragen hatte.
Real Swiss Super Raclette. Es kam ihrer Vorstellung von der Vorhölle ziemlich nahe.
Verschwitzt, schmutzig, aufgelöst erreichte sie die Schießstände. Ihr Sohn Marlon war gerade an die Reihe gekommen. Sie hätte ihn beinahe nicht erkannt, das kurzgeschnittene Haar, das über dem Gehörschutz aufstand, war neu. Ernst sah er aus und ein bißchen unheimlich, mit dem Gewehr an der Backe. Einen kurzen Moment lang verspürte sie das unwiderstehliche Bedürfnis, schreiend und mit den Armen rudernd auf den Schießplatz hinauszurennen, um ihn aufzuhalten. Marlon würde sie hassen.
Er zielte und schoß. Seit wann war das Kind so ernsthaft, so groß? Dreißig Punkte. Reichte nicht für den Schützenkönig, war nicht einmal ein besonders gutes Ergebnis. Als er vom Schießstand kam und sie entdeckte, runzelte er die Stirn, fast, als wolle er ihr die Schuld geben. Eine typische Reaktion, die sie rührte.
«Und dafür haben wir ihn in den freien Kindergarten geschickt», sagte eine Stimme in ihrem Rücken. Sie drehte sich um. Charles Zwingli, Marlons Vater, stand hinter ihr. «Und zu sämtlichen Friedensdemos mitgenommen», ergänzte sie wehmütig.
Dieser ernsthafte junge Mann hatte nichts mehr gemein mit dem zerzausten Kleinkind von damals – oder doch? Eigentlich hatte er immer schon einen Hang zur Organisation gehabt, zu Regeln und Ritualen. Deshalb hatte er sich auch entschieden, bei seinem Vater zu leben, der all dies doch in etwas höherem Maß zu bieten hatte als Paula. Vor allem, seit er wieder verheiratet war.
Carine (mit C) war Steuerberaterin. Paula hatte gehört, daß sie sich morgens beim Frühstück mit Marlon um den Wirtschaftsteil der Zeitung stritt – nicht ihrer «Zeitung», der anderen.
«Mama», begrüßte ihr Sohn sie ohne erkennbare Begeisterung, «was machst denn du hier?» Er küßte sie trocken dreimal auf die Wange.
«Ich arbeite, Marlon – Mark, entschuldige.»
Charles verdrehte die Augen. «Zu Hause zahlen wir fünfzig Rappen für jedesmal, das wir ihn Marlon nennen», erklärte er nicht ohne Stolz, «der junge Mann meint es ernst.»
Zu Hause, dachte Paula.
Auf der vergeblichen Suche nach einem ruhigeren Ort drängten sie sich durch die Menschenmenge. Paula stellte sich dicht an die Abschrankung einer riesigen, gefährlich wirkenden Spaceshuttle-Bahn und blickte nach oben. Dreimal versuchte sie die Augen offenzuhalten, während die mit schreienden Menschen besetzte Kabine auf sie niedersauste. Fast so gut wie selber mitzufahren. Eine Regenbogenkarte in Plastikhülle, ein Schlüsselanhänger und ein Zweifrankenstück fielen in den fünf Minuten, in denen sie dort stand, vor ihren Füßen auf den staubigen Boden. Aber über das alles war schon geschrieben worden. Sie sollte sich dringend um den Schützenkönig kümmern.
«Ich muß mir dir reden», sagte Mark.
Der ruhigste Platz, den sie finden konnten, war die Bushaltestelle. Sie warteten die Abfahrt eines hoffnungslos überfüllten Busses ab und setzten sich dann auf die Holzbank.
«Ich habe mir etwas überlegt», sagte Mark. Paula wartete.
«Jetzt, wo du auch in Zürich lebst, möchte ich eigentlich gern bei dir wohnen.»
«Wirklich?»
Ihre erste Reaktion war vollkommen daneben: Jetzt kann mich niemand mehr schief anschauen, dachte Paula. Seit Mark bei seinem Vater wohnte, hatte sie die meisten ihrer damaligen Freundinnen verloren. Sie sei ja keine richtige Mutter, hatten sie argumentiert und sich von ihr losgesagt. Andere vermuteten furchtbare Umstände, die zu diesem Entschluß geführt haben mußten. Wo hatte man denn schon so etwas gehört, ein Kind, das bei seinem Vater aufwächst? War sie womöglich lesbisch? Drogensüchtig? Beides? Der einzige, der sie immer unterstützt hatte, war Charles, der ein Freund geblieben war.
Ihr nächster Gedanke war: Hilfe! Kann ich das? Was braucht ein ernsthaftes, vierzehn Jahre altes Kind, außer einem zweiten Zeitungsabonnement?
Da sie beim besten Willen nichts zu sagen wußte, legte sie einen Arm um Marks magere Schultern und zog ihn an sich. Nach einer ihm angemessen scheinenden Zeitspanne löste er sich sanft.
«Irgend jemand muß sich doch jetzt um dich kümmern, Mama.»
6
Chefredakteurin Ruth-Maria Vollenweider kam an diesem Morgen ganz gegen ihre Gewohnheit verspätet in die Redaktion der «Zeitung». Sie war von ihrem morgendlichen Joggingpfad abgewichen und hatte sich prompt verirrt, aber das würde sie natürlich niemandem erzählen.
Sie fand ein Chaos vor, das das übliche bei weitem überstieg. Sämtliche Mitarbeiter schienen sich vor dem Nachrichtensekretariat versammelt zu haben. Sie standen dicht beisammen und redeten aufgeregt durcheinander. Einige weinten. Der Newsraum war von Rauch und Gestank erfüllt.
Maggie wurde sich wieder einmal ihrer kleinen Statur bewußt, als sie auf Zehenspitzen versuchte, über die Köpfe hinwegzusehen. Wo war Rosa Zimmermann, wenn sie gebraucht wurde? Sie konnte die blondgefärbten Locken ihrer über einsachtzig großen Sekretärin nirgends entdecken.
«Was ist hier eigentlich los», schrie sie. «Soll morgen keine Zeitung erscheinen?»
Die Menge verstummte, wich auseinander und gab die Sicht auf zwei Sanitäter in roten Windjacken frei. Sie beugten sich über eine reglos auf dem Boden liegende Gestalt mit schwarzgefärbtem Gesicht und in einem blutdurchtränkten, geblümten Hemd. Nur mit Mühe erkannte Maggie den Ressortleiter der Lokalredaktion, Bernhard Weber. Er sah ziemlich tot aus.
Sämtliche Anwesenden starrten sie an. Vorwurfsvoll. Als hätte sie den Mann eigenhändig zu Boden gestreckt. Rosa Zimmermann rückte in ihr Blickfeld und hob die Schultern, als wolle sie sagen: «Also, wenn Sie sich derart danebenbenehmen, kann ich Ihnen auch nicht helfen.»
Die Sanitäter luden Weber auf eine Bahre und trugen ihn hinaus. «Platz machen, bitte», sagte zu Maggie einer, der offenbar nicht wußte, wen er vor sich hatte. Nicht gewohnt, Befehle entgegenzunehmen, wich sie absichtlich noch einen Augenblick lang nicht von der Stelle. Dann marschierte sie durch die feindselig schweigende Menge auf ihr Büro zu.
«An die Arbeit!» rief sie keinem Bestimmtem zu. «Meine Damen, meine Herren, wir haben eine Zeitung zu machen! Frau Zimmermann, Sie kommen mit mir!»
Ohne sich umzuschauen, bog sie um die Ecke und sah sich mit der Tatsache konfrontiert, daß der Gang von schwarzem Rauch erfüllt, mit Glasscherben übersät, durch Bruchstücke einer oder mehrerer Türen versperrt und keineswegs zu begehen war. Ebensowenig ihr eigenes Büro oder das gleich danebenliegende von Frau Zimmermann. Ein plastikbezogener Besucherstuhl schmurgelte übelriechend vor sich hin. Hilfesuchend drehte sich Maggie nach Rosa Zimmermann um.
«Unter diesen Umständen kann ich nicht arbeiten», sagte sie trotzig.
«Sie sprechen ein wahres Wort gelassen aus.» Dann jedoch siegte Rosas Loyalität, weniger Maggie als der «Zeitung» gegenüber. Am Ärmel der Joggingjacke zog sie ihre Vorgesetzte Richtung Nachrichtenraum. «Ausnahmezustand erklären, Mitgefühl aussprechen», soufflierte sie.
Diesen dramatischen Moment nutzte Paula, um die Redaktion zu betreten. Aufgewühlt von dem Gespräch mit ihrem Sohn Mark, der nach fast zehn Jahren bei seinem Vater doch wieder bei ihr wohnen wollte, hatte sie beinahe vergessen, den Schützenkönig zu interviewen. Daß sie es trotz anfänglicher Schwierigkeiten doch noch geschafft hatte, Privates von Professionellem zu trennen («Lieben Sie Ihre Mutter?» hatte ihre erste Frage gelautet …), war sie ziemlich stolz auf sich. Ihr erster richtiger Beitrag zur «Zeitung» kam spät, aber gut.
Doch leider interessierte Paulas Knabenschießen-Geschichte niemanden. Zu groß war die Empörung darüber, daß trotz des ungewissen Schicksals des verletzten Bernhard Weber weitergearbeitet werden sollte, als ob nichts wäre. Noch weniger konnte Paula über ihren Sohn sprechen. Gott sei Dank gab es Psychotherapeuten.
Einem plötzlichen Impuls folgend, versuchte sie, ihren Nachbarn, Dr. Hugo Gallati, anzurufen.
Besetzt.
Ihr Ex-Ehemann, Charles Zwingli, hatte den Telefonbeantworter eingeschaltet. Mark würde ihn unter Umständen abhören. Paula kam nicht über seine Bemerkung hinweg, er wolle sich um sie kümmern. Sollte es nicht, verdammt noch mal, umgekehrt sein? Und war sie überhaupt imstande, sich um jemanden zu kümmern? Bei sich selber versuchte sie das seit Jahren ohne großen Erfolg.
Paula öffnete ihre Notfallschublade und entnahm ihr zwei Tafeln Schokolade (Milch/Nuß), die sie beinahe ganz verzehrte. Dann rief sie ihren Therapeuten an und bat um einen Notfalltermin. Es würde wohl niemand merken, wenn sie heute früher ginge.
«Frau Perroquet!» Das war Rosa. «Möchten Sie nicht wissen, wie es Bernhard Weber geht?»
7
Am Samstag abend faßte Paula sich ein Herz und klingelte bei ihrem Nachbarn im fünften Stock. Hugo Gallati öffnete die Tür in der Uniform des Freizeitkochs: ein großformatiges Küchentuch mit neckischer Aufschrift um die Hüften geschlungen, in der Hand ein Hochglanzmagazin, aus dem er anscheinend gerade ein kompliziertes Rezept nachkochte. Paula beglückwünschte sich zu ihrem Timing. In ihren Schränken herrschte wie immer traurige Ödnis. Sie ernährte sich mittlerweile fast ausschließlich von Schokolade und Zigaretten. Das würde sich wohl ändern müssen, wenn Mark, ihr Sohn, wieder bei ihr wohnte. Heranwachsende brauchten regelmäßige Nahrungszufuhr in – wenn sie ihrem Ex-Mann glauben sollte – schier unvorstellbaren Mengen.
«Du kommst genau richtig», begrüßte Hugo sie, «in zehn Minuten beginnt ‹Benissimo›, und das Essen ist so gut wie fertig.»
Das hatte sie hören wollen. Allerdings – «Benissimo»?
Hugos Freund, Ernesto, trat hinzu. «‹Benissimo Backstage› kommt heute», berichtigte er leicht entnervt und offensichtlich nicht zum erstenmal.
«Nesti liebt Beni Thurnheer», sagte Hugo nachsichtig, «er sieht in ihm die Schweizer Seele schlechthin. Womit er sicher nicht ganz falsch liegt.»
Paula machte es sich zwischen den beiden Männern auf dem Sofa bequem. Auf den Knien balancierte sie ein Tablett mit einem Glas Champagner, selbstgebackenem Briochebrot und einer Auswahl schwer zu identifizierender, aber wohlschmeckender Terrinen, Mousses und kalter Suppen. («Vegetarisch, französisch oder bodenständig, für jeden Geschmack etwas.») Paula war so gut wie glücklich.
Dank der guten Laune des Showmasters verlief der Abend recht harmonisch, bis die in Unterhosen probenden Take That den Bildschirm füllten und Paula und Hugo angesichts der perfekten Beinpaare der Mund offenstehen blieb. Ernesto gab eifersüchtige Bemerkungen über «verweichlichte Engländer» und «aufgeblasene Muskeln» ab, bevor er türschlagend das Zimmer verließ.
Paulas Kollegin Marianne Kaspar hatte sie am ersten Tag gewarnt: «Über drei Dinge darfst du nie auch nur ansatzweise kritisch schreiben, wenn du das Publikum nicht gegen dich aufbringen willst: das sind Hunde, Außenquartiere und Take That – oder, nachdem es sie nicht mehr gibt, die Kelly Family.»
Ernesto ließ sich erst wieder blicken, als die Sendung längst zu Ende und die zweite Champagnerflasche leer war: «Diese Frau ist wieder mal am Telefon», verkündete er in einem beleidigtem Ton, der Paula sofort daran erinnerte, daß sie sich wieder einmal bei ihrer Mutter melden sollte. Hugo entschuldigte sich und nahm den Anruf in einem anderen Zimmer entgegen. Als nach einer Viertelstunde keiner der beiden Männer wieder aufgetaucht war, häufte Paula die Reste der verschiedenen Terrinen auf einen Teller und trug ihn in ihre Wohnung hinunter. Das würde ein wunderbares Sonntagsfrühstück ergeben.
Sie hatte allerdings nicht mit Rosa Zimmermann gerechnet, die kurz nach acht an Paulas Tür klingelte.
«Auf! Auf!» rief sie. «Wir wollen doch die Besuchszeit nicht verpassen!»
Rosa Zimmermann, deren kunstvolle Frisuren die Redaktion jeden Tag aufs Neue faszinierten, trug die platinblonden Haare am Wochenende offen auf die Schultern fallend und mit einer Seidenblume geschmückt. Die Farben ihres Hosenanzuges und dessen psychedelisches Muster ließen Paula jeden Schluck Champagner, den sie am Vorabend getrunken hatte, bereuen.
Bernhard Weber residierte in einem Einzelzimmer. Seine rechte Hand war dick verpackt und hing wie ein kleines Kissen an einer Vorrichtung, die sich «Galgen» nannte. Eineinhalb Finger hatte ihm die Bombe weggerissen. «Halb so schlimm», scherzte er, «ich hab das Zehnfingersystem noch nie beherrscht.» Um sein Bett standen bereits fünf halbwüchsige Kinder, teils seine, teils die seines Kollegen Karl, und zwei besorgte Frauen, die sich gut zu kennen schienen und auch Rosa freudig begrüßten. Außerdem war da noch ein kleiner Hund. Das Ganze wirkte wie eine mittlere Party. Morgens früh um neun.
«Freunde», flüsterte Rosa verschwörerisch, als sich die beiden Ehefrauen mit den Kindern auf die Suche nach etwas Eßbarem begeben hatten (Kinder! Essen! merkte sich Paula) und sie sozusagen unter sich waren. «Freunde, ihr wißt, das war nicht das erste Mal. Erinnert ihr euch an den Buttersäureanschlag?» Karl und Bernhard verzogen das Gesicht.
«An den Tag, an dem ein Misthaufen vor dem Eingang deponiert wurde? Die anonymen Anrufe? Die Typen, die mich abends beim Verlassen des Hauses überfallen und beschimpft haben?»
«Die tun uns heute noch leid», murmelte Karl.
«In einem gewissen Maß hatten wir das natürlich immer schon», fuhr Rosa fort, «doch seit zwei Jahren ist es viel schlimmer geworden. Die Anschläge sind brutaler und gezielter.»
«Es muß mit Maggie Zusammenhängen», schloß Bernhard.
«Richtig. Wir müssen …» Doch bevor Rosa ihren Plan erläutern konnte, wurde die Tür einen Spaltweit geöffnet, ein protzig ausladender Lebensmittelkorb wurde ins Zimmer gehievt, dahinter erschien, beinahe schüchtern wirkend, wenn man es nicht besser gewußt hätte, Maggie. Herself.
8
Maggie stellte den mit exotischen Lebensmitteln gefüllten und mit einer gigantischen Satinschleife verzierten Korb mitten im Zimmer auf den Boden. Ihr Gesicht war leicht gerötet; schwer zu sagen, ob vor Anstrengung oder Verlegenheit. Sie schien Krankenbesuche nicht gewohnt zu sein und auch nicht über die hier nützlichen Floskeln der Anteilnahme zu verfügen. Stille trat ein. Karl unterzog seine Fingernägel einer eingehenden Prüfung und befand, daß sie keiner weiteren Reinigung bedurften. Paula machte sich zwischen Bett und Vorhang klein, Bernhard schaute an seiner Vorgesetzten vorbei. Nicht einmal die loyale Rosa Zimmermann machte Anstalten, Maggie über den Moment hinweg zu helfen. Schließlich war Sonntag.
«Wie ich sehe, geht es Ihnen schon wieder besser», sagte Maggie endlich. «Es ist Ihnen wohl klar, daß der besagte Brief an mich gerichtet war. Das heißt, die Bombe galt mir.»
Erwartungsvoll hob Bernhard den Kopf. Würde das Undenkbare geschehen? Würde sie ihm danken? Es wäre das erste Mal. Man hatte schon ernsthaft daran gezweifelt, ob sie das Wort überhaupt kannte.
«Sie wissen natürlich, und Frau Zimmermann weiß es auch, daß ich es nicht ausstehen kann, wenn an mich persönlich gerichtete Post, gleich welcher Art, ohne mein Einverständnis geöffnet wird. Gar nicht ausstehen kann. Aber angesichts der Umstände wird es kein Nachspiel haben – ausnahmsweise.»
Rosa Zimmermann öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber ihr fiel beim besten Willen nichts ein. Das war ihr noch nie passiert. Noch niemals war sie jemandem, ob vorgesetzt oder nicht, eine Antwort schuldig geblieben (ohnehin war sie der Ansicht, daß Chefredakteure grundsätzlich «unter ihr» arbeiteten). Sie schloß den Mund und hoffte, niemand habe es bemerkt.
«Guten Appetit», wünschte Maggie noch und strebte zur Tür.
«Rosa», sagte Bernhard verträumt, «ich habe es mir anders überlegt. Ich werde dir nicht helfen, herauszufinden, wer hinter diesen Anschlägen steckt. Aber wenn du den Kerl identifiziert hast, stell ihn mir vor. Ich möchte ihm die Hand schütteln.»
Rosa runzelte die Stirn und wies Bernhard mit einem «tststs» zurecht. «Es geht hier nicht um Maggie oder um dich. Auch nicht um mich. Es geht um ‹Die Zeitung›.»
Paula schlich sich unbemerkt aus dem Krankenzimmer und suchte nach einem Winkel, in dem kein Rauchverbotsschild hing. In der letzten Zeit hatte sie sich mit Ernst Hamburger angefreundet, dem einzigen Mitglied der Lokalredaktion, das wie sie nikotinsüchtig war. «Diese Raucherecke wird wohl ‹der Letten› genannt», hatte Paula schüchtern ein Gespräch begonnen. «Mit dem Unterschied, daß man die Leute auf dem Letten immer noch besser behandelt hat als die Raucher bei der ‹Zeitung›», hatte Hamburger geknurrt. Seither hatte Paula nichts mehr zu ihm gesagt. Sie rauchten in freundschaftlichem Schweigen.
Als Paula um die Ecke bog, sah sie Maggie von der anderen Seite des Flurs auf die Sesselgruppe zusteuern. Paula drückte sich an die Wand. Maggie sah aus, als würde sie jeden Moment in Tränen ausbrechen. Sie ging auf einen Mann zu, der in einer Naturfreundezeitschrift las. Er sah aus wie Hugo, Paulas Nachbar. Das konnte doch wohl nicht sein. Paula schlich sich näher. Was hatte der charmante PR-Berater mit der eisernen Lady der «Zeitung» zu tun? Nichts, natürlich. Hugo würde auch nie so früh morgens seine Wohnung verlassen. Eine zufällige Ähnlichkeit, redete Paula sich ein. Sie konnte es sich nicht leisten, an einem der wenigen Freunde, die sie hatte, zu zweifeln. Der Mann stand auf, legte tröstend den Arm um Maggie und führte sie zum Lift. Dabei hielt er sich seine Zeitschrift vor das Gesicht. Als wolle er nicht erkannt werden. Langsam ging Paula auf die verlassene Sitzgruppe zu, magisch angezogen von den mächtigen Crèmeschnitten, die ihr aus einem Automaten zuwinkten.
9
In aller Ruhe nahm Paula die zweite Kanne Espresso vom Herd und schenkte sich etwa die siebte Tasse ein, als ihr mit Schrecken einfiel, daß sie an diesem Morgen zum «Einführungsvortrag für neue Mitarbeiter» geladen war. Im Druckzentrum der «Zeitung», am anderen Ende der Stadt. Paula wußte nicht einmal genau, wie sie dorthin kommen sollte. Und wann sie dort erwartet wurde. Entweder um acht oder um halb neun. Sie durchwühlte den Stapel halbgelesener Zeitungen und ungeöffneter Post auf dem Klapptisch. Nichts. Sieben Uhr fünfzig, meldete das Radio. Paula ließ den Kaffee stehen, stieg ungewaschen in die Kleider von gestern und verließ die Wohnung ohne Geld, Trambillett, Schlüssel oder Lippenstift.
Es blieb ihr nichts anderes übrig, als Ernestos Fahrrad zu entwenden, das wie immer ungesichert im Hof stand. Als wüßte er nicht, daß Veloklauen eine Art Zürcher Freizeitsport war. Nun, das würde ihm eine Lehre sein.
Es war erstaunlich kalt, ein leichter Nebel hing in der Luft, und es roch verbrannt. Paula mußte mehrmals vom Fahrrad steigen und auf die Stadtpläne an Tramhaltestellen sehen. Um zwanzig nach acht erreichte sie völlig entnervt das Druckzentrum. Zehn bis fünfzehn Leute saßen entspannt im Entree, tranken Kaffee, aßen Croissants und lasen «Die Zeitung». Paula aß zwei Gipfeli, dann wurde sie fotografiert und hielt wenig später den ersten Personalausweis ihres Lebens in der Hand. Ein erstaunliches Gefühl der Sicherheit ergriff sie (auch wenn die Brotkrumen auf ihrem schwarzen Pullover wie Schuppen wirkten). Sie nahm sich noch ein Gipfeli und entschied, daß der Tag wohl so schlecht, wie er begonnen hatte, doch nicht war.
Ein dünner Mann mit einem gewaltigen Schnurrbart kam herein und begrüßte reihum die Sitzenden, die er alle zu kennen schien. «Du bist doch der junge Albasini», sprach er einen Lehrling an und plauderte dann zwei Takte mit einer neuen Sekretärin. Kurz bevor Paula sich ausgeschlossen fühlen konnte, begrüßte er auch sie mit Namen. «Dieser Artikel, den Sie über den Sportclub in Kairo geschrieben haben – war das 1992? Hat mir sehr gefallen!»
Wow.
Vier Stunden später betrat Paula die Redaktion, beladen mit Geschenken (ein kiloschweres Buch über die «Zeitung», eine Liste all der Geschäfte, die ihr von nun an gegen Vorzeigen ihres Personalausweises Rabatt gewähren würden, vier Nummern der Personalzeitung und ein zerquetschter Schokoladenkäfer). Vom Diavortrag, den der nette Herr Sonntag über die Geschichte der «Zeitung» gehalten hatte, war Paula nicht viel in Erinnerung geblieben, aber er hatte ihr das Gefühl vermittelt, nun, da sie in die große Familie der «Zeitung» aufgenommen worden war, könne ihr nichts mehr passieren.
Überschwenglich teilte sie dieses Gefühl ihrem Rauchgenossen Ernst Hamburger mit, der nachsichtig grinste.
«So ist er eben», sagte er. «Deswegen heißt er auch der ‹sonnige Sonntag›.»
«Ich bin so froh, daß ich diesen Job bekommen habe», schwärmte Paula. «Ich war vorher nie angestellt.»
«Langsam, langsam!» Hamburger hob beide Hände. «In einer Familie geht es auch nicht immer harmonisch zu – lies nur mal ‹Die Zeitung›. Außerdem hältst du deine Zigarette verkehrt rum.» Auch das stimmte.
Ein bißchen ernüchtert begab sich Paula in die Kantine, wo Maggie ihre wöchentliche Informationssitzung abhielt.
«… zu unserer Genugtuung außer Gefahr und wird die Arbeit nächste Woche wieder aufnehmen.»
Maggie stand auf einem der Tische, die einzige Möglichkeit für sie, Rosa Zimmermann zu überragen, die sich an diesem Tag einen Sport daraus gemacht hatte, ihr Haar besonders hoch zu toupieren.
«Einmal hat sie ihren Dutt mit zwei Handtüchern aufgepolstert», flüsterte jemand Paula zu, jemand, den sie nicht kannte, der zufällig neben ihr stand, jemand, der wie sie zur «Zeitungs»-Familie gehörte.
Paß auf, warnte Paula sich, der nächste Dämpfer kommt bestimmt.
Tatsächlich zeigte Maggie, während sie vom Tisch stieg, mit einem bedrohlichen Finger auf sie.
«Sie kommen bitte noch zu mir», befahl sie.
10
Drei Freundinnen hatte Paula. Eine lebte in Kairo, eine in Keystone, South Dakota, und eine in Langenthal. Zwei von ihnen hatten Telefon. Sie wählte die Nummer in Langenthal. Später würde sie noch auf Kosten der «Zeitung» in Kairo anrufen. Vielleicht sollte sie ein Inserat aufgeben: Suche mitfühlende Freundin, Stadt Zürich, stets verfügbar. «Nimm schon ab», murmelte sie. Im selben Moment meldete sich Nicole Müller. Die Schriftstellerin hatte ein Stipendium der Lydia-Eymann-Stiftung erhalten, das eine Wohnung in Langenthal einschloß. Mit dem Zug 50 Minuten von Zürich entfernt. Leichter zu erreichen als Kairo oder Keystone, aber doch.
«Hey!» rief Nicole, offenbar unerträglich guter Laune. «Paula! Stell dir vor, wer letztes Wochenende bei meiner Lesung war!»
«Ich weiß», sagte Paula resigniert, «Maggie.»
«Maggie? Kenn ich nicht. Aber deine Chefin, Ruth-Maria Vollenweider, war da. Scheint ihr ganz gut gefallen zu haben. Sie kam danach noch mit uns in die Beiz, um etwas zu trinken. Nettes Mädchen.»
Nettes Mädchen? Das hatte wohl noch niemand in Ruth- Maria gesehen.
«Dieselbe Person», erklärte Paula, «wir nennen sie Maggie.»
«Wen bitte meinst du, wenn du ‹wir› sagst? Die von der ‹Zeitung› und dich?»
«Ich gehöre auch zur ‹Zeitung›, wenigstens vorläufig noch», verteidigte sich Paula. «Nicole, mußtest du ausgerechnet die Texte vorlesen, die du mir für meine Bewerbung zur Verfügung gestellt hast?»
Kurzes Schweigen. Nicole Müller zündete sich eine Zigarette an. «Scheiße», sagte sie. «Aber weißt du, eine Chefredakteurin kann unmöglich alle Bewerbungen auswendig kennen.»
«Doch. Die schon.»
Maggie hatte sie in ihr Büro gebeten. Dort hatte sie sich auf ihr Trimmrad gesetzt und Paula von dieser erhöhten Position aus wissen lassen, daß sie die Texte sehr wohl erkannt hatte.
«Eigentlich müßte ich Sie fristlos entlassen», hatte sie gesagt, «aber angesichts Ihrer früheren Verdienste als Journalistin gebe ich Ihnen noch eine Chance. Ich habe Sie im Auge!» (Dies war, auf arabisch wenigstens, eine Liebeserklärung, aber Paula sah davon ab, ihre Vorgesetzte auf diesen Umstand hinzuweisen.)
«Scheiße», sagte Nicole Müller noch einmal. «Und was machst du jetzt?»
«Ich gehe zur Zürcher Spezial-Ausstellung.»
Zunächst allerdings holte sie sich einen doppelten Espresso vom Automaten. Mitfühlende Kollegen, die offenbar gerade ihren Fall diskutierten, winkten sie zu sich und boten Zigaretten an.
«Verdammtes Pech», sagte einer, den sie nur vom Sehen kannte, der aber bestens informiert zu sein schien. «Früher war das nicht so. Meine Bewerbung zum Beispiel ging einfach irgendwie verloren. Mußte mich glatt selber einstellen.»
«Gute alte Zeit», murmelte Paula, während sie die umfangreiche Pressemappe der Züspa auf dem Tisch ausbreitete und nach der Liste mit den «Höhepunkten des Tages» suchte.
«Oje», murmelten die Kollegen und traten diskret den Rückzug an.
Die Züspa muß man sich vorstellen wie ein Warenhaus am 24. Dezember kurz vor Ladenschluß. Nur größer. Viel, viel größer. Angesichts der Menschenmassen kam es Paula unmöglich vor, noch einmal umzukehren. Sie kämpfte mit ihrer regennassen Tasche, ihrem Schreibblock und der Pressemappe, während sie sich von der Menge schrittweise vorwärts und in die Halle schieben ließ. Plötzlich wurde sie von hinten geschubst, stolperte und ließ die Pressemappe fallen. Ungefähr vierhundert bunte Informationsblätter flatterten zu Boden und wurden von eiligen Füßen in nassen Schuhen sofort weitergeschoben. Paula kniete sich hin und versuchte zu retten, was noch zu retten war. Mit rundem Rücken trotzte sie der Menge. Würde sie enden wie die armen Menschen in jenem Fußballstadion damals? JOURNALISTIN IM EINGANG ZUR ZÜSPA ZU TODE GETRAMPELT.
Zwischen hundert schwarze Gummistiefel schoben sich nackte Füße in Birkenstocksandalen, eine junge Frau im Trainingsanzug kniete sich neben Paula nieder und half ihr, die Blätter einzusammeln.
«Mit Ihnen müßte man dringend mal einen Konditionstest machen», sagte sie in einem Ton, der eigentlich keinen Widerspruch zuließ. Bevor Paula wußte, wie ihr geschah, saß sie auf einem Trimmrad, wie es in Maggies Büro stand, und ließ sich einen Pulsmesser aus unangenehm feuchtkaltem Gummi um die Brust schnallen.
«Sie sehen aber gar nicht fit aus», sagte die junge Frau.
Was sonst war neu?
11
Ernst Hamburger schaute auf seine Armbanduhr. «9 Uhr 29, die Sitzung ist eröffnet.» Paula rutschte mit ihrem Stuhl hinter der Stellwand hervor, hinter der sie sich sonst versteckte. Ihr Text über die Züspa war auf der Aufschlagseite, der ersten Seite des Lokal- und Regionalteils, gelandet. Auf dem Weg vom Haupteingang bis zum Dienstbüro war sie bereits zweimal darauf angesprochen worden. Doch zu ihrer Enttäuschung diskutierte man zuerst die «Hochzeitsseite», die von der berühmten ehemaligen Fernsehreporterin Marina Marini (Schwerpunkt Klatsch) gemacht wurde. Die üppige Fünfzigjährige hatte sich neben Paula gesetzt und hüllte sie in eine Parfümwolke. «White Diamonds» von Liz Taylor, mit handschriftlichem Gruß des Stars auf dem Flacon, das Marina gern und oft herumzeigte. Heute trug sie eine Art Nachthemd aus grünem Satin und eine Kopfbedeckung aus demselben Stoff.
«Seit Caroline von Monaco diese Mode lanciert hat, überlege ich mir, die Haare ganz abzuschneiden», flüsterte sie, für alle gut hörbar. «Aber ich zögere. Prinzessinnenhaare wachsen erwiesenermaßen schneller nach.»
Ernst räusperte sich. «Wir sind jetzt beim Thema Frisuren angelangt, das ich hiermit gerne abschließen würde. Es sei denn, jemand hat etwas Existentielles dazu zu sagen.»