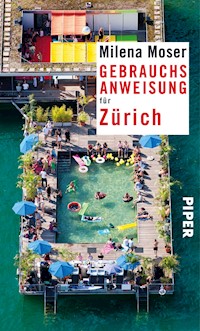9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Da hat nun Charlotte, die ordentliche, nach dem kampflosen Verschwinden der Mutter den Genießervater am Hals, Künstleragent mit nicht zu bremsendem Hang zu Vier-Sterne-Hotels, aktiven Damen und stilvollen Geschäften. Bis der sie ausgerechnet bei der chaotischen Künstlerin Delphine absetzt, deren punkige Tochter Jane ganz zufällig einen – gleichfalls abgängigen – Vater hat, der fast so heißt wie der von Charlotte. Was bleibt zwei scharfsinnigen Teenagern da schon übrig, als sich zu verbünden und auf den Kreuzzug der Schadensbegrenzung zu begeben, per Ahnenforschung und Computer? Einmal mehr erweist sich Milena Moser als die Erzählerin der tragikomischen Achterbahn von Neigungen und Bindungen in unserer Zeit – Abstürze, Kollisionen, Entgleisungen und Himmelfahrten inbegriffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Milena Moser
Mein Vater und andere Betrüger
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Da hat nun Charlotte, die ordentliche, nach dem kampflosen Verschwinden der Mutter den Genießervater am Hals, Künstleragent mit nicht zu bremsendem Hang zu Vier-Sterne-Hotels, aktiven Damen und stilvollen Geschäften. Bis der sie ausgerechnet bei der chaotischen Künstlerin Delphine absetzt, deren punkige Tochter Jane ganz zufällig einen – gleichfalls abgängigen – Vater hat, der fast so heißt wie der von Charlotte. Was bleibt zwei scharfsinnigen Teenagern da schon übrig, als sich zu verbünden und auf den Kreuzzug der Schadensbegrenzung zu begeben, per Ahnenforschung und Computer?
Einmal mehr erweist sich Milena Moser als die Erzählerin der tragikomischen Achterbahn von Neigungen und Bindungen in unserer Zeit – Abstürze, Kollisionen, Entgleisungen und Himmelfahrten inbegriffen.
Über Milena Moser
Milena Moser wurde 1963 in Zürich geboren. Sie absolvierte eine Buchhändlerlehre und schrieb für Schweizer Rundfunkanstalten. 1990 erschienen ihre Kurzgeschichten «Gebrochene Herzen oder Mein erster bis elfter Mord». Ein Jahr später schrieb sie ihren ersten Roman, «Die Putzfraueninsel», der sich schnell zum Bestseller entwickelte und dessen Kino-Verfilmung preisgekrönt wurde. Es folgten weitere erfolgreiche Romane. Seit 2015 lebt Milena Moser in Santa Fe, New Mexico.
Inhaltsübersicht
special thanks:
Marcel Zwingli für seinen Schreibtisch,der komekom für ihre Gastfreundschaft
1
Vier Tage lang war meine Mutter nicht ansprechbar. Sie saß auf der Treppe, die zur Terrasse führte, und zupfte sich mit einer Pinzette die Härchen einzeln von den Beinen. Als sie damit fertig war, stand sie auf, ging ins Haus und holte den Koffer, den sie wohl gar nicht erst ausgepackt hatte. Sie verließ uns.
«Was soll das heißen, du verläßt uns», sagte Papa, «die Ferien haben kaum begonnen.»
Mehr als vier Wochen liegen vor uns. Ich habe noch nicht einmal angefangen, die «Sagen des klassischen Altertums» zu lesen. Das Buch ist ungefähr tausend Seiten dick, und nach den Ferien sollen wir darüber geprüft werden. Es ist das erste Mal, daß ich während der Sommerferien Schularbeiten machen muß. Nach den Ferien komme ich in die zweite Klasse Gymnasium.
Ich bin dreizehneinhalb Jahre alt. Wie unser Klassenlehrer am ersten Tag nach Ablauf der Probezeit gesagt hat: Für mich hat der Ernst des Lebens begonnen.
«Komm schon, stell dich nicht so an», sagte Papa ungeduldig und dann, etwas freundlicher: «Wir werden es diesmal leicht nehmen. Wir essen im Restaurant. Damit du nicht soviel zu tun hast!»
Sie nahm ihren Koffer und ging die Treppe hoch. Auf dem obersten Absatz blieb sie stehen. So wie sie über die Schulter zurückschaute, wußte ich, daß sie es sich noch einmal überlegte. Wenn sie geht, dachte ich blitzschnell, wenn sie geht, dann muß ich nicht mehr in diese idiotische Spieltherapie, wenn sie geht, dann kann ich wieder im Schwimmklub trainieren, Papa hat bestimmt nichts dagegen, es ist nicht wahr, daß es mir zuviel wird, es ist nicht wahr. Mama seufzte.
«Es wird sich ja doch nichts mehr ändern», sagte sie, «viel Spaß wünsche ich euch beiden.»
Den hatten wir auch, Papa und ich. Wir hatten immer Spaß zusammen. Vor allem, wenn Mama nicht dabei war. Am selben Abend aßen wir im Château, einem teuren Restaurant weit draußen an der Landstraße. Weiße Tischdecken, Kerzenhalter an den Wänden, von denen Wachs über die Steine tropfte. Normalerweise fuhren wir da selten hin, weil Mama meinte, es lohne sich doch nicht, für ein Abendessen vierzig Minuten zu fahren, da sei ihr schon schlecht, wenn sie aus dem Wagen steige. Mir wird nie schlecht beim Autofahren. Papa bestellte das Gourmetmenü für uns beide, aber den Salat ohne Radieschen, das Fleisch ohne Sauce und als Beilage lieber Gemüse als Pommes frites. Ich rutschte auf dem harten Holzstuhl hin und her. Ich hasse es, wenn Papa Aufsehen erregt.
«Wer nicht meckert, wird nicht respektiert», sagte er. «Merk dir das, Charlotte. Gilt in Frankreich ganz besonders.»
«Na gut», sagte ich, «dann will ich aber kein Gemüse, ich will meine Fritten.»
Papa änderte die Bestellung noch einmal. Als er sagte «pour ma fille», schaute mich der Kellner zum erstenmal richtig an.
«Er dachte, du seist meine Freundin.»
Ich hasse es, wenn Papa so etwas sagt.
Oder wenn die Leute so etwas sagen und er sie nicht einmal korrigiert und sagt: «Nein, das ist meine Tochter.» Oft denken die Leute, ich sei Papas Freundin. Weil wir überall zusammen hingehen. Einmal waren wir zusammen bei einem Auftritt von Herbie, dem Bauchredner. Herbie, der Bauchredner, und Frank, sein sprechender Frosch, sind bei Papa unter Vertrag, deshalb muß er sich ihre Auftritte anschauen. Als Papa sich an der Kasse vor der Schlange vorbeidrängelte, sahen uns vier aus meiner Schule, die fürs Kino anstanden. «Hey», riefen sie, «laß doch den Alten und komm mit uns in den Stallone!» Ich schaute fest auf den Boden vor meinen Füßen, als ich Papa folgte. Er hatte zum Glück nichts gemerkt.
Und am nächsten Tag hörte Selina in der Kantine, ich ginge mit älteren Männern aus, um mein Taschengeld aufzubessern. «Immer noch besser, als mit seinem eigenen Vater zu Herbie zu gehen», meinte sie.
Besser! Mein Vater ist Yves Mueller, ihm gehört die Künstleragentur Mueller & Mueller. (Den anderen Mueller gibt es nicht, das ist nur, weil es so besser klingt.) Mein Vater ist viel unterwegs und läßt mich mit meiner Mutter allein. Wenn er zu Hause ist und mich mitnimmt, gehe ich überall hin mit ihm. Ins Konzert. Ins Theater. Auf Vernissagen und Apéros. Ins Café. In die Saftbar. Mein Vater ist kein langweiliger Rechtsanwalt wie Selinas Vater oder, noch schlimmer, Lehrer. Allein in meiner Klasse sind vier Väter Mittelschullehrer, bei einem Mädchen außerdem noch die Mutter; sie unterrichten beide an unserer Schule, er Geschichte und sie Deutsch.
«An deiner Stelle würde ich mich umbringen», habe ich zu ihr gesagt, und sie hat geantwortet: «Ich weiß.»
Aber eigentlich fand Selina ja Herbie peinlich. Niemand, den wir kennen, würde freiwillig einen Auftritt von Herbie, dem Bauchredner, über sich ergehen lassen. Oder von Bill Bang and his Singing Cowboys. Oder von Cindy, der Schlagersängerin, oder von Mark Zanders, dem betroffenen Barden mit der Fischerweste, in deren obersten Tasche eine Pfeife steckt, die er aber nie raucht. Kurz, von niemandem, den Papa vertritt. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er hat immer nur solche Leute unter Vertrag. Sie sind eigentlich ja ganz nett. Cindy zum Beispiel hat mir das Stricken beigebracht, als ich in der zweiten Klasse war, während der Proben zu einem Country-Musical, das ungefähr alle von Papas Schützlingen vereinte. Aber als ich das den Mädchen in meiner Schule erzählte, verzogen sie nur das Gesicht. Cindy war damals noch vor allem als «Seite-3-Girl» bekannt, das sind die mit den nackten Brüsten.
Die ganze Schweiz liebt Papas Klienten, außer den Leuten, die wir kennen, die finden sie ganz furchtbar. Mein Papa hat viele Freunde, kultivierte Leute wie Professoren und Ärzte, Pianisten und Chefredakteure, solche Leute eben. Die wissen nicht einmal, wer Mark Zanders ist, oder Bill Bang. Aber Papa schämt sich nicht. «Diese Leute haben Erfolg», sagt er, «das ist das, was die Leute sehen wollen, und ich gebe es ihnen. Wer sind wir denn, den Geschmack des Volkes zu diskutieren? Die Kulturgestapo, oder was?» Trotzdem lädt er sie nicht zusammen ein, sondern immer einzeln, entweder seine Schützlinge oder seine anderen Freunde, außer Mama hat wieder einmal alles durcheinandergebracht, und dann machen Papas Freunde die anderen fertig, und Papa wird sauer. «Man kann von ihren Produktionen halten, was man will, aber sie sind genauso sensibel wie irgendein anerkannter Künstler!» Und Mama sagt: «Das weiß ich doch», denn sie sieht keinen Unterschied, sie kann einen Liedtext von Mark Zanders auswendig lernen und in Momenten, die ihr passend scheinen, zitieren wie eine Volksweisheit. Als Cindy bei der Eröffnung eines Einkaufszentrums ein Band durchschneiden mußte, meinte Mama, der Akt sei irgendwie symbolisch für die Situation der Frau. Papa hat es aufgegeben, ihr irgend etwas zu erklären.
Papa liegt viel daran, daß seine Künstler salonfähig werden. Ein Kulturmagazin hat bereits einmal über Cindy berichtet. «Es ist doch scheinheilig, einen Unterschied zu machen», sagt er immer zu seinen intellektuellen Freunden. «Gib’s zu: Wenn deine Schwiegermutter dich gegen Mark Zanders eintauschen könnte, würde sie es tun. Lieber heute als morgen!»
Der Kellner schaute mich wieder an.
«Du gefällst ihm», sagte Papa.
«Meinst du.»
Der Kellner hat ganz dunkle Augen, dunkle Haut. Ich überlege, wie alt er wohl ist. Bestimmt schon vierundzwanzig.
«Auf unsere Ferien», sagt Papa und hebt das Glas. Wir stoßen an. Als ob wir Grund zum Feiern hätten. Ich stelle das Glas wieder ab, schuldbewußt. Ich sehe Mama vor mir, wie sie auf der Treppe saß, die Beine angezogen, vornübergebeugt. Mit dem spitzen Ende der Pinzette kratzte sie die Haut auf, um auch die eingewachsenen Härchen zu erwischen. Von der Seite sah ich ihren Bauch, in Falten gelegt zwischen den beiden Teilen ihres orangefarbenen Bikinis. Warum konnte sie auch keinen ganzen Badeanzug tragen.
Auf Fragen antwortete sie nur grunzend, stand mittags widerwillig auf, um Nudeln zu kochen, Nudeln mit rohen Tomaten oder Nudeln mit Ei, das dauerte keine Viertelstunde, das hätte ich besser machen können.
«Soll ich heute kochen?» fragte ich, und sie antwortete: «Danke, Liebes.» Ich kochte: Gemüsegratin aus Kartoffeln, Auberginen, Courgetten, Tomaten und hartgekochten Eiern. Kräuter selber gepflückt am Wegrand. Als ob sie etwas Wichtiges zu tun hätte, dachte ich und bückte mich nach silbernen Thymianzweigen, als ob ihre Wadenhärchen wichtiger wären als die Sagen des klassischen Altertums. Wo ich zum erstenmal in meinem Leben über die Ferien Hausaufgaben hatte, wo für mich der Ernst des Lebens eingesetzt hatte, da könnte sie doch schon ein wenig Rücksicht nehmen.
Sie sagte nichts zu meinem Gratin und nichts zu meinem Salat mit gebratenem Ziegenkäse. Meine Freundin Selina muß zu Hause nie kochen, und wenn, dann macht sie Rühreier mit Ketchup. Wenn Frau Bauer übers Wochenende wegfährt und sie mit ihrem Bruder allein läßt. Selinas Bruder heißt Robertino nach Robertino Rossellini, in den Frau Bauer früher einmal verliebt war, jedenfalls erzählt sie das so, und die anderen nennen ihn natürlich Tortellino Tortellini. Robertino ist siebzehn, aber er kann rein gar nichts. Einmal hat mich Selina eingeladen, als ihre Mutter auf einer Schönheitsfarm war, und ich schaute zu, wie Robertino eine Konservendose öffnete, Erbsen und Möhren, 500 g, und den Inhalt mitsamt der Konservierflüssigkeit in die Friteuse schüttete. Es gab einen Kurzschluß. Selinas Mutter sagte, wir hätten alle tot sein können und sie hätte gar nicht erst wegfahren dürfen. Sie sah auch gar nicht schöner aus als am Freitag. Letztes Jahr dachte ich noch, ich wäre in Robertino verliebt, denn Selina war meine beste Freundin. Aber dann bekam er plötzlich lange Arme und große Füße und begann mich und Selina als Babies zu bezeichnen. Er fing an zu rauchen, obwohl heutzutage niemand mehr raucht, und er ließ sich die Haare wachsen, bis er aussah wie Jimi Hendrix auf dem Poster, das an seiner Zimmertür hing. Jimi Hendrix! «Ich weiß wirklich nicht, wo der Junge diese Haare her hat», sagte Herr Bauer beim Essen, Herr Bauer hatte selber nur sehr wenig Haare auf dem Kopf. Selina erklärte es ihm: «Er hat sie sich machen lassen, was denkt ihr denn, das ist eine Afrodauerwelle.»
Das muß man sich einmal vorstellen.
Mama sagte nichts zu meinem Essen. Sie saß am Tisch und starrte direkt durch uns hindurch. Papa und ich unterhielten uns die ganze Zeit allein. So ist Mama sonst nur, wenn sie Romane liest. Sie liest immer diese amerikanischen Romane, tausend Seiten und mehr.
«Ich glaube, du kaufst sie nach Gewicht», sagt Papa. Manchmal erzählt sie uns davon: «Jill, also, das ist die Schwester von Judy, Jill ist sich jetzt doch bewußt geworden, daß sie Damian immer noch liebt, also Damian, das ist der Mann von Judy, also von ihrer Schwester …»
Papa verdreht die Augen. Er tut nicht einmal so, als würde es ihn interessieren. Wenn Mama das merkt, bricht sie mitten im Satz ab. Aber oft merkt sie es nicht. Sie merkt nicht, daß Papa es ironisch meint, wenn er sie beim Essen fragt, was sie denn da Interessantes lese.
Aber in diesen Ferien hat sie nichts gelesen. Sie hat sich die Waden enthaart. Und von ihren Waden konnte sie uns nichts erzählen.
«Was denkst du», hätte er sie fragen sollen, nicht «was tust du». Aber er hat sie gar nichts gefragt.
Papa bestellte Armagnac zum Kaffee, ich bestellte ein Schweppes. Zu jedem Armagnac ein Schweppes. Als der Kellner die vierte Runde brachte, mußte ich rülpsen. Ich hielt mir die Hand vor den Mund. Wir waren die letzten im Restaurant. Ich wollte nach Hause. Ich schaute den Kellner nicht mehr an. Was er jetzt wohl dachte.
«Einen noch», sagte Papa, und dann erzählte er die Geschichte von den Nonnen in Rom. Ich kannte die Geschichte schon. Papa erzählt sie immer, kurz bevor der Abend zu Ende ist. Dann verlangte er die Rechnung. Sie kam auf einem kleinen Teller mit drei Pralinen. Ich aß sie alle drei.
Das Haus war dunkel. Sie war nicht zurückgekommen. Papa brauchte eine Weile, um die Tür aufzuschließen. Ich ging durchs Haus und zündete überall die Lichter an. Sie war in keinem Zimmer. Der Kleiderschrank war leer. Das Bett gemacht. Sie war weg.
Papa schenkte sich einen Calvados ein. «Der gute alte Père Magloire», sagte er, «ich gehe erst zu Bett, wenn er mich schickt.» Père Magloire auf dem Etikett trägt eine gestreifte Schlafmütze. Papa behauptet, er zwinkere ihm zu, wenn es genug sei.
Ich ging schlafen. In meinem Zimmer lief noch der Fernseher. Papa hat ihn mir geschenkt. Damit ich Französisch lerne.
«Es gibt nichts Besseres, um eine Sprache zu lernen», sagte er. «Versteh den staatlichen Sender, und du verstehst das Land.» Mama war gegen den Fernseher. Aber sie sagte nichts. Zog nur so ein Gesicht. Dabei sind meine Französischnoten gut. Meine Noten sind sozusagen alle gut. Ich kann nur nicht sprechen. Französisch. Ich höre mir selber zu und weiß, es klingt falsch. Da geniere ich mich. Lieber sage ich nichts.
Im Fernsehen lief eine Diskussionssendung. Ich verstand nicht recht, worum es ging. Eine Frau stand plötzlich auf und ging auf einen dicken Mann los, der auf einem anderen Sofa saß, und schlug ihn mit beiden Fäusten. Der Mann schubste die Frau weg, so daß sie quer durchs Studio flog. Der Moderator mischte sich ein, und der dicke Mann verdrehte ihm den Arm, so daß die Sendung unterbrochen werden mußte. Nach dem Werbeblock hielt der Moderator den Arm in einer Schlinge, einem verwegenen schwarzen Dreieckstuch. Ich habe immer noch nicht verstanden, worum es ging. Ich weiß nicht einmal, wer der dicke Mann ist. Vielleicht ein Politiker. Ich schaltete den Fernseher aus. Morgen frage ich Papa. So etwas weiß Papa.
Mit Papa kann ich über alles reden, er versteht mich. Er ist mit allem einverstanden, was ich sage. Er kann gut zuhören. Er unterbricht mich nicht. Er sagt nur «hm, hm, hm» und nickt, und wenn ich fertig bin, schaut er mich so an, als wollte er fragen: «Ist es das?», und dann sagt er: «Ich verstehe dich, Kleine, du hast ja recht.» Dann klatscht er sich mit beiden Händen auf die Oberschenkel und steht auf und sagt: «Laß uns etwas unternehmen.» Mein Papa ist praktisch veranlagt: wenn er ein Problem erkennt, sucht er sofort die Lösung dazu. So hat er mich ins Schwimmbad mitgenommen, als ich plötzlich nicht mehr lesen mochte, das war, als Mama mit den amerikanischen Romanen anfing, da hörte ich damit auf. Wir konnten ja nicht beide auf dem Bett liegen und lesen. Ich nahm es Mama übel, daß sie mir das Lesen weggenommen hatte, aber von da an war Lesen für mich eine Aufgabe, eine Pflicht, meine ich, etwas eher Anstrengendes, und ich las nur noch Fachbücher, Enzyklopädien und gute Literatur. Auch dabei konnte mir Papa helfen. Wenn Papa zu Hause war, ging er jeden Morgen um sieben ins Schwimmbad und schwamm zwei Kilometer. Irgendwann fing er an, mich mitzunehmen, und bald war ich so gut, daß mich der Schwimmlehrer in der Schule im Schwimmklub anmeldete. Ich gewann in kürzester Zeit eine Menge Wettbewerbe. Im Schwimmklub war niemand biestig; solange man nur gute Zeiten schwamm, war man akzeptiert. Die Kinder kamen aus anderen Stadtkreisen, ich fing an, mich nach der Schule mit ihnen zu verabreden, und bald war es mir egal, daß die Mädchen in meiner Klasse mich nicht mochten, und dann war die Primarschulzeit auch schon zu Ende, und alles wurde sowieso anders.
So hat mein Papa mich gerettet.
2
«Ich kann das Haus nicht mehr sehen», sagt Papa beim Frühstück, «laß uns ein bißchen rumfahren.»
Während ich putze und packe und aufräume, steht er im Flur und klimpert mit den Autoschlüsseln. Ich will das Haus so zurücklassen wie immer am Ende der Ferien, die Betten abgezogen, die Wäsche gemacht, das Wasser abgedreht und das Klo zweimal durchgespült. Normalerweise macht das Mama.
«Komm jetzt endlich», sagt Papa. «Wir haben schon den halben Tag vertrödelt.»
Dabei ist er derjenige, der erst um elf aufgestanden ist.
Ich steige hinten ein.
«Bin ich dein Chauffeur, oder was», fragt Papa, «komm gefälligst nach vorn.»
Ich ziehe die Schuhe aus und stemme die Füße gegen das Handschuhfach. Normalerweise sitze ich nur vorn, wenn er mich zur Schule fährt, und das kommt nicht oft vor.
«Sieh mal nach, wo wir sind.»
Ich falte die große Frankreichkarte auseinander. Im Kartenlesen bin ich gut. Sechs Jahre bei den Pfadfinderinnen. Unterwegs bittet Papa oft mich, die Karte zu lesen, weil Mama ein hoffnungsloser Fall ist. Sie hat einfach keinen Orientierungssinn.
«Wenn du denkst, du weißt, wo du lang mußt, geh einfach in die entgegengesetzte Richtung», rät er ihr immer. Mama wird nervös, wenn sie die Karte lesen soll.
Einmal waren wir in Paris, da hielt sie die ganze Zeit den Stadtplan auf dem Kopf. Ich hab es schließlich gemerkt, dabei war ich erst elf, «du hältst den Plan verkehrt, Mama», hab ich gesagt, und ich habe auch die Straße gefunden und das Café, wo wir Papa treffen sollten. Sie versprach mir einen ärmellosen Pullover von agnes b., wenn ich es Papa nicht erzählte. Hab ich auch nicht. Er hat es selber erraten.
An diesem Tag fuhren wir nur bis St. Raphael, das war der nächstgrößere Ort, keine zwanzig Kilometer entfernt.
«Soll ich dir mal was sagen, ich hasse das Landleben!»
Papa lachte. In St. Raphael gab es einen Yachthafen und einen Strand, Warenhäuser, eine Menge Bars und Lokale und eine Maison de Presse, wo er Zeitungen und Zeitschriften in vier Sprachen kaufte. Zwei Mädchen aus meiner Klasse waren hier im Feriensprachkurs, ich hatte mir die Telefonnummer vom Kurslokal notiert, wenn wir länger blieben, würde ich sie vielleicht anrufen.
Wir saßen an einem Plastiktisch an der Promenade. Papa trank offenes Bier und baute den Zeitschriftenstapel ab.
«Hier ist etwas für dich», sagte er und schob eine Illustrierte über den Tisch. «Etwas für junge Mädchen.»
«Aber das ist auf französisch.»
«Natürlich ist es auf französisch. Was hast du denn gedacht?»
Das Heft hieß 20ans, und obwohl ich erst fast vierzehn war, fand ich es sterbenslangweilig. Unmögliche Modefotos und Geschichten über französische Schlagersänger und Fernsehansager, von denen kein Mensch je gehört hat, für die sich kein Mensch interessiert. Ich nahm mir Le Monde vom Stapel.
«Du hältst sie verkehrt rum», sagte Papa.
Ich seh auf den ersten Blick, daß mir nichts von all den Sachen passen würde. Oder nur gefallen. Niemand bei uns in der Schule würde so etwas tragen. Alles billig, knalleng und bunt. Die Mädchen hier tragen so was, und lange Haare mit glitzernden Plastikspangen festgesteckt. Dunkelbraune Beine und Schuhe mit hohen Absätzen. Rosa womöglich. Sogar dreißigjährige Frauen ziehen sich so an. Ich versteh das nicht.
«Such dir was aus», sagt Papa. Mit einer großartigen Geste, die die kleine Bude an der Strandpromenade, die vier Kleiderstangen auf Rädern, die dichtgehängten Fähnchen einschließt. Papa hat normalerweise einen besseren Geschmack. «Was du willst. Was immer du willst.»
Kann er so etwas nicht in einem anständigen Kleidergeschäft sagen? Seit über einem Jahr kaufe ich meine Kleider selber. Weil bei uns zu Hause keiner eine Ahnung hat. Frau Bauer nimmt mich manchmal mit, wenn sie für Selina einkaufen geht. Sie geht mit uns in das traditionsreiche Warenhaus Grieder, wo sie uns Bundfaltenhosen, flache Lederschuhe und Jacken mit Goldknöpfen kauft. Die Mädchen in meiner Klasse ziehen sich alle ähnlich an, jedenfalls die, mit denen ich viel zusammen bin. Zu Hause sammle ich Modetips in einem Ordner. Mein Schrank ist organisiert. Auf der Innentür klebt eine Liste von meinen Sachen, mit Datum trage ich ein, wann ich was womit kombiniert getragen habe. Mama findet das nicht normal. Mama ist ganz anders als ich. Sie weiß überhaupt nicht, was ihrem Typ und ihrem Alter entspricht. Sie geht in diese Billigläden, die eigentlich für Jugendliche eingerichtet sind, und kauft sich Berge von Sachen, die ihr nicht passen, weil sie sie nicht probiert hat. Und der Rest läßt sich nicht miteinander kombinieren. Dann wirft sie alles, was eigentlich gereinigt werden sollte, in die Waschmaschine, aber die Sachen lösen sich sowieso bald auf. Einmal hat sie versucht, eine Stretchhose zu bügeln, der Stoff schmolz sofort am Bügeleisen fest und zog schwarze Fäden. Das Bügeleisen mußten wir auch wegwerfen.
Mama trägt Sachen, die ich nie anziehen würde, einen veilchenfarbenen Satinrock in Knielänge, unter dem sich ihre Unterhosen abzeichnen, Techno-T-Shirts, Mohairpullover, die knapp den Rippenbogen bedecken. Genau das Zeug, das sie in 20ans abbilden, Sachen halt, die für junge Mädchen gedacht sind und nicht für Mütter mit faltigen Bäuchen und Unterhosen, die einschneiden. Ich zeigte meiner Mutter einen Zeitungsartikel über eine Schweizer Designerin, die seit zehn Jahren dieselbe Grundgarderobe trägt, und sagte, echter Stil sei zeitlos. Mama verstand natürlich nicht, was ich meinte.
«Charlotte», sagte sie, «das gilt doch nicht für Kinder. Niemand erwartet von dir, daß dir die Sachen, die du heute kaufst, in zehn Jahren noch gefallen.»
Darauf brauchte ich wohl nichts mehr zu sagen, und ich tat es auch nicht, ich ging in mein Zimmer, schnitt das Interview aus und klebte die Seite in meinen Ordner.
Ich bin kein Kind.
Meine Kindheit war unglücklich, aber jetzt ist sie Gott sei Dank vorbei.
Eine Umkleidekabine gab es auch nicht, und so mußte ich mich zwischen den Kleiderständern aus meinem Wickelrock schälen und ein neonfarbiges Stretchteil über den Kopf ziehen, während die Verkäuferin und Papa mir zuschauten und sich über meine Figur unterhielten.
«Mais, elle est mignonne, la petite», sagte die Verkäuferin, und das verstand ich gerade noch, eine Frechheit, wenn man bedenkt, daß ich einen Meter sechsundsiebzig groß bin und der Kinderarzt ausgerechnet hat, daß ich noch weiter wachse bis einszweiundachtzig.
«Du hast einen hübschen Körper, den darfst du ruhig zeigen», sagte Papa, und ich wäre wieder mal am liebsten gestorben. Dauernd sagt er solche Sachen! Zum Glück konnte ihn niemand verstehen.
«Also gut, ich nehme das Oberteil.»
«Nichts da!» Papa riß ein paar Bügel von der Stange und warf sie mir zu. «Los, bedien dich, schlag zu!»
Die Verkäuferin strahlte, als sie begriff, daß es ihm ernst war. Sie bückte sich unter den Kassentisch und kramte noch mehr leuchtendbunte und häßliche Stretchteile hervor. Zwei junge Mädchen mit großen Rucksäcken schauten neidisch zu, wie unser Kleiderberg auf dem Kassentisch wuchs und wuchs und Papa mit seiner goldenen Kreditkarte alles bezahlte. Zum Schluß schenkte mir die Verkäuferin noch ein dunkelrosa Stirnband, an dem eine leuchtende Tüllblume befestigt war. Dabei schaute sie die ganze Zeit meinen Vater an. «Merci, Madame», murmelte ich und steckte das Ding in meine Tasche. Sobald ich konnte, würde ich es wegwerfen. Ich trug einen strengen Kurzhaarschnitt mit Seitenscheitel, den man alle sechs Wochen nachschneiden mußte, und die Haare hinter die Ohren gestrichen, ich konnte kein Haarband tragen und auch keine Plastikklemmen in Dinosaurierform.
Für das Geld, das Papa in dem Laden ausgegeben hatte, hätte ich mir eine Hose bei Donna Karan kaufen können, und die hätte ich bis ans Ende meiner Tage getragen. Aber das konnte ich ihm jetzt nicht erklären.
«Geht es uns nicht gut?» fragte er. «Geht es uns nicht gut?»
Wir mieteten zwei Liegestühle und einen Sonnenschirm an einem privaten Strandabteil.
«Ist das nicht ein bißchen teuer?» fragte ich.
«Du redest schon wie deine Mutter.»
Er legte sich auf die dicke blauweiß gestreifte Matratze und schlief sofort ein. Ich wußte, daß er sich nicht eingerieben hatte, aber ich weckte ihn nicht auf. Sollte er sich doch einen Sonnenbrand holen.
Ich versteckte mein Buch und mein Portemonnaie unter meiner Matratze und ging zum Strand hinunter. Ich war die einzige Frau unter achtzig, die nicht oben ohne ging oder wenigstens im Bikini. Die allein war und nicht eingehakt mit einer Freundin ging, die nicht gnadenlos braungebrannt war, keine langen Haare mit Dauerwelle und keine Fußkettchen trug, die einzige, die ins Wasser ging, um zu schwimmen und nicht nur, um kreischend über die schaumigen Ausläufer zu hüpfen.
Während ich mich noch anfeuchtete, versuchten zwei Jungen mich naßzuspritzen. Als ich nicht reagierte, tauchte einer unter, faßte meine Knie und versuchte mich unterzutauchen. Da hatte er Pech, denn ich war immer noch eine sehr gute Schwimmerin, obwohl ich seit einem halben Jahr nicht mehr trainiert hatte. Früher schwamm ich zwei Kilometer in dreißig Minuten. Ich wand mich los, stieß mich an seinen Oberschenkeln ab und schoß unter Wasser davon wie eine Harpune. Weit, weit entfernt tauchte ich wieder auf. Sie standen immer noch im seichten Wasser und starrten mir nach. Wahrscheinlich hatten sie gedacht, ich sei ertrunken, Ich winkte kurz und kraulte davon.
Zum Ausruhen legte ich mich auf den Rücken und ließ mich treiben. Ich dachte daran, wie sich die Schenkel des Jungen an meinen Fußsohlen angefühlt hatten. Ich hasse Jungen, die sich so aufführen. Ich dachte an Milos, Milos Meier aus meiner Schule, in den ich verliebt war.
Jedenfalls glaubte ich das.
Wir aßen immer zu fünft in der Kantine: Ich und Selina, außerdem Annina, Martina und Sabrina. Selina hatte die Mädchen ausgesucht. Die anderen fand sie alle blöd. Ich hielt mich eng an Selina, die mich bis dahin auch immer blöd gefunden hatte, wie alle anderen Kinder in der Straße und in meiner Klasse. Obwohl Selina gleich gegenüber wohnt, hat sie nie mit mir gespielt, sie hat immer gesagt, sie dürfe nicht. Doch seit wir beide ins selbe Gymnasium gehen, ist alles anders. Ich darf sie morgens abholen, weil wir denselben Weg haben, und nach der Schule nimmt sie mich auch manchmal mit zu sich nach Hause. Und auch Frau Bauer ist richtig freundlich zu mir, früher hat sie mich noch manchmal weggeschickt, wenn sie Gäste hatten, sie sagte: «Geh hinten raus, damit die Leute dich nicht sehen.» Unterdessen bin ich jeden Tag bei ihnen, Selina ist meine beste Freundin. Anfangs traute ich der Sache natürlich nicht so recht, ich hielt mich immer dicht an Selina und bemühte mich, nichts falsch zu machen. Ich machte einfach alles so wie sie. Damit sie mich bloß nicht wieder fallenließ.
Zu fünft saßen wir an einem Tisch in der Kantine, auf den sechsten Stuhl legten wir unsere Bücher, damit sich niemand zu uns setzte, den wir blöd fanden. Schon nach wenigen Wochen in der neuen Schule waren die anderen alle in irgendeinen Jungen verliebt, natürlich nicht aus der Ersten, denn die sind wirklich alle blöd und schlimmer als das: total unreif. Benjamin zum Beispiel veranstaltet in seiner Freizeit Wettrennen mit seinen Meerschweinchen, er bewirft sie mit leeren Colabüchsen, um sie anzutreiben, und manchmal kommt sein bester Freund vorbei, der sein eigenes Meerschweinchen mitbringt, und dann wetten sie. Ganz offen hat er mir das erzählt, in einer vollbesetzten Straßenbahn, das muß man sich mal vorstellen.
Nein, die anderen Mädchen hatten sich Jungen aus der zweiten und dritten Klasse ausgesucht, die kannte ich noch nicht einmal vom Sehen, ich hatte mich so auf die Schulstunden konzentriert und darauf, die Probezeit mit möglichst guten Noten zu schaffen, daß ich mir nicht auch noch die Jungen aus den oberen Klassen anschauen, geschweige denn ihre Namen merken konnte. Selina ging es wie mir, und wir überlegten schon, an einem anderen Tisch zu essen, als sie eines Tages aus heiterem Himmel zugab, daß sie in den Vizepräsidenten der Schülerorganisation verknallt war, der zu uns in die Klasse gekommen war, um Broschüren zu verteilen.
«Da ist es passiert», sagte sie, «einfach: peng!» Und jetzt wollte sie Klassensprecherin werden, damit sie ihn wenigstens bei den Schulversammlungen sehen würde. Der Vize hieß Fredy und ging in die 5 b, das hieß, daß er mindestens sechzehn Jahre alt war, wenn nicht siebzehn.
«Das kannst du doch unmöglich ernst meinen», sagte ich, aber von da an drehten sich die Gespräche beim Mittagessen nur noch um diese Jungen, ob man sie heute schon irgendwo gesehen hatte, ob man sich getraut hatte, hallo zu sagen, und wie man diesen Blick deuten sollte, den man sich vielleicht auch nur eingebildet hatte. Ich hatte nun die Wahl, mich an einen anderen Tisch zu setzen oder mich so schnell wie möglich auch zu verlieben. Also behauptete ich einfach, ich hätte mich auch verliebt. Da mir auf die Schnelle kein anderer einfiel, sagte ich: «In Milos Meier von der Hefteverkaufsstelle.» Die ersten paar Tage tat ich bloß so, und Selina mußte mich mehr als einmal darauf hinweisen, daß er eben die Kantine betreten hatte, aber mit der Zeit verliebte ich mich richtig und echt. Ich hatte bereits mehr Hefte, als ich in meiner ganzen Schulzeit brauchen würde, und jetzt vermißte ich ihn sogar in den Ferien, das konnte doch nichts anderes heißen, als daß ich ihn wirklich liebte.
Ich würde in ganz Frankreich keinen anderen Jungen anschauen, schwor ich mir, bevor ich mit energischen Zügen ans Ufer zurückschwamm.
Mein Liegestuhl war besetzt. Ein rosa Tuch mit Sonnenuntergang lag darauf, eine dunkelbraungebrannte Französin in einem winzigen lila Bikinihöschen saß im Schneidersitz und beugte sich zu meinem Vater hinüber, um ihn mit Sonnenöl einzureiben. Ihre Brüste baumelten dicht über seinem Rücken.
«Pardon», sagte ich und griff unter die Matratze. Mein Buch und mein Portemonnaie waren noch da. Ich öffnete das Portemonnaie, um zu sehen, ob Geld fehlte. Ich zählte es. Die Dame hob eine Augenbraue, bis sie unter ihren Haaren verschwand. Es war eine falsche Augenbraue. Aufgemalt. Papa sah nichts, weil er auf dem Bauch lag und die Augen geschlossen hatte. Ich hob mein Badetuch vom Boden auf, sie hatte es einfach auf den Boden geworfen, ich schüttelte es aus. Sie kreischte auf, als die Sandkörner sie trafen. Ihre eingeölte braune Haut sah nun aus wie paniert.
Papa rührte sich. Er stellte mir die Dame vor. Sie hieß Jacqueline und war hier mit einer Freundin in den Ferien. Sie würde uns die Gegend zeigen. Papa kam hierher, seit ich auf der Welt war und länger, ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, was sie ihm noch zeigen wollte, aber ich sagte nichts. Ich grüßte höflich und legte mein Tuch neben die Liegestühle auf den Sand. Jacqueline protestierte, sie wolle mir meinen Platz nicht wegnehmen, sagte sie, aber mir war klar, daß sie sich nur zu meinem Papa auf das andere Liegebett legen wollte. «Non, non», sagte ich und «s’il vous plaît». Ein dicker Strandwärter mischte sich ein, ich dürfe in diesem Bereich nicht auf dem Boden liegen, das hier sei ein Privatstrand und ich müsse mir einen Liegestuhl mieten, wo käme man da hin. Papa rappelte sich auf und erkundigte sich gereizt, was denn eigentlich los sei. Es sah ganz so aus, als wollte er mir die Schuld an allem geben. Jacqueline stritt sich lautstark mit dem Strandwärter herum, schließlich habe sie bereits einen Liegestuhl gemietet in Reihe elf, und solange sie den bezahlt habe, könne es ihm doch egal sein, ob sie dort liege oder hier. Na ja schon, aber la petite könne hier nicht im Sand liegen bleiben, das sei gegen die Vorschrift, und wie sehe das denn aus. Ich wäre am liebsten sofort gegangen, aber Papa sah nicht so aus, als würde er mir jetzt einen Gefallen tun. Ich machte mich unsichtbar. Schließlich rutschte Jacqueline auf Papas Liegestuhl hinüber, rutschte ganz dicht an ihn heran und legte eines ihrer Beine wie eine Klammer über seinen Körper.
«Zufrieden?» Mehr zu mir als zum Strandwärter.
Ich legte mein Tuch auf den wieder freigewordenen Liegestuhl. Durch mein Badetuch hindurch konnte ich ihr Kokosöl riechen. Kokosöl und Schweiß.
Wir trafen uns zum Abendessen um neun in einer Touristenpizzeria. Kam mir nicht so vor, als sei das ein Geheimtip. Aber Papa tat direkt so, als kenne er sich überhaupt nicht aus und ließ sich brav von den beiden Frauen herumführen. Ich sagte sowieso nichts. Jacqueline hatte ihre Freundin mitgebracht, sie hieß Monique. Monique sah ganz ähnlich aus wie Jacqueline, nur mit rot gefärbtem Haar. Beide waren das Jahr über Lehrerinnen in Clermont-Ferrand. Beide waren geschieden. Sie machten hier einen ganzen Monat Ferien, während ihre Kinder bei den Exvätern waren. Der Monat war schon beinah um, und sie hatten immer noch nichts erlebt. Jetzt mußten sie auch noch zu zweit mit einem einzigen Mann ausgehen, der seine Tochter mitnahm, die nicht viel sagte. Monique zeigte mir Fotos von ihren eigenen Töchtern, die in meinem Alter sein sollten. Die sahen aber eher aus wie zwanzig. 20ans. Brüste und alles. Ich fragte mich, wann ich wohl Brüste bekommen würde, wenn überhaupt. Ein bißchen Brüste hatte ich schon seit einem Jahr und auch zwei Sport-BHs aus schwarzer beziehungsweise weißer Baumwolle. Selina und ich hatten unsere BHs zusammen gekauft, das heißt, ich bin einfach mitgegangen, als sie ihren BH kaufte, und obwohl ich selber noch keinen brauchte, habe ich denselben genommen wie sie. In Weiß und in Schwarz. Um für alle Fälle gerüstet zu sein. Ich hatte auch eine Schachtel Mini-Tampons. Man konnte ja nie wissen.
«Ich weiß doch, wie die jungen Mädchen sind», sagte Monique. Sie wußte gar nichts. Eine ihrer Töchter trug Silberringe, eine ganze Reihe die fleischige Nasenwand hinauf.
«Das hat bestimmt weh getan.»
«Meine Tochter ist eben eine kreative Persönlichkeit», sagte sie beleidigt, «eine Künstlerin.»
«Natürlich.»
Monique packte ihre Familienbilder wieder ein.
«Und wohin gehen wir jetzt?» fragte Papa. Er zahlte die ganze Rechnung. Das fand ich nicht richtig.
«So teuer!» rief ich. «Wieviel ist das denn in Schweizer Franken?» Er wies mich mit einem Zungenschnalzen zurecht.
«Ist doch wahr», murmelte ich beim Hinausgehen, aber leise.
Wir gingen in eine Bar. Ich bestellte ein Schweppes. Wir gingen in eine Disco. Ich bestellte ein Schweppes. Es war noch nichts los. Papa tanzte mit beiden Frauen gleichzeitig. Sie waren ganz allein auf der Tanzfläche. Ein paar Jungen in hellen Jacken stützten sich mit den Ellbogen auf die Bar und schauten ihnen zu. Sie machten Bemerkungen und lachten. Hoffentlich merkten sie nicht, daß ich zu denen gehörte. Ich rutschte auf der Plüschbank weiter, bis ich am nächsten Tischchen saß. Ich bestellte noch ein Schweppes, nur, weil mit der Bestellung eine neue Schüssel Salznüsse gebracht wurde. Dann kam Papa und holte mich zum Tanzen. Ich wollte nicht, aber er zog mich am Arm. Ich genierte mich. Ich kann nicht discotanzen, nur klassisch, wie ich es im Tanzkurs gelernt habe.
«Wir tanzen nach Vorschrift», beruhigte mich Papa, und dann gab ich nach, weil ich einsah, daß ich mehr Aufsehen erregte, wenn ich mich wehrte. Außerdem war die Tanzfläche unterdessen nicht mehr ganz leer. Monique und Jacqueline zuckten und shakten und warfen die Arme in die Luft im weißen Licht. Ich schaute weg.
«Eins, zwei, chachacha», sagte Papa und schob mich über die Tanzfläche. Nach einer Weile begann es mir zu gefallen. Ich tanze gern mit Papa, vor allem, wenn Mama nicht dabei ist und ich kein schlechtes Gewissen haben muß, wenn sie allein bleibt. Sie oder ich, darauf läuft es hinaus. Keine von uns traut sich, mit einem Fremden zu tanzen.
«Es geht doch», sagte Papa. Das sagt er immer. Gerade, als ich mich sicher genug fühlte, eine Drehung zu wagen, schob sich Jacqueline zwischen Papa und mich und brachte mich zum Stolpern. Ich bin sicher, sie hat es absichtlich getan. Ich verließ die Tanzfläche und bestellte noch ein Schweppes.
Ich war das einzige Mädchen, das ganz allein herumsaß, die anderen waren wenigstens in Gruppen und amüsierten sich, ich hätte besser einen Orangensaft bestellt, da sieht man nicht gleich, daß kein Alkohol drin ist. Ein junger Mann forderte mich zum Tanzen auf, aber ich sagte nein, das heißt, in Wirklichkeit sagte ich gar nichts, ich war ganz in Gedanken versunken, ich schrak auf, als er plötzlich vor mir stand, starrte ihn an und schüttelte den Kopf, aber da hatte er sich schon umgedreht. Im nächsten Augenblick wünschte ich, ich hätte ja gesagt. In der Primarschule waren wir elf Mädchen und zehn Jungen, das heißt, eine blieb bei den ersten Parties immer übrig, und das war immer ich. Einmal, als Damenwahl angesagt wurde, schubste ein Junge, auf den ich zusteuerte, Harald Segantini, glaube ich, einen anderen vor, so daß der ausrutschte und hinfiel. Es war sehr peinlich. Als ich nach Hause kam, gab ich meiner Mutter die Schuld. Alle hatten einen Minirock, nur ich nicht. Kein Wunder, wenn niemand mit mir tanzen wollte. Für die nächste Party kaufte sie mir einen, aus blauem Leder mit Reißverschluß. Es kam aufs selbe heraus.
Deshalb bin ich in den Tanzkurs gegangen. Im Tanzkurs konnte so etwas nicht passieren, denn da wurden immer ein paar Fortgeschrittene gebeten, mit den Mädchen zu tanzen, die sonst übrigbleiben würden. Wenn man Glück hatte, tanzte man mit einem achtzehnjährigen Jungen, der alle Schritte beherrschte und sogar noch größer war als man selber.
«Hier ist überhaupt nichts los», quengelte Monique, als sie eine Tanzpause einlegten, um neue Drinks zu bestellen, «gehen wir doch woanders hin!»
Papa geht immer gern aus, denn man kann nie wissen, wo man ein neues Talent entdeckt. In den Winterferien, in einem kleinen Dorf in den Bergen, entdeckte er ein junges Mädchen, das abends in der Hotelbar sang, er bot ihr an, sie unter Vertrag zu nehmen, aber sie traute ihm nicht. Jahre später brachte sie zwei Platten heraus und wurde berühmt. Papa ärgerte sich grün und blau. Er war richtig erleichtert, als sie einen Fernsehmoderator heiratete, Zwillinge bekam und sich aus dem Showbusiness zurückzog.
Wenn er keine neuen Talente entdeckt, dann findet er vielleicht ein Lokal mit interessanten Auftrittsmöglichkeiten für einen seiner weniger bekannten Schützlinge. Mein Papa ist immer bereit, noch ein nächstes Lokal aufzusuchen, rein schon von Berufs wegen.