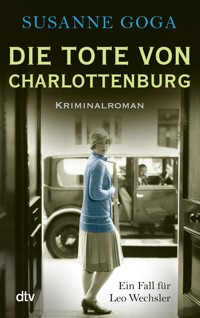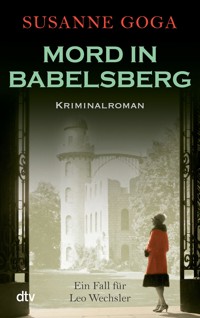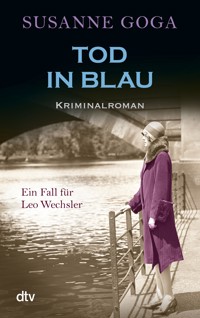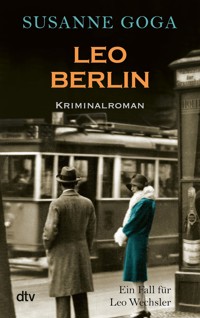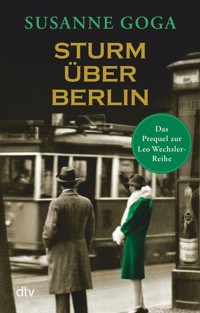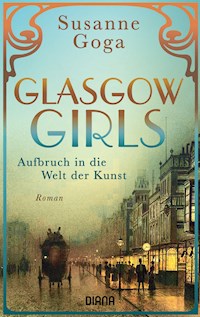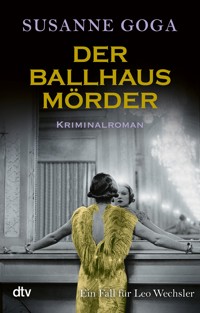5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn ein einzelnes Blatt Papier den Tod bedeuten kann
England 1821: Georgina Fielding ist im besten heiratsfähigen Alter, interessiert sich aber mehr für Geologie als für potenzielle Ehemänner. Als sie eine wertvolle Fossiliensammlung und ein rätselhaftes Notizbuch erbt, ist ihre Neugier geweckt. Mithilfe des Reiseschriftstellers Justus von Arnau begibt sie sich auf die Spurensuche. Rätsel gibt ihnen insbesondere eine einzelne Manuskriptseite auf. Sie ist in Spiegelschrift geschrieben wie die Werke Leonardo da Vincis – und hat einen brisanten Inhalt…
Susanne Goga lässt uns an den Anfängen jener revolutionären Wissenschaft teilhaben, die im frühen 19. Jahrhundert an den Grundfesten des Glaubens rüttelte: der Geologie. Zugleich aber ist »Das Leonardo-Papier« die packende Geschichte einer jungen Frau, die sich über Konventionen hinweg setzt und ihren guten Ruf riskiert, um das Geheimnis ihrer Herkunft zu lösen – und ihr persönliches Glück zu erobern.
Ein fesselnder historischer Roman, in dem Leonardo da Vincis »Codex Leicester«, das teuerste Buch der Welt, eine entscheidende Rolle spielt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
SUSANNE GOGA
Das Leonardo-Papier
Roman
Susanne Goga im Gespräch
Wie entstand die Idee zu »Das Leonardo-Papier«?
Diese Frage beantworte ich gern, weil es für diesen Roman tatsächlich eine ganz konkrete Inspiration gab. Vor einigen Jahren las ich Bill Brysons wunderbares Sachbuch »Eine kurze Geschichte von fast allem«. Sein Kapitel über die »Steineklopfer«, die Pioniere der Geologie vor allem in Großbritannien, hat mich sehr begeistert, und als ich über einen neuen Roman nachdachte, fielen mir diese frühen Geologen sofort wieder ein. Spannend finde ich dabei vor allem, dass hier Jahrzehnte vor Darwin ein Spannungsfeld zwischen Naturwissenschaft und christlichem Glauben entstand.
Sie schreiben historische Romane – was fasziniert Sie ausgerechnet an diesem Genre?
Mir gefällt es, von Menschen zu erzählen, die unter anderen Bedingungen und in anderen kulturellen Zusammenhängen leben. Dazu begebe ich mich nicht ins Mittelalter oder die Antike, sondern finde gerade jene Epochen spannend, die auf den ersten Blick gar nicht fremd erscheinen und letztlich doch weit weg sind, wenn man sich näher mit ihnen beschäftigt. »Das Leonardo-Papier« spielt vor nicht einmal zweihundert Jahren, und doch ist die kulturelle und technische Kluft zur heutigen Zeit ungeheuer groß. Natürlich setze ich mich dabei auch mit der Rolle der Frauen in der jeweiligen Zeit oder Gesellschaftsschicht auseinander, so auch bei Georgina, die ein selbstbestimmtes Leben führen möchte, obwohl dies für Frauen in jener Zeit nur sehr schwer möglich war.
Wenn Sie sich eine Zeit aussuchen dürften, in der Sie leben könnten, welche wäre es?
Ich möchte in keiner anderen Zeit als der heutigen leben. Ganz spannend fände ich aber die Idee eines Zeit-Urlaubs. Zwei Wochen Renaissance oder ein Wochenendtrip ins Berlin der 1920er Jahre wären schon toll.
Über die Autorin
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Originalausgabe 11 /2009 Copyright © 2009 by Diana Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen Redaktion | Sabine Thiele Umschlaggestaltung | Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, München – Zürich, Teresa Mutzenbach Umschlagmotiv | © The Bridgeman Art Library und Philadelphia Museum of Art/CORBIS Herstellung | Helga Schörnig Satz | Leingärtner, Nabburg E-Book-Umsetzung | GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-03958-5V002
www.diana-verlag.de
Bill Bryson gewidmet, der mich zu den Steineklopfern führte
PROLOG
Daher kommen wir bei unserer gegenwärtigen Untersuchung zu dem Schluss, dass wir keine Spuren eines Anfangs finden, und keine Aussicht auf ein Ende.
James Hutton
London 1805
Der Regen peitschte durch die Straßen, trieb Unrat und alte Zeitungen vor sich her, schoss in Bächen durch die Rinnsteine und scheuchte Mensch und Tier ins Haus. Nicht ins Warme, Geborgene, das war hier kaum zu fin-den, nur in irgendeinen Raum, in dem man sich halbwegs trocken zusammendrängte und versuchte, beim Branntwein die klamme Kälte zu vergessen. Aber es gab auch jene, die gar kein Obdach fanden und sich trotz des unbarmherzigen Wetters auf den Straßen herumtrieben.
Die Gegend um St. Giles und Seven Dials war nicht nur eine der ärmsten der Stadt, sondern auch düster und verrufen, und wer konnte, machte einen großen Bogen um die engen, überfüllten Gassen, die in ein dicht gewebtes Leichentuch aus Gestank und Qualm gehüllt waren. Dirnen standen unter zerfransten Markisen, um vor dem Regen Schutz zu suchen, und riefen dem Vorbeieilenden obszöne Ermunterungen zu, doch der Mann mit dem Handkarren hastete weiter die Straße entlang, den Kragen des schäbigen Mantels hochgeschlagen, den Zylinder tief in die Stirn gezogen.
Die Verkommenheit schien aus dem Pflaster aufzusteigen, die Mauern atmeten Verlorenheit, die Menschen erschienen ihm wie Geister, die jeden Augenblick mit grauen Fingern nach ihm greifen konnten. Die Rookeries, die Elendsgassen jenseits der St. Giles High Street, waren ein verschachteltes Labyrinth aus schäbigen Gebäuden und Kellern, feuchter als jeder andere Ort der Stadt, ein morbider Palast aus bröckelndem Mauerwerk, schimmelndem Putz und morschem Holz.
Niemand, der hier wohnte, hätte sich auch nur entfernt vorstellen können, dass nicht weit von diesem Viertel Menschen lebten, die keinen Gedanken an ihr tägliches Brot verschwenden mussten, die sich jeden Tag in saubere Kleider hüllen, ihre Wäsche in lavendelduftenden Kommoden aufbewahren und in mit kupfernen Pfannen vorgewärmten Betten schlafen konnten. Menschen, denen Dienstboten alle Verrichtungen abnahmen, vom Öffnen der Tür bis zum Frisieren oder Leeren des Nachttopfes. Diese Londoner Viertel hätten von den Rookeries ebenso weit entfernt sein können wie der Mond.
Joshua Hart bewegte sich zielstrebig, schaute nicht in die narbigen, ausgemergelten Gesichter, die ihm aus den Hauseingängen entgegenstarrten, sondern versuchte, sich zu orientieren. Die Verzweiflung war ein echter Ansporn. Er war nur einmal hier gewesen und das in einer Gegend, deren Straßennetz ein Betrunkener ersonnen haben musste oder der Teufel selbst. Hier gab es nichts, an das er sich halten konnte, da jede Gasse, jede Durchfahrt, jeder Torbogen gleich schäbig und verkommen wirkte. Fensterscheiben gab es nirgendwo, die Bewohner hatten Papier oder Lumpen in die klaffenden Öffnungen gestopft, um sich halbwegs gegen die Witterung zu schützen, was jedoch sinnlos war, denn die Kälte kam von innen, schien den Häusern angeboren zu sein wie ein Buckel oder Klumpfuß.
Es war wohl seine Selbstversunkenheit, die ihm half, das Viertel ungeschoren zu durchqueren. Dies war der kürzeste Weg ans Ziel, und ihm blieb nicht viel Zeit. Er musste sich zwingen, nicht nach hinten zu blicken, ob sie ihm schon auf den Fersen waren. Nein, das war nicht möglich, niemand würde einen angesehenen Bürger hier vermuten, selbst wenn dieser seinen guten Ruf verloren hatte, seine Familie, seinen ehrenwerten Beruf, dem nichts geblieben war außer dem, was er am Leib trug.
Dann endlich bog er mit seinem holpernden Karren um die letzte Ecke und erblickte erleichtert die drei goldenen Kugeln, die über dem Eingang des Pfandhauses hingen und höhnisch auf die ärmliche Straße hinabschauten. Er sah sich um, doch die Straße lag verlassen da. Er stieß die Tür auf, wobei eine heisere Klingel ertönte, und zerrte den Karren hinein. Hinter der Theke war niemand zu sehen. Joshua Hart nahm den Zylinder ab und schüttelte ihn aus, bevor er sich im Laden umsah. Im Dämmerlicht konnte man die Waren kaum erkennen. Er nahm Umrisse von Schränken und überquellenden Regalen wahr, alle Ecken waren angefüllt mit Dingen, für die kein vernünftiger Mensch auch nur einen Penny ausgegeben hätte. Doch in St. Giles hatten die Leute für alles Verwendung, und so kreisten die ärmlichen Güter in einem ewigen Zyklus von Hand zu Hand und landeten immer wieder hier bei William Jessop.
Dieser war aus seinem Hinterzimmer getreten, aus dem eine Öllampe warm herüberleuchtete. Das Licht zeugte davon, wie gut Jessop von seinem Pfandhaus leben konnte, auch wenn er sich alle Mühe gab, das hinter seiner schäbigen Kleidung zu verbergen, um in dieser ärmlichen Gegend nicht aufzufallen.
Als er Joshua entdeckte, fragte er mit knarrender Stimme: »So spät noch Kundschaft?« Dann entfernte er sich mit schlurfenden Schritten, holte die Lampe von nebenan und leuchtete dem Besucher ins Gesicht. Sein flaumiges weißes Haar stand ihm wie der Strahlenkranz auf einem mittelalterlichen Heiligenbild vom Kopf ab. Erkennen huschte über seine Züge. »Ach, Sie sind das. Ich dachte schon, Sie kommen nie mehr.«
»Ich habe etwas bei Ihnen hinterlegt.«
»Gewiss doch, Sir. Ist aber schon länger her.«
»Vier Jahre, um genau zu sein, Mr. Jessop.«
»Und jetzt möchten Sie Ihre Besitztümer zurück.« Er strich zufrieden über seinen watteweichen Backenbart, der für einen Bewohner dieser Gegend ungewöhnlich gepflegt wirkte. »Das ist gut, die Truhen nehmen viel Platz weg.«
»Ja, Mr. Jessop. Wenn Sie nun bitte meine Sachen holen würden.«
Der Pfandleiher hob gemächlich die Hand und bedachte Joshua Hart mit einem durchtriebenen Blick. »Nicht so schnell, Sir. Sie haben Ihren Besitz vier Jahre lang bei mir untergestellt, das kostet. Und nun soll ich die Truhen, die übrigens bleischwer sind und sich kaum ohne fremde Hilfe verrücken lassen, auch noch für Sie holen? Bei meiner Gicht?«
»Na gut, wo stehen sie? Dann hole ich sie selbst.«
Dem Pfandleiher fiel angesichts dieser Begriffsstutzigkeit beinahe die Lampe aus der Hand, doch er fing sich wieder. »Haben Sie mich nicht verstanden? Sie schulden mir noch Geld, Sir.«
Joshua Hart öffnete seinen nassen Mantel und wühlte in der Westentasche. Dann zog er eine Uhr hervor und ließ sie an der Kette vor der Nase des Pfandleihers baumeln. »Das sollte wohl reichen für zwei Truhen, die nur herumgestanden haben. Außerdem haben Sie damals eine Anzahlung erhalten.«
Jessop wiegte bedächtig den Kopf. »Aber die reicht nicht aus, Sir. Ich hätte dort, wo die Truhen stehen, andere Dinge anbieten können, die mir einen netten Gewinn eingebracht hätten.« Er schnalzte mit der Zunge. »Andererseits, ein schönes Stück. Ich frage auch nicht, woher Sie die haben.«
Dann wühlte er in einer Schublade und förderte einen zerknitterten Zettel zutage, auf dem sein Name und seine Adresse geschrieben waren, sowie Zwei Truhen, zur Aufbewahrung. Er griff zur Feder und kritzelte darunter: Abgeholt und bezahlt am 4. Oktober 1805.
Joshua Hart biss sich auf die Zunge und schluckte seine Empörung hinunter. Dann griff er nach dem Zettel und steckte ihn achtlos ein. Nur weg von hier, weg von diesem abscheulichen Alten und seinem elenden Pfandhaus, weg aus dieser ganzen Kloake. Er folgte Jessops gekrümmtem Zeigefinger in einen Raum, der noch muffiger und düsterer war als der, den er soeben verlassen hatte. Mithilfe der Öllampe, die Jessop vor sich her trug, fanden sie seine Besitztümer in der äußersten Ecke. Nach der Staubschicht zu urteilen, hätten die Truhen ebenso gut seit dem Mittelalter in diesem Loch stehen können.
Zum Glück waren sie mit Metallgriffen versehen, so dass Joshua Hart sie mit einiger Mühe in den Ladenraum zerren konnte, wobei er seine nassen Kleider über und über mit Staub und Schimmel verschmierte. Er hatte sich wohlweislich eine einfache Karre ohne Rand besorgt, damit er die Truhen auf die Ladefläche schieben konnte, statt sie mühsam über den Rand heben zu müssen. Von Jessop, der seine Anstrengungen seelenruhig aus blutunterlaufenen Augen betrachtete, war keine Hilfe zu erwarten.
Als die Truhen verstaut waren, klopfte Joshua Hart seinen Mantel ab, wodurch er den Schmutz nur verteilte, nickte dem Pfandleiher zu und verließ schleunigst den Laden.
Der Regen war noch stärker geworden und verwandelte die Straße in Morast. Ihm graute vor dem Weg nach Bethnal Green.
Der Vikar Ethan Hart hatte sich gerade ins Schlafzimmer begeben, den Morgenrock ausgezogen, die Brille abgesetzt, sein Nachtgebet gesprochen und wollte sich zu seiner Frau ins vorgewärmte Bett legen, als er innehielt.
»Was ist, Ethan?«, fragte Mary Hart schläfrig. »Hast du etwas gehört?« Sie setzte sich auf. »Einen Einbrecher?«
Ethan Hart hob die Hand und schüttelte den Kopf. »Nein, da klopft jemand an die Haustür.«
Seine Frau setzte sich so abrupt auf, dass ihr die Nachthaube vom Kopf rutschte. »Du kannst um diese Zeit nicht mehr an die Tür gehen. Die Leute müssen einsehen, dass auch ein Pfarrer Schlaf braucht. Hoffentlich wachen die Kinder nicht auf.« Manchmal verlangte der Beruf ihres Mannes Opfer, mit denen sie sich nicht abfinden mochte.
Dann sah sie, wie Ethan einen Augenblick zögerte, den Morgenrock wieder überwarf und nach der Kerze auf dem Nachttisch griff. »Vielleicht ein Notfall, ein Sterbender, da kann ich mich nicht guten Gewissens zu Bett legen. Ich bin gleich zurück.«
Mit diesen Worten verließ er das Zimmer. Das Pfarrhaus, ein schmalbrüstiger dunkler Ziegelbau aus dem vergangenen Jahrhundert, knarrte und ächzte bei jedem Schritt, als wäre es ein lebendiges Wesen, das auf jeden seiner Schritte reagierte. Mary hatte es innen liebevoll ausgestattet, da sie sich auf jede Art von Handarbeit verstand. Im Dunkeln wirkte das Haus jedoch ein wenig unheimlich, zumal bei diesem Wetter. Am Fuß der Treppe horchte er. Da war es wieder – das Klopfen! Es kam eindeutig von der Haustür.
Ethan bewegte sich leise durch den Flur. In dieser Gegend musste man nachts eine gewisse Vorsicht walten lassen. Vielleicht war es auch ein Nachbar, beruhigte er sich, dessen Frau im Sterben lag, oder ein Kind, das schnell getauft werden musste, damit es nicht im Stand der Sünde starb. Dicht vor der Tür fragte Ethan Hart: »Wer ist da?«
»Ich bin's, Joshua. Mach auf.«
Entsetzt taumelte der Vikar einen Schritt nach hinten und stützte sich am Garderobenständer ab. Das konnte nicht sein, das war unmöglich. Die Worte musste er sich eingebildet haben. Als er sich gefasst hatte, trat er wieder an die Tür. »Sagen Sie mir, wer Sie wirklich sind und was Sie von mir wollen.«
»Herrgott noch mal, Ethan, mach auf. Ich bin es, dein Bruder.« Wütend hämmerte der Türklopfer gegen das Holz.
Du sollst den Namen des Herrn nicht unnütz im Munde führen, schoss es ihm durch den Kopf, doch für solche Ermahnungen war jetzt keine Zeit. Er öffnete die Tür einen Spaltbreit und spähte hindurch.
Der Mann war völlig durchnässt, seine Kleider glänzten im flackernden Kerzenschein, als wären sie aus Glas. Neben sich hatte er einen Karren stehen, der mit zwei großen Truhen beladen war. Seine Augen, die tief in den Höhlen lagen – vermutlich war er am ganzen Körper abgemagert, doch der weite Mantel verbarg seine Gestalt – , blickten flehend und zornig zugleich. »Lass mich nicht so vor deiner Tür stehen, Ethan. Du bist ein Christenmensch, also mach auf. Ich friere mich zu Tode.«
Der Vikar trat zurück und ließ den durchnässten Mann mit seinem Karren in die Diele, wobei er versuchte, die Lache zu übersehen, die sich auf dem verschossenen, aber peinlich sauberen Teppich um den Besucher und sein Hab und Gut bildete. »Was hast du hier zu suchen? Sieben Jahre Australien, so hat es doch geheißen.«
Joshua Hart trat spontan vor, als wollte er seinen Bruder am Kragen packen. »Ja, und vier Jahre habe ich es ausgehalten. Dreieinhalb, um genau zu sein, die übrige Zeit war ich auf stinkenden Frachtschiffen hierher unterwegs.«
Sein Bruder zog ihn am Arm in den Salon und schloss die Tür. Im Raum hing noch ein bisschen Wärme, eine schwache Erinnerung an das erloschene Kaminfeuer. »Was hast du dir nur dabei gedacht? Sie werden dich wieder einfangen, und diesmal kommst du nicht so leicht davon. Und wie kannst du es wagen, hierherzukommen? Mary liegt oben im Bett. Ich habe nie etwas von deiner Schande verraten. Du seiest nach Amerika ausgewandert, um dein Glück zu machen, habe ich erzählt …«
Joshua riss sich zusammen und schaute Ethan mit brennenden Augen an. »Wie willst du ermessen, was ich durchgemacht habe? Du sitzt hier in deinem behaglichen Pfarrhaus, schreibst beim Kaminfeuer deine Sonntagspredigten und machst ein frommes Gesicht.«
»Genauso hättest du auch leben können, Joshua«, meinte sein Bruder. »Liebe, Glück, Ruhm, du wolltest alles. Und dann hast du es leichtfertig verspielt.«
»Ein kleiner Fehltritt, der mit unbarmherziger Härte geahndet wurde, das weißt du sehr gut!«, rief Joshua, als die alte Empörung wieder in ihm aufloderte.
Ethan Hart legte mit einer müden Handbewegung den Finger an die Lippen. »Sei leise. Die Kinder schlafen. Und lass die alten Geschichten ruhen. Du hast nicht nur gegen das Gesetz, sondern auch gegen die guten Sitten verstoßen. Das wiegt moralisch noch schwerer.«
»Moral, Moral, du und deine Moral.« Ethan hatte die Stimme gesenkt, sprach aber immer noch im Zorn. »Du bist ungerecht, Bruder. Ich habe immer meine Pflicht getan, keinen Kranken von meiner Tür gewiesen, solange ich meine Praxis hatte. Was ich in der übrigen Zeit gemacht habe, geht nur mich etwas an.«
»Nicht ganz. Du hast nach eitlem Ruhm gestrebt, nach öffentlicher Anerkennung, statt bescheiden das zu tun, was dir im Leben bestimmt war. Nun hast du alles verloren. Darum besinne dich, und stelle dich deiner Strafe.«
Für solche gut gemeinten, aber wenig hilfreichen Ratschläge hatte Joshua keine Geduld und stieß seinen Bruder mit einer heftigen Bewegung in den nächsten Sessel. »Hör mir wenigstens dieses eine Mal zu, ohne fromme Reden zu schwingen. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten, deshalb bin ich hier.« Er deutete auf den Hausflur, in dem er seinen Karren abgestellt hatte. »Darin sind wichtige Dinge, die meine Frau bekommen soll.«
Er wollte weitersprechen, doch als er den Ausdruck auf dem Gesicht seines Bruders sah, verstummte er und tastete unwillkürlich nach dem geschnitzten Schrank, um sich abzustützen. Er ahnte, was Ethans Miene bedeutete, wollte es nur nicht wahrhaben. Einen Augenblick lang rang er mit dem Wunsch, aus dem Haus zu stürmen, vor dem zu fliehen, was er sogleich erfahren würde, doch feige war er nie gewesen. Man konnte ihm Ungestüm und mangelndes Urteilsvermögen vorwerfen, auch unmoralisches Verhalten, aber er wich der Wahrheit nicht aus.
»Was ist los, Ethan? Warum schaust du mich so an?«
Sein Bruder senkte den Kopf und heftete die Augen auf den Dielenboden zwischen seinen Pantoffeln. »Natürlich, woher solltest du es auch wissen?«
»Sag es mir.«
»Die Frau starb bei der Geburt des Kindes.«
Joshuas blasses, von vorzeitigen, tiefen Falten gezeichnetes Gesicht erstarrte zu einer Maske. »Woher weißt du das?« Er trat vor, als wollte er Ethan am Morgenrock packen.
»Da mir dein Schicksal nicht gleichgültig war, auch wenn du das mitunter zu glauben scheinst, habe ich jemanden beauftragt, Erkundigungen einzuziehen. Es finden sich immer gesprächige Küchenmädchen oder Stallburschen, die für ein paar Münzen redselig werden.« Er räusperte sich, als wäre es ihm als Mann der Kirche peinlich, zu solchen Mitteln gegriffen zu haben. »Als ihre Zeit gekommen war, gebar sie ein Mädchen. Sie erholte sich jedoch nicht von der Niederkunft und verstarb wenige Tage später im Kindbett.« Als er sah, wie sein Bruder in die Knie sank und das Gesicht in den Händen vergrub, wurde ihm bewusst, wie grausam seine nüchternen Worte geklungen haben mussten, und er fuhr in etwas sanfterem Ton fort: »Die Kleine wächst bei ihrem Großvater auf und trägt auch seinen Namen. Sie ist dort in guten Händen, Joshua. Belass es dabei.«
»Wie … wie heißt sie?«
»Georgina.«
»Ein guter Name.« Mit Bewegungen, die an einen uralten Mann erinnerten, erhob sich Joshua Hart vom Boden und trat ans Fenster, obwohl die Läden geschlossen waren. Er lehnte den Kopf gegen die Scheibe, wie um sich abzukühlen, und drehte sich langsam herum. »Dann ist mein Leben ohnehin verwirkt.«
»Versündige dich nicht, Bruder. Gott freut sich über jeden verlorenen Sohn, der den Weg zu ihm findet«, warnte ihn Ethan, doch seine Worte klangen seltsam kraftlos, als wäre er selbst nicht davon überzeugt.
Joshua trat wieder vor ihn hin und sah ihn eindringlich an. »Dann musst du mir erst recht den Gefallen tun, um den ich dich gebeten habe. Bewahre die Truhen auf, bis meine Tochter einundzwanzig Jahre und erwachsen genug ist, um zu erfahren, wer ihr Vater war. Vorher wird es ihr ohnehin niemand verraten. Ich möchte, dass sie den Inhalt, der mir viel bedeutet hat, als Erinnerung erhält.«
Ethan wiegte zweifelnd den Kopf. Vermutlich würde die Familie alles tun, um zu verhindern, dass das Mädchen überhaupt je von seinem Vater erfuhr. Andererseits würden viele Jahre vergehen, in denen Unerwartetes geschehen konnte. Um seinen Bruder zu beschwichtigen, nickte er und erhob sich aus dem Sessel. »Gut, du kannst den Karren ums Haus fahren und die Truhen in den Schuppen stellen. Ich sorge dafür, dass sie sicher verstaut werden. Ansonsten …« Er sah betont an Joshua vorbei.
»… kannst du nichts mehr für mich tun.« Joshua schaute sich in dem düsteren Salon um, als wollte er sich noch einmal vor Augen führen, auf welches Leben er verzichtet hatte, drehte sich abrupt zur Tür und trat in den Flur. Er hob die Hand, um Ethan zurückzuhalten, der gerade einen Mantel überziehen wollte. »Ich kenne den Schuppen. Geh zu Bett, deine Frau macht sich gewiss schon Sorgen.«
Die Haustür fiel vernehmlich hinter ihm ins Schloss. Ethan ging durch den dunklen Flur zur Hintertür und horchte, hörte gedämpftes Fluchen und Poltern, als sein Bruder die Kisten in den Schuppen zerrte. Obwohl seine Füße mittlerweile eisig kalt waren, brachte er es nicht über sich, wieder nach oben ins Schlafzimmer zu gehen, bevor die Geräusche nicht verklungen waren. Als nichts mehr zu hören war, wandte er sich zur Treppe. Bevor sein Fuß die erste Stufe berührt hatte, fuhr er zusammen.
Auf der stillen Straße ertönten Fußgetrappel und Rufe. Er lief durch den Flur, riss die Haustür auf und trat, ohne auf den Regen zu achten, auf die Schwelle.
Laternen tanzten auf und ab wie bei einem Umzug, doch die Männer, die sie trugen, hatten kein Vergnügen im Sinn. Man hörte Keuchen, dann einen Schmerzensschrei, bevor jemand rief: »Schnell, verflucht noch mal! Die Fesseln, bevor er mir entwischt! Der Kerl tritt wie ein Pferd!«
Vermutlich keine Polizisten, dachte Ethan Hart, eher bezahlte Diebesfänger, die für jede gelungene Verhaftung Geld erhielten. Er wusste nicht, wie sie seinem Bruder auf die Schliche gekommen waren, aber sie würden eine saftige Belohnung einstreichen. Unerlaubte Rückkehr aus der Deportation war ein schweres Vergehen; an die Strafe, die Joshua erwartete, mochte er gar nicht denken. Seiner Frau würde er nichts davon erzählen. Damals war es ihm gelungen, die Schande, die sein Bruder über die Familie gebracht hatte, vor ihr zu verbergen, und so sollte es auch bleiben. Sie würde sich nur Sorgen machen. Eine Notlüge schien erlaubt.
Ethan Hart stand in der Tür des Pfarrhauses und sah im unstet flackernden Licht der Laternen, wie drei wenig vertrauenerweckende Gestalten den Gefesselten abführten, während der Himmel noch immer seine Fluten herabsandte, um die Stadt von ihren Sünden reinzuwaschen.
Unruhig wie ein Tiger in der Menagerie schritt Joshua in der Zelle auf und ab. Waren da Stimmen im Flur? Kamen sie ihn holen? Aber es war eine andere Tür, die sich knarrend öffnete, ein anderer widerstrebender Körper, den man gewaltsam hinauszerrte, eine andere arme Seele, die ihren letzten Gang antrat.
Er erinnerte sich an den Augenblick der Urteilsverkündung. Wie ihm die Röte heiß ins Gesicht gestiegen war. Ihm wurde nicht eisig kalt, wie es in den Romanen gerne hieß, wenn der Held eine furchtbare Nachricht erhielt, ihm wollte schier der Kopf platzen, als das Blut hineinschoss.
Vier Jahre lang hatte er nur ein Ziel vor Augen gehabt, das ihn während der grauenhaften Überfahrt, während der Zeit im Steinbruch – welch eine Ironie, ausgerechnet ihn mit der Zwangsarbeit im Steinbruch zu quälen! – und auf der Flucht am Leben erhalten hatte: sich um jeden Preis zu retten, um nach England zurückzukehren, zu seiner Frau und seinem Kind.
Doch als er seinem Bruder ins Gesicht geblickt hatte, war ihm, als hätte er in einen Abgrund geschaut. Erst da hatte er begriffen, dass sein Leben verwirkt, die Leiden und Gefahren, die er auf sich genommen und durchgestanden hatte, umsonst gewesen waren. Es gab nur einen Trost: dass er die Truhen, die über den Tod hinaus eine Brücke zu seiner Tochter schlagen würden, bei Ethan hatte unterbringen können.
Joshua Hart konnte von seiner Zelle aus das Johlen der Menge hören. An diesem Tag standen sechs Hinrichtungen an, seine war die letzte. Wollte man ihn damit quälen oder ihm noch ein bisschen Zeit gewähren, um sich vom Leben zu verabschieden? In Wahrheit war es wohl viel einfacher. Vielleicht würfelte der Henker. Oder er schaute nach, wessen Urteil zuerst ergangen war. Hier gab es keine höhere Ordnung, vor dem Newgate-Gefängnis scheute selbst Gott zurück.
Er blieb stehen und legte sein Gesicht an die Mauer. Sie war nicht sauber, aber wohltuend kühl und linderte das Brennen seiner Haut. Dann spreizte er die Finger, drückte die Handflächen gegen die Steine und schloss die Augen. Er fühlte sich, als wäre er heimgekehrt.
Er sah sich, angetan mit einer alten Hose und einem verschlissenen Hemd, unter der heißen Sonne in einem Steinbruch arbeiten. Neben sich eine lederne Tasche, wie er sie auch für seine Instrumente benutzte, aber angefüllt mit Hämmern, Meißeln und Tüchern, in die er seine Funde wickelte. Sein Nacken brannte, die Haut war schon rot und würde abends schmerzen, aber er konnte einfach nicht aufhören, wo er gerade eine Ecke freigelegt hatte, ein Stück nur, das aber Großes verhieß. Vorsichtig klopfte er mit dem Hammer Gesteinsbröckchen ab, setzte den Meißel wie einen Hebel an und bewegte ihn vorsichtig auf und ab, um den Fund aus dem umgebenden Kalkstein zu lösen. Mit einem Pinsel entfernte er den losen Bruch oder pustete ihn weg. Seine Arme waren wie von Mehl bestäubt, der pulverfeine Kalk vermischte sich mit dem Schweiß zu einem weißen Belag, als hätte ein Maler seine Arme angestrichen. Er spürte die Erregung, als er den Fund endlich aus dem Stein lösen konnte und den wunderbar geformten Ammoniten in der Hand hielt.
Joshua war so versunken in seine Erinnerungen, dass er die Geräuschkulisse des Gefängnisses, das Rasseln der Schlüssel, die johlende Menge in der Newgate Street, das Raunen, als die Klappe fiel und der Strick sich straffte, nicht mehr wahrnahm. Er war an einen Ort gegangen, an den ihm niemand folgen konnte.
Er sah wieder das leicht gebräunte Pergament, mit filigranen Zeichnungen bedeckt, zart und doch mit entschlossenem Strich gefertigt, und dazwischen die Schrift, die aus einem fernen Land zu stammen schien, so sonderbar waren ihre Buchstaben geformt. Wie er gegrübelt hatte, bis ihm eine Idee kam, verrückt, aber so logisch, dass sie nur wahr sein konnte. Er hatte das Rätsel gelöst. Doch das war erst der Anfang gewesen, denn wie ein Kind, das vor einem Frisierspiegel mit zwei aufgeklappten Seitenflügeln spielt, erblickte er immer neue Rätsel, die sich ins Unendliche zu erstrecken schienen.
Dann ging ihm etwas durch den Kopf, das der große James Hutton im vergangenen Jahrhundert geschrieben und was bei manchen Kollegen Empörung ausgelöst hatte, ihm in diesem Augenblick aber Trost spendete.
Daher kommen wir bei unserer gegenwärtigen Untersuchung zu dem Schluss, dass wir keine Spuren eines Anfangs fin-den, und keine Aussicht auf ein Ende. Vielleicht galt das, was Hutton über das Alter der Erde geschrieben hatte, nicht nur für die Steine, auf denen man stand, sondern auch für das, was die Menschen Seele nannten, das Unsterbliche in jedem Einzelnen? Womöglich schwamm dieses unzerstörbare Etwas im Ozean der Zeit, der keinen Anfang und kein Ende hatte. Kein christlicher Gedanke, aber einer, der ihn begleiten würde, wenn die Schritte des Wärters vor seiner Zelle innehielten.
Die Ruhe, die von den Mauersteinen in seinen ganzen Körper geströmt war, verließ ihn selbst dann nicht, als der Wärter den Schlüssel ins Schloss steckte, ihm die Hände auf den Rücken band und ihn durch die Korridore führte, hinunter in den Innenhof und auf die Straße, bis zum Galgen. Die Menge zerfaserte schon an den Rändern, fünf Hinrichtungen waren vielen genug, nur die besonders Unersättlichen standen noch im Halbkreis ums Gerüst.
Joshua Hart hatte die Augen geschlossen – nicht um den Blicken der Menge auszuweichen, sondern um die Gedanken, die ihm so tröstlich erschienen waren, in sich zu bewahren.
Ich treibe im Ozean der Zeit, sagte er sich immer wieder, mein Körper wird vergehen, doch etwas in mir wird mich überdauern. Und er dachte ganz fest an seine Tochter, als könnte er die Entfernung zwischen ihnen überwinden und ihr sachte über die Wange streichen.
Dann öffnete sich die Klappe unter seinen Füßen.
KAPITEL I
Sie genießt es, niemanden zu fürchten und stets zu sagen, was ihr gefällt.
Anna Maria Pinney Über Mary Anning
Lyme Regis, 1812
»Sieh mal, Tante Aga, das ist ein Schlangenstein.« Das Mädchen streckte die Hand aus. Darin lag ein spiralförmiger Stein, der in einem Schlangenkopf endete. Die ältere Dame trug ein streng geschnittenes dunkelgrünes Kleid und eine Haube mit passendem Band.
»Der Kopf ist aber nicht echt. Eigentlich sehen sie anders aus, wenn man sie findet. Schau, so.« Das Mädchen zog einen weiteren Stein aus der Tasche, noch größer und mit einem deutlichen Rippenmuster versehen, der keinen künstlich gemeißelten Schlangenkopf aufwies. »Den hier finde ich noch schöner, weil Mary ihn so in den Klippen gefunden hat.«
»Mary?«, fragte Lady Agatha Langthorne, die mitten auf der Wiese oberhalb der Klippen saß, eine Decke unter sich ausgebreitet, ein wenig abwesend, da sie ein aufgeschlagenes Buch in der Hand hielt. Das milde Wetter erlaubte es ihnen, hier oben auf dem Gipfel der Welt zu sitzen – so jedenfalls kam es ihr vor – , und sie genoss es, die überfüllten Straßen von Lyme hinter sich zu lassen und sich auf die grünen Wiesen mit den vielen Wildblumen zu flüchten, von denen sie einen wunderbaren Blick auf das blau glitzernde Diamantarmband des Kanals hatten.
»Ja, Mary«, wiederholte ihre Großnichte Georgina, »Mary Anning. Meine neue Freundin. Sie hat mir erzählt, dass man diese Steine eigentlich Ammoniten nennt, nach den Hörnern des Gottes Ammon.« Die Zehnjährige strich sich die rotbraunen Strähnen aus dem Gesicht, die aus ihren langen Zöpfen gerutscht waren. Ihr blaugrünes Kleid, unter dessen Saum eine spitzenbesetzte Hose hervorlugte, passte wunderbar zur Farbe ihrer Augen. Manchmal fand sie ihre Nase ein bisschen zu groß, doch sie war gerade und schön gewachsen.
»Meinst du die Kleine, die im Ort Steine verkauft?«, fragte Lady Agatha und schluckte die Sorge angesichts dieser wenig standesgemäßen Bekanntschaft hinunter. Sie waren dem Mädchen kürzlich auf der Straße begegnet, und es hieß, es verdiene mit dem Sammeln von Versteinerungen den Lebensunterhalt für den Bruder und die verwitwete Mutter. Dabei konnte die Kleine nicht älter als zwölf oder dreizehn Jahre alt sein. Zudem hatte Agatha erfahren, dass die Familie nicht der Kirche von England angehörte, sondern einer abtrünnigen Glaubensgemeinschaft, die es nicht einmal verdammte, wenn jemand am heiligen Karfreitag in den Klippen umherkletterte und Steine suchte. Doch Agatha Langthorne war eine lebenskluge Frau und hatte oft genug erfahren, dass die interessantesten Menschen nicht unbedingt jene sein mussten, die einem an Stand, Herkunft und Glauben ebenbürtig waren. Daher streckte sie nun die Hand aus. »Zeig sie mir bitte, Georgina.«
Stolz reichte ihr das Mädchen die beiden Ammoniten. »Und, welcher gefällt dir besser?«
Lady Agatha tat, als müsste sie eine Weile überlegen, und sagte dann mit Bedacht: »Du hast recht, das Natürliche ist schöner als das von Menschenhand Veränderte. Also nicht der mit dem Schlangenkopf. Hat Mary Anning sie dir geschenkt?«
Georgina wurde ein wenig rot und schaute zu Boden, wobei sich weitere Haare aus den Zöpfen lösten und im Wind flatterten.
Ihre Großtante legte einen Finger unter ihr Kinn, hob ihr Gesicht an und sah ihr in die Augen. »Nun?«
»Ich … ich habe sie mir ausgeliehen. Aber ich dachte, wir könnten sie … vielleicht kaufen. Jedenfalls den einen. Marys Familie lebt davon.«
»Wie viel verlangt sie denn dafür?«
»Das weiß ich nicht. Ich wollte dich erst um Erlaubnis bitten, bevor ich Ja sage.« Georgina hob den Kopf.
»Na schön, dann werden wir heute Abend bei den Annings vorbeischauen und uns nach dem Preis erkundigen.« Lady Agatha stand auf und strich ihr Kleid glatt. »So, jetzt könnte ich eine Tasse Tee vertragen. Sollen wir in den Ort hinuntergehen und uns etwas Gutes gönnen?«
Georgina klatschte in die Hände. »Ja, das machen wir. Ich bin so froh, dass wir hergekommen sind. Es ist so schön hier.« Ihr Herz wollte schier überquellen. Sie machte einen zaghaften Schritt auf ihre Großtante zu und legte den Kopf an deren Brust. Agatha Langthorne war eigentlich kein Mensch, der zu körperlichen Zärtlichkeiten neigte, strich ihr aber kurz übers Haar und schaute dabei nachdenklich aufs Meer hinaus.
Während die meisten Damen ihrer Bekanntschaft ins vornehme Gewühl von Bath reisten, hatte Lady Agatha Langthorne es vorgezogen, in diesem Jahr den südlicher gelegenen Kurort Lyme Regis mit seiner reizvollen Küstenlandschaft aufzusuchen. Zwar kamen viele Tagesausflügler von Bath herunter und verstopften mit ihren eleganten Kutschen die engen Straßen, doch wenn man ihnen nicht begegnen wollte, unternahm man einfach einen Spaziergang über die Klippen, bis sie wieder abgefahren waren.
Mit ihrer Großnichte hatte sie schon einige herrliche Wanderungen unternommen, wenn es ihr im Ort zu geschäftig wurde. Außerdem bot Lyme noch ein besonderes Vergnügen, das ganz nach Agatha Langthornes Geschmack war.
Am Strand gab es nämlich fünf hölzerne Badekarren, die von Pferden ins Meer hinausgezogen wurden. Um den Anstand zu wahren, wurden sie von Frauen aus dem Ort begleitet, die die wagemutigen Damen vor neugierigen Blicken schützten. Agatha Langthorne hatte sich schon zweimal im Inneren des Karrens umgezogen und war, nur mit einem einfachen Flanellkleid angetan, ins Meerwasser getaucht, was sie als ausgesprochen wohltuend empfunden hatte. Die Zeiten, in denen man die Berührung mit Wasser als ungesund betrachtete, schienen Gott sei Dank vorüber.
Georgina hatte sich bisher nicht getraut, es ihr gleichzutun, doch Lady Agatha hoffte, das Mädchen noch zu diesem Erlebnis überreden zu können. Nur gut, dass ihr Bruder nicht mitgereist war, denn er hätte gewiss alles darangesetzt, Schwester und Enkelin von diesen neumodischen Torheiten abzuhalten.
Manchmal fragte sich Lady Agatha, ob es ihrer Großnichte nicht schadete, zwischen dem strengen Regiment im Haus des Großvaters und den ungezwungenen Wochen, die sie bei ihr verbringen durfte, hin und her zu pendeln. Eigentlich war das düstere Londoner Stadthaus kein Ort für ein elternloses Kind. Das Mädchen erhielt dort wenig geistige Anregung und kaum Zuneigung vonseiten des Großvaters. Georgina sprach selten über ihre Gefühle, doch die grenzenlose Freude, die sie bei jedem Besuch an den Tag legte, verriet mehr über ihre Einsamkeit als alle Worte. Das und die Fragen, mit denen sie bisweilen herausrückte, wenn sie Lady Agatha in besonders guter Stimmung wähnte. »Wie hat meine Mama ausgesehen? War sie eine schöne Frau? Konnte Papa reiten? Ist er auf die Jagd gegangen, oder hat er lieber über seinen Büchern gesessen? Wie haben sich die beiden kennengelernt?«
In solchen Augenblicken war Lady Agatha froh, wenn sie das wissbegierige Kind rasch ablenken konnte. Sie beschäftigte sich seit Jahren mit Chemie, was schon ihren verstorbenen Mann befremdet hatte – die Ehe war von kurzer Dauer gewesen und kinderlos geblieben – und bei ihrem Bruder auf offene Missbilligung stieß. Doch das hatte sie nie daran gehindert, ihren Interessen nachzugehen, und sie besaß eine beachtliche Sammlung chemischer Lehrbücher. Die ungefährlicheren Experimente führte sie Georgina gern vor, die das Labor als Wunderzimmer bezeichnete, und das Mädchen schaute mit aufgerissenen Augen zu, wenn aus Kolben und Reagenzgläsern blubbernde Blasen aufstiegen oder farbige Dämpfe wallten. Darüber vergaß Georgina auch die drängendsten Fragen.
An der Wand des Salons hing ein kolorierter Stich, der einen Herrn mit weiß gepudertem Haar und Kniehose zeigte, mit einer Hand auf einen Tisch gestützt, auf dem Papier, Tintenglas und eine Flasche zu sehen waren. Um ihn herum auf dem Boden lagen Bücher und seltsam geformte Glaskolben.
»Das ist Lavoisier, der große Chemiker«, hatte Tante Agatha gesagt, als Georgina sie zum ersten Mal nach dem Herrn gefragt hatte. »Zugegeben, ein Genie, selbst wenn er Franzose war.« Dann fügte sie nachdenklich hinzu: »Er hat mit seiner Frau zusammengearbeitet. So stelle ich mir eine ideale Ehe vor. Gemeinsam an wissenschaftlichen Experimenten arbeiten, statt über sparsame Haushaltsführung und Kindererziehung zu streiten. Sie hat auch viele seiner Bücher illustriert.«
»Das würde ich auch gern machen. Ich könnte Schneckenhäuser malen und hübsche Steine«, sagte Georgina spontan. »Musste die Frau nie putzen und kochen?«
»Dafür hatten sie wohl Dienstboten«, meinte Lady Agatha.
Nach und nach hatte Tante Aga mehr über den Herrn in der Kniehose und seine kluge Frau erzählt, doch so gern Georgina ihr zuhörte und die geheimnisvollen Laborutensilien betrachtete, hatte sie sich nie wirklich mit der Chemie anfreunden können. Die Vorstellung, irgendwann einmal mit einem Mann zusammen bedeutende Forschungen anzustellen, ging ihr jedoch noch lange im Kopf herum.
Sie hatten in der Teestube Platz genommen und warteten mit knurrendem Magen auf ihre Scones mit Rahm und Erdbeermarmelade. Einige Gäste, die ebenfalls im Ort residierten, nickten ihnen grüßend zu. Lady Agatha hielt sich zurück, weil sie all jene Menschen als langweilig erachtete, die sich selbst als interessanten Gesprächsgegenstand betrachteten, eine Gruppe, die ihrer Ansicht nach fast die gesamte britische Bevölkerung umfasste. Sie unterhielt sich lieber mit einem verständigen Kind als mit einem albernen Gentleman, der sie mit Berichten von der letzten Fuchsjagd anödete, oder einer Dame, die nur die neueste Hutmode im und auf dem Kopf hatte.
Georgina schaute sie abwartend an, als die Bedienung, eine rundliche ältere Frau mit strahlend weißer Schürze, den Teller mit den Scones vor sie hinstellte.
»Nur zu, mein Kind, bediene dich.«
Georgina schnitt einen Scone durch, bestrich ihn dick mit Rahm und gab einen ordentlichen Löffel Erdbeermarmelade darauf. Dann versuchte sie, möglichst damenhaft hineinzubeißen, was ihr allerdings nicht ganz gelang.
»Es gibt Taschentücher, Georgina. Lieber mit Genuss essen, als sich dauernd beherrschen.«
Mit diesen Worten biss Agatha selbst in ihr Gebäck. Ein Tropfen Marmelade fiel auf das Tischtuch.
Schweigend genossen sie ihren Tee. Plötzlich entstand Unruhe draußen auf der Straße. Männerstimmen, Schritte, laute Rufe. Hoffentlich kein Schiffsunglück, dachte Lady Agatha spontan. Damit musste man am Meer immer rechnen. Die Bedienung war zum Fenster gegangen und hatte die Gardine beiseitegeschoben, trat dann durch die Tür und rief einem der Männer etwas zu. Als sie wieder hereinkam, blieb sie an Lady Agathas Tisch stehen.
»Die kleine Anning hat wieder etwas gefunden. Sie bringen es gerade vom Strand hoch. Es soll ein Ungeheuer sein.«
Großtante und Großnichte sahen einander an. Binnen einer Minute hatten sie bezahlt, ihre Mäntel angezogen und die Teestube verlassen. Auf der Straße hatte sich bereits eine Menschenmenge um einen Karren versammelt. Als sie näher traten, hörten sie das Getuschel der Umstehenden.
»… noch nie gesehen … erstaunlich … wie aus einer anderen Welt … sensationell …«
Auf einmal erklang eine helle Stimme.
»Miss Georgina, sehen Sie nur, was wir gefunden haben.« Ein etwa zwölfjähriges, einfach gekleidetes Mädchen mit dunklen Zöpfen hatte sich durch die Menge gedrängt und streckte Georgina die Hand entgegen. Als es Lady Agatha erblickte, machte es einen Knicks. »Madam, möchten Sie sich vielleicht auch anschauen, was wir am Strand gefunden haben? Es ist ganz außerordentlich.«
»Du musst Mary Anning sein.«
Das Mädchen nickte höflich, schien aber ungeduldig, den Fund zu zeigen. Die Menge bildete eine Gasse, damit die Herrschaften vor den Karren treten konnten. Beim Anblick des Fundstücks stieß Lady Agatha ein »Mein Gott!« hervor.
Auf dem Karren lag, auf Tücher gebettet, ein gewaltiges Skelett, das Lady Agatha spontan auf fünfzehn oder sechzehn Fuß Länge schätzte. Es hatte eine Vielzahl von Rippen, seltsam geformte Füße mit vielen kleinen Knöchelchen und einen langen Schwanz, dessen Ende nach unten abgeknickt war, als hätte man ihn gewaltsam durchgebrochen. Noch nie und in keinem ihrer gelehrten Bücher hatte sie ein solches Geschöpf gesehen.
»Es hat ja keinen Kopf«, ertönte Georginas Stimme etwas vorlaut, und ihre Tante wollte sie schon tadeln, weil Mary so stolz auf ihren unglaublichen Fund war, doch diese kam ihr zuvor.
»Und ob es einen hat«, verkündete sie triumphierend und winkte einen Jungen herbei, der sich bislang im Hintergrund gehalten hatte. »Das ist mein großer Bruder Joseph. Er hat den Kopf schon letztes Jahr gefunden.« Sie deutete auf die Klippen. »Bevor sie den ganzen Körper ausgraben konnten, hat es eine Schlammlawine gegeben, und wir konnten lange nicht mehr an der Stelle suchen. Kürzlich bin ich wieder hingegangen und habe den Rest entdeckt.« Sie sagte es so selbstverständlich, als hätte sie ein Stück Treibholz oder eine hübsche Muschel gefunden und nicht die Überreste eines Tieres, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte.
»Wenn Sie mitkommen möchten, können wir Ihnen den Schädel zeigen.« Mary deutete die Straße entlang. »Er ist bei uns zu Hause.« Sie hielt einen Augenblick inne, als wäre es ihr plötzlich unangenehm, die vornehme Dame und ihre Nichte in ihr ärmliches Zuhause zu bitten, doch Georgina vertrieb die kurze Verlegenheit.
»Natürlich möchten wir ihn sehen. Das stimmt doch, Tante Aga, oder?«
Lady Agatha nickte. »Das sollten wir uns nicht entgehen lassen, mein Kind. Auf geht's!«
Auf Marys Zeichen hin rollte der Karren, der von mehreren Männern geschoben wurde, wieder an. Wie bei einer Prozession folgten ihm Mary, Joseph und ihre Gäste zu einem gepflegten, recht ansprechenden Häuschen. Leider genieße die Gegend keinen allzu guten Ruf, weil das Gefängnis in der Nähe stehe, vertraute Mary ihnen an. Sie erfuhren auch, dass der verstorbene Vater der Kinder Zimmermann gewesen war und früher selbst Fossilien am Strand gesammelt hatte.
»Ich weiß noch, wie Vater sie in der Werkstatt sauber gemacht hat«, sagte Joseph, der bislang sehr schweigsam gewesen war. »Manchmal hat er auch den runden Tisch vors Fenster gestellt und sie an Besucher verkauft.«
»Ja, so wie wir es heute tun«, erklärte seine Schwester stolz. »Wenn die Postkutsche ankommt, haben wir die meisten Kunden. Manche Leute kommen sogar mehrmals, um unsere Steine zu kaufen. Sie verschenken sie oder legen sie in eine Vitrine in ihren Salon.« Die Art, wie sie das letzte Wort aussprach, ließ darauf schließen, dass in ihrem Heim kein Salon zu finden war.
»Wann ist euer Vater gestorben?«, fragte Lady Agatha, die nichts von übertriebenem Taktgefühl hielt.
Mary blickte ernst. »Vor zwei Jahren. An der Schwindsucht. Er war vorher schon lange krank, weil er von einer Klippe gestürzt ist. Black Ven dort drüben, die ist besonders heimtückisch, da müssen wir beim Absteigen sehr aufpassen.« Wie zuvor schon sprach sie diese Dinge mit einer Gelassenheit und Würde aus, die zu einem viel älteren Menschen gepasst hätten. Bevor sie noch mehr erzählen konnte, trat eine Frau aus der Tür und wischte sich, als sie Lady Agatha erblickte, unwillkürlich die Hände an der Schürze ab. Mit einem angedeuteten Knicks sagte sie: »Mrs. Anning, Madam.«
»Guten Tag. Wir haben uns erlaubt, Ihre Tochter nach Hause zu begleiten. Sie hat einen ganz außergewöhnlichen Fund gemacht.«
Auf Marys Zeichen hin hoben mehrere Männer das teils noch in Stein gebettete Skelett geschickt vom Wagen und schleppten es ächzend in die Werkstatt. Drinnen legten sie es auf eine lange Werkbank und verabschiedeten sich, wobei Mrs. Anning ihnen einige Münzen zusteckte.
»Danke, Will, danke, George, und auch dir, Caleb, Gott segne euch.«
Die Männer tippten sich an die Mützen und verschwanden um die nächste Ecke.
Lady Agatha und Georgina schauten sich in der Werkstatt um, die sehr ordentlich wirkte. Auf einem Tisch lagen verschiedene kleine Fossilien, darunter auch Ammoniten, die Schlangensteine. Daneben waren Kalksteinplatten angeordnet, denen ganze Tiere eingeprägt waren, als hätte man sie mit Stempeln in feuchten Ton gedruckt.
»Madam, hier ist der Kopf.«
Sie drehten sich um und hielten den Atem an. Mary hatte einen weiteren Tisch herangeschoben, auf dem ein versteinerter Schädel lag, der keinem Tier ähnelte, das Lady Agatha je gesehen hatte. Gewiss, das lang gezogene Maul erinnerte entfernt an ein Krokodil, doch die riesigen knöchernen Höhlen, in denen sich einst die Augen befunden hatten, sahen völlig anders aus. Insgesamt mochte der Kopf etwa vier Fuß lang sein und schien tatsächlich zu dem enormen Körper zu gehören.
»Was kann das sein, Tante Aga? So ein Tier habe ich noch nie gesehen.« Georgina war näher getreten und berührte den Schädel vorsichtig mit einem Finger, als hätte sie Angst, das Maul könnte unvermittelt zuschnappen.
»Wir auch nicht. Aber es kommen sicher gelehrte Herren her, wenn sie davon erfahren«, sagte Mary zuversichtlich.
»Und wir hätten nichts dagegen, ihnen den Fund zu verkaufen«, beeilte sich ihre Mutter zu sagen. »Die Kinder verdienen unseren Unterhalt, seit mein Mann von uns gegangen ist«, fügte sie in entschuldigendem Ton hinzu, als schämte sie sich ihrer Geschäftstüchtigkeit.
Mary schien ein wenig verärgert, weil ihre Mutter sich ins Gespräch mischte, auch wenn sie es nicht offen zeigte. Man durfte seine Waren nicht zu eifrig feilbieten, sonst wurde man übervorteilt. Dieser Fund war etwas ganz Besonderes, das sie nicht einfach so hergeben würde. Wenn sie mit Bedacht handelte, würde der Erlös ihren Unterhalt für viele Monate sichern. Doch ging es ihr dabei um viel mehr als den Preis, den sie mit ihrer Riesenechse, oder was immer es auch sein mochte, erzielen konnte.
»Ich habe schon in all meinen Büchern nachgeschlagen, aber nirgends etwas über solche Tiere gefunden«, sagte sie.
Lady Agatha schaute Mary überrascht an, denn es kam selten vor, dass Kinder aus diesen Kreisen lesen konnten.
»Du scheinst mir ein ganz besonderes Mädchen zu sein«, sagte sie und holte ihre Geldbörse hervor, aus der sie zwei Shilling-Münzen nahm und den Kindern überreichte. »Für euren Fleiß und Mut. Ich habe die Klippen gesehen. Es ist gefährlich, in ihnen herumzuklettern.«
Die Kinder bedankten sich, blickten aber etwas niedergeschlagen, als hätten sie sich wieder an ihren Vater erinnert, der eben diesen gewinnbringenden Klippen zum Opfer gefallen war. Lady Agatha und Georgina versprachen, in den nächsten Tagen noch einmal vorbeizukommen, und wollten sich gerade verabschieden, als Lady Agatha sich noch einmal umdrehte.
»Georgina, was ist mit diesen Ammoniten, die du mir vorhin gezeigt hast?«
Ihre Nichte wühlte in der Tasche ihres Kleides und streckte sie ihr entgegen. Als die Tante ihren flehenden Blick sah, fragte sie Mary Anning: »Was kosten die beiden, mein Kind?«
»Den mit dem aufgemalten Kopf gebe ich Ihnen umsonst, weil er nicht mehr so ist, wie ich ihn gefunden habe. Der andere kostet zwei Shilling.«
»Das ist ein vernünftiger Preis.« Lady Agatha bezahlte die geforderte Summe und keinen Penny mehr, um das Mädchen, das so viel Würde ausstrahlte, nicht zu beschämen. »Ich wünsche euch weiterhin viel Glück bei eurer Suche. Und ich werde aufmerksam die Zeitungen lesen, ob ich darin etwas über euer sonderbares Tier entdecke.«
Als Lady Agatha an diesem Abend in Georginas Zimmer ging, um ihr gute Nacht zu sagen, fand sie sie nicht wie sonst mit einem Buch im Bett, sondern am Tisch sitzend, vor sich die beiden Ammoniten. In der Hand hielt sie eine Leselupe und betrachtete im Schein einer Öllampe den naturbelassenen Fund.
»Sieh mal hier durch, Tante Aga, so kannst du die Rillen besser erkennen. Sieht er nicht wunderschön aus? Und ich weiß auch, wie Mary ihn gereinigt hat. Vielleicht finde ich einen am Strand und kann es selbst einmal versuchen. Man muss aufpassen, dass der Kalkstein nicht zerbricht, wenn man mit Hammer und Meißel arbeitet.«
Lady Agatha setzte sich still in einen Sessel und betrachtete das Mädchen, das den Ammoniten noch immer aufmerksam mit der Lupe untersuchte. Sie spürte, dass Georgina eigentlich noch etwas sagen wollte, und ließ ihr Zeit, bis sie die richtigen Worte fand.
»Es ist schön, dass Mary so viel von ihrem Vater gelernt hat.« Sie blickte vorsichtig über die Schulter, um zu sehen, wie ihre Großtante reagierte. »Wenn sie in den Klippen klettert und etwas Interessantes findet, ist es sicher, als schaute er ihr über die Schulter.« In ihrer Stimme lag eine unverhohlene Sehnsucht.
Lady Agatha antwortete nicht, sondern hing ihren eigenen Gedanken nach. Sollte es wirklich Zufall sein, dass Georgina so viel Freude an Mary Annings Funden fand, oder lenkte das Schicksal, an das Lady Agatha eigentlich nicht glaubte, ihre Wege? Würde es sich als vorübergehende Laune erweisen – angeregt durch die Ferienreise nach Lyme – , die so schnell verflog wie die Freude an einem neuen Spielzeug? Wäre es gut für sie, wenn sie tatsächlich der Faszination der Steine verfiel?
KAPITEL II
Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war.
Genesis 1,10
London, Mai 1821
Wagen um Wagen bog zwischen den Säulen vom Strand in den Innenhof von Somerset House, vierrädrige Kaleschen, leichte Einspänner und sportliche Karriolen mit zwei Pferden, deren Lenker beträchtliches Geschick besitzen mussten. Die Menschen auf der Straße blieben stehen und blickten bewundernd auf den Zug. Es musste schon ein besonderes Ereignis sein, wenn es die ganze elegante Welt herbeilockte. Im Hof wurden Schläge von livrierten Dienern aufgerissen und Trittstufen ausgeklappt.
Lady Anne Fellowes stieg aus der neuen Kutsche mit dem Familienwappen. Sie war rechtzeitig zur Saison geliefert worden, so dass sie nicht mehr im altmodischen Landauer ihres Vaters umherfahren musste, in dem sie sich nur ungern sehen ließ. Sie blickte nach oben und dankte dem Himmel, dass er an diesem Tag ein Einsehen gehabt und keinen Regen geschickt hatte. Dass bloß das Kleid nicht ruiniert wurde, das sie eigens für diesen Anlass nach der allerneuesten Mode hatte anfertigen lassen. Man trug wieder auf Taille geschneidert, und zwar an ebenjener Stelle, an der die Natur die weibliche Taille vorgesehen hatte und nicht knapp unterhalb der Brust, wie es jahrelang de rigueur gewesen war. Zum Glück, wie Lady Anne dachte, als sie an ihrer Figur hinabblickte, die nicht mehr ganz vollkommen war, nachdem sie drei Kinder geboren hatte, jetzt aber durch das Korsett in eine elegant geschwungene Form gebracht wurde. Die zarten Musselinkleider im griechischen Stil standen eigentlich nur ganz jungen Mädchen, zu denen sie sich beim besten Willen nicht mehr zählen konnte.
Nun denn, das Wetter spielte mit. Die Ausstellungseröffnung in der Royal Academy of Arts galt als eines der wichtigsten Ereignisse der Saison, und es wäre mehr als unerfreulich gewesen, wenn die Gäste, verborgen unter von Dienern gehaltenen Schirmen, im Laufschritt zum Eingang hätten eilen müssen, bevor sie mit verschmutzten Seidenschuhen und nassen Kleidersäumen in die Halle traten. Lady Anne verneigte sich gefällig, wenn sie Bekannte entdeckte, und hielt ungeduldig Ausschau nach ihrem Ehemann, der wohl aufgehalten worden war.
Ach ja, dort drüben unterhielt er sich mit dem Earl of Livermore. Einen solchen Mann durfte man nicht einfach stehen lassen, selbst wenn er der größte Langweiler unter der Sonne war. Er konnte kaum noch gehen, fühlte sich auf dem Pferderücken aber nach wie vor wie zu Hause. Lady Anne trat hinzu. Geduldig lauschte Sir Richard Fellowes dem Bericht über die schlechte Fasanensaison im vergangenen Herbst und die ähnlich mageren Aussichten für die kommende Moorhuhnjagd. Für den Earl waren die Monate, in denen nicht gejagt wurde, von quälender Eintönigkeit und mussten irgendwie durchgestanden werden, bis er wieder mit Pferd und Flinte in die Wälder ausrücken konnte. Wie die meisten Besucher der Ausstellung interessierte auch er sich nicht für die gezeigten Werke oder deren Schöpfer, sondern für die gesellschaftlichen Freuden, die dieses Großereignis in jedem Mai bot. Was für den Earl so viel hieß wie mit Gleichgesinnten oder leidensfähigen Zuhörern über die Jagd zu fachsimpeln.
Zum Glück erblickte Sir Richard in diesem Moment seine Frau, die ihm einen unwilligen Blick zuwarf, und nutzte dies, um sich in aller Höflichkeit vom Earl zu verabschieden.
»Danke, Sie haben mich gerettet«, sagte er erleichtert zu Lady Anne.
Entschlossen spannte sie ihren Sonnenschirm auf, worauf er ihr mit einer leichten Verneigung seinen Arm anbot. Lady Anne rechnete es ihrem Mann hoch an, dass er sich auch nach jahrelanger Ehe noch solch galanter Gesten bediente, um ihr seine Wertschätzung zu zeigen. Natürlich ignorierte sie wie andere Damen ihres Standes, was er unternahm, wenn er allein in London weilte, und wohin er sich begab, wenn er nicht gerade in seinem Klub die Zeitung las oder mit anderen Herren in jener Gegend von St. James dinierte, die nur Männern vorbehalten war. Pünktlich nach Ostern kehrte er für kurze Zeit aufs Land zurück, bevor die Londoner Saison begann, und reiste mit seiner Frau gemeinsam zur Eröffnung der Royal Academy wieder in die Stadt.
In diesem Jahr hatte Lady Anne Fellowes einen ganz besonderen Grund, sich auf allen Bällen und Dinnerpartys aufmerksam umzuschauen, denn sie suchte einen Mann für ihre Nichte. Diese wurde in diesem Jahr zwanzig und war bereits in die Gesellschaft eingeführt worden, doch selbst der Aufenthalt in Miss Wildings Seminar für höhere Töchter hatte sie nicht in eine elegante junge Dame verwandeln können, die Lady Annes Vorstellungen entsprach.
Lady Anne hatte nie verstanden, wie ein junges Mädchen an solch banalen Dingen wie Steinen Gefallen fin-den konnte, doch seit Georgina vor einigen Jahren eine Reise ans Meer unternommen hatte, verfolgte sie dieses Forschungsgebiet mit leidenschaftlichem Interesse. Es war unfassbar, dass Lady Agatha solche Marotten unterstützte und ihrer Großnichte, die im Grunde recht ansehnlich war, eine glänzende Zukunft ruinierte.
Ein Mann, der Georginas Bekanntschaft suchte und daraufhin mit Geschichten über versteinerte Tiere gelangweilt wurde, die man im lebenden Zustand höchstens mit dem Fuß zertreten hätte, würde vermutlich die Flucht ergreifen und bei einer sittsameren jungen Dame sein Glück versuchen.
Lady Anne hätte es am liebsten gesehen, wenn Georgina gar nicht mehr zu ihrer Großtante gereist wäre. Das ließ sich jedoch nicht vermeiden, da sie außerhalb der Saison bei ihren Kindern auf dem Land blieb und sich das Mädchen nicht das ganze Jahr über aufbürden wollte. Andererseits erschien es unpassend, Georgina im Haus ihres Großvaters sich selbst zu überlassen. James Fielding mochte ein Mann von hohen Prinzipien sein, aber der Umgang mit einem jungen Mädchen erforderte eine feste Hand und viel Geschick, und dafür war eine erfahrene Frau einfach besser geeignet. Zudem zeigte er so wenig Interesse an Georgina, dass diese vermutlich die ganze Zeit in der Bibliothek verbracht hätte. Also musste Georgina, solange Lady Anne ihre Pflichten im Wahlkreis ihres Mannes wahrnahm und sich der Erziehung ihrer eigenen Kinder widmete, wohl oder übel bei Lady Agatha wohnen.
In der Eingangshalle der Royal Academy drängten sich die Menschen, und Lady Anne bemerkte mit Wohlwollen, dass inzwischen auch andere Damen zum Schnürkorsett zurückgekehrt waren, während sie im vergangenen Jahr noch die Einzige gewesen war. Wie befriedigend, in der Vorhut einer neuen Mode zu reiten, statt ihr hinterherzustolpern. Als sie den Earl of Livermore von rechts auftauchen sah, schob sie ihren Mann sanft in die entgegengesetzte Richtung, denn von Moorhühnern wollte sie an diesem Tag nun wirklich nichts mehr hören.
»Einen Augenblick, meine Liebe. Ich möchte Sie mit jemandem bekannt machen.« Sir Richard begrüßte einen hochgewachsenen, hageren Mann in dunklem Frack und eng anliegender, cremefarbener Hose. Doch nicht seine gut geschnittene, eher unauffällige Kleidung erregte sofort die Aufmerksamkeit von Lady Anne, sondern seine Augen – hellgrün und mit einem auffallend dunklen Ring um die Iris – , die sie beinahe zu durchdringen schienen. Er war nicht schön im landläufigen Sinne, keiner der üblichen Beaus, auch nicht mehr ganz jung, wirkte aber interessant und besaß eine Art, sie mit konzentrierter Zuvorkommenheit anzuschauen, als wäre sie der einzige Mensch weit und breit.
»Darf ich vorstellen, meine Liebe – St. John Martinaw, ein brillanter Chirurg am St. Thomas' Hospital. Ich prophezeie jedem, der es hören möchte, dass er die Chirurgie revolutionieren und ihr endlich zu dem Ansehen verhelfen wird, das ihr schon so lange gebührt. Vor einigen Jahren hat er sogar den Prinzregenten behandelt, ich habe Ihnen doch davon erzählt.« Was nicht stimmte, dem so Vorgestellten aber schmeicheln sollte. »Wenn alle Operateure so wären wie er, müssten sie sich nicht länger hinter jedem aufgeblasenen Physikus verstecken. Mr. Martinaw, meine Gattin, Lady Anne Fellowes.«
St. John Martinaw verbeugte sich höflich, wobei er in einer bescheidenen Geste die Hand auf die Brust legte.
»Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Lady Anne, wenngleich Ihr Mann es bei seiner Vorstellung etwas zu gut mit mir gemeint hat. Meine Arbeit bereitet mir große Befriedigung, was mir eigentlich Lohn genug sein müsste. Andererseits muss ich gestehen, dass es für die Patienten von Vorteil wäre, wenn unsere Tätigkeit mehr Ansehen genösse, denn dann würde sich mancher operieren lassen, statt sich auf Egel und Laudanum zu verlassen und so sein Leben zu riskieren. Ich hoffe, Sie verzeihen mir diese offenen Worte.«
ENDE DER LESEPROBE