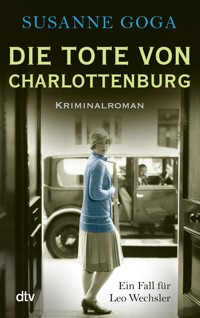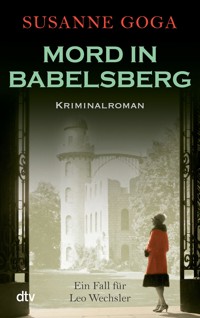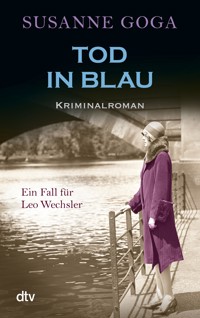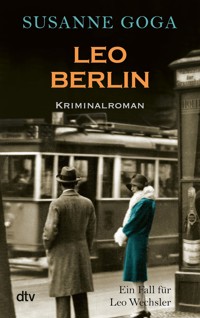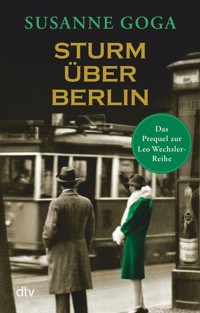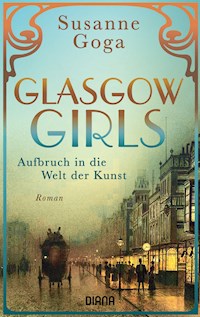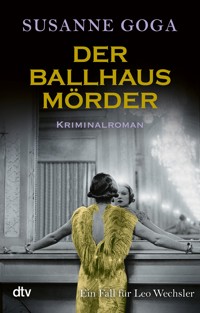9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Krimi
- Serie: Leo Wechsler
- Sprache: Deutsch
Mord im Zeitungsviertel November 1928: Der Journalist Moritz Graf stürzt vom Dach des Ullsteinhauses an der Kochstraße. War es wirklich ein Unfall? Oder wurde er hinuntergestoßen? Graf hatte offenbar an einer explosiven Geschichte gearbeitet. Doch worum es dabei ging, weiß niemand. Kommissar Leo Wechsler trifft bei seinen Ermittlungen auf den ebenso charmanten wie skrupellosen Clemens Marold, die Graue Eminenz des einflussreichen Hugenberg-Konzerns. Der Mann scheint überall zu sein und ganz Berlin zu kennen. Und bald stellt Leo fest, dass er sich einen einflussreichen Feind gemacht hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Susanne Goga
Schatten in der Friedrichstadt
Kriminalroman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Tina,
ohne die Leo nicht Leo wäre
Prolog
TOD AM SCHLACHTENSEE
Wie wir bereits berichteten, kam es am 26. August 1928 auf dem Schlachtensee zu einem tragischen Vorfall. Der Rechtsanwalt Dr. Reinhold Brüder (65) war mit seinem privaten Ruderboot auf dem See unterwegs. Er besaß ein Wochenendhaus am Nordufer und unternahm regelmäßig Bootspartien, bei denen er gelegentlich angelte.
Als er gegen Mittag noch nicht zu Hause war, schickte seine Ehefrau einen Angestellten zum See, der das Wochenendhaus leer vorfand. Kurz darauf wurde das dahintreibende Boot auf dem See gesichtet, von Brüder war keine Spur zu entdecken.
Man verständigte die Polizei und schickte eine Suchmannschaft los. Gegen Abend fand man den Vermissten leblos im Wasser treibend. Der hinzugezogene Arzt konnte nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. Dessen in der Zwischenzeit herbeigeeilte Gattin musste ärztlich behandelt werden, da sie einen schweren Schock erlitt.
Die Obduktion ergab Tod durch Ertrinken. Wie Brüder ins Wasser gelangt war, ließ sich nicht klären. Das Nachbargrundstück ist unbebaut und wird derzeit gerodet, um dort eine Villa zu errichten. Das Wochenendhaus steht am weniger belebten Ufer des Schlachtensees, und es fanden sich keine Zeugen, die den Verstorbenen auf dem See oder am Haus gesehen hatten.
Da Herr Dr. Brüder nicht bei bester Gesundheit war und an Herzbeschwerden litt, geht die Polizei davon aus, dass er entweder infolge der körperlichen Anstrengung ohnmächtig wurde oder einen Schwindelanfall erlitt und ins Wasser stürzte. Am Körper waren keine Verletzungen festzustellen. Hinzu kommt, dass der See mancherorts Strudel aufweist, weshalb dort vom Baden abgeraten wird.
Dr. Brüders Tod wirft eine gewichtige politische Frage auf. Er galt als rechte Hand von Geheimrat Dr. Hugenberg, der sich im Oktober der Wahl zum Parteivorsitzenden der Deutschnationalen Volkspartei stellen will. Der Verstorbene war Direktor der Zentralstelle der Redaktionen des Verlags August Scherl und saß damit an einem entscheidenden Knotenpunkt im Presseimperium Hugenbergs. Seine Unterstützung wäre wohl äußerst wertvoll gewesen, um das hochgesteckte Ziel des Parteivorsitzes zu erreichen. Es wird sich nun zeigen, ob und wann der Geheimrat einen Nachfolger für Herrn Dr. Brüder benennt.
(Aus der Vossischen Zeitung, 3. September 1928)
1
August Friese war verzweifelt. Er hatte fünf Nächte nacheinander in der Palme übernachtet, mehr ging nicht. Das Obdach in der Fröbelstraße war kein Palast, aber der vertraute Ablauf gab ihm was von einem Zuhause. Erst draußen auf Einlass warten, zusammen mit all den anderen – Männer, Frauen und Kinder, ganze Familien, Kriegskrüppel auf Krücken, freche Halbwüchsige, die sich vordrängelten und streitlustig in die Runde schauten. War man dann drin, gab es eine Decke und einen angeschlagenen Essnapf aus Emaille. An langen Holztischen, über denen kleine Lampen baumelten, saßen Männer in weißen Kitteln. Sie hatten Karteikästen vor sich und glichen die Papiere mit ihren Karteikarten ab. Warum sie die Kittel trugen, wusste August Friese nicht – vielleicht sollten sie wie Ärzte aussehen, damit die Leute sie ernstnahmen. Manchmal kam die Polizei und kontrollierte die Karteikästen, wenn sie einen Verbrecher suchte.
Neulich hatte sich eine Frau mit Kind auf dem Arm an die Theke geklammert, weil zwei Angestellte sie nach draußen ziehen wollten. »Bitte lasst mir rein, ick hab doch keene Wohnung. Und die Kleene ist jrade erst jesund. Hattet uff die Bronchjen.«
»Tut mir leid«, hatte einer der Weißkittel gesagt. »Ist gegen die Vorschrift. Sie waren schon vier Wochen hier. Versuchen Sie es in einem anderen Obdach.«
»Und wie soll ick mit die Kleene da hinkommen?«
»Ausnahmen jibt’s nich«, hatte ein Mann hinter Friese gesagt. »Und bestechen kannste die ooch nich, weil du nüscht hast.«
Sie hatten die verzweifelte Frau energisch nach draußen geführt. August hatte ihr mitleidig nachgeschaut.
Heute war er in der gleichen Lage. Also guckte er sich einen Mann im Kittel aus, der neu zu sein schien, vielleicht ließ der ja mit sich reden.
Aber es kam, wie es kommen musste.
»Sie waren fünf Nächte hier«, sagte der Mann mit Blick auf Augusts Papiere.
»Können Sie nicht eine Ausnahme machen? Ich hab noch kein neues Zimmer gefunden …« Die Regeln waren streng für Alleinstehende wie ihn – höchstens fünf Nächte in Folge, und das höchstens fünfmal in drei Monaten. Blieben mehr als zwei Monate Verzweiflung.
»Tut mir leid, Sie sind nicht der Einzige. Und jetzt weitergehen, da warten noch eine Menge Leute.«
Er trat auf die Straße, blieb stehen und warf einen Blick zurück auf den großen roten Backsteinbau, dachte an die warme Decke und die Emailleschüssel, in die heiße Suppe kam, an den Kanten Brot und das Klosett, das frisch gewaschene Nachthemd. Doch es half nicht.
Sein Vermieter hatte ihn vor die Tür gesetzt. »Hier wird nich mehr anjeschrieben, Aujust. Dit kann ick mir nich leisten.« Es war nur ein kleines Zimmer unterm Dach gewesen, aber besser als nichts. Nachdem er seine feste Stellung verloren hatte, hatte er jede Aushilfsarbeit angenommen, die sich bot, auf Baustellen angepackt und grobe Gartenarbeiten übernommen, einfach alles, wobei zwei kräftige Hände gebraucht wurden. Doch damit war es jetzt im Herbst vorbei.
Er dachte verbittert an seine Entlassung. Hätte er bloß nicht mit diesem Neuen im Betrieb geplaudert. Wie hätte er denn ahnen können, dass der Kerl, der sich Alfred nannte, in Wahrheit von der Zeitung war? Ein hinterhältiges Aas, das sich irgendwo einschlich und über Leute schrieb, die keine Ahnung hatten, wer er war. Wie dämlich er gewesen war, diesem »Alfred« von der Sache mit dem Kupferrohr zu erzählen. Kurz vorher hatte er im Personalbüro um einen Vorschuss auf seinen Lohn gebeten und keinen bekommen, obwohl es eine echte Notlage war. Die Arztrechnung war so hoch gewesen. Und dann hatte das Kupferrohr da gelegen, halb unter ein Regal gerutscht, und keiner hatte was gemerkt, als er es in seiner Verzweiflung mitgenommen hatte.
Doch etwas später hatte ihn der Personalchef ins Büro bestellt und ihm die Kündigung gegeben. Warum, hatte August gefragt, obwohl sein Mund ganz trocken gewesen war. »Weil du klaust. Diebe können wir hier nicht gebrauchen.« Dann hatte er ihm eine Zeitung hingeknallt und auf einen Artikel gezeigt. »Da steht es schwarz auf weiß. Kein Name, aber ich erinnere mich gut, wie du hier warst und den Vorschuss wolltest. Kannste dir als Erinnerung mitnehmen.«
August hatte auf der Straße gestanden. Ohne Zeugnis. In dieser Zeit. Da blieben nur Hilfsarbeiten – wenn er Glück hatte.
Er trottete weiter, und plötzlich stieg ihm ein Geruch in die Nase. Er merkte, wie ihm das Wasser im Mund zusammenlief. Kartoffelpuffer, da gab es kein Vertun. Mit dem Geruch kamen die Erinnerungen.
Die hatte die Mutter immer gemacht, hatte pfundweise Kartoffeln gerieben, bis ihr die Hände wehtaten und die Haut ganz rot war. Aber bei elf Mäulern war die Menge nötig, die wollten alle gestopft werden. Und Kartoffeln waren billig, darum gab es zweimal in der Woche Puffer. Wenn einer Geburtstag hatte, auch mit Apfelmus.
Friese blieb vor der Rücker-Klause stehen. Die Kneipe hatte ein Fenster links von der Tür, durch das die Puffer verkauft wurden. Rauch quoll auf die Straße, es roch heiß und fettig. Vor dem Fenster stand eine Schlange. Friese wühlte tief in seiner Hosentasche, zog seine letzten Münzen hervor und stellte sich hinten an.
2
Oberkommissar Leo Wechsler saß gähnend am Frühstückstisch und ließ die Stimmen seiner Kinder über sich hinwegplätschern. Die letzte Nacht war lang gewesen: Er und seine Kollegen hatten einen Verdächtigen observiert und letztlich auch verhaftet, ein großer Erfolg in einem langwierigen Fall, aber er war erst in den Morgenstunden ins Bett gekommen.
»Wieso heißt dein Heft Der Herrenfahrer?«, fragte Marie ihren Bruder, während sie sich ein Brot mit Marmelade bestrich. »Frauen können das auch. Clärenore Stinnes fährt sogar Rennen und ist gerade dabei, einmal um die ganze Welt zu fahren. Das soll ihr erst mal einer nachmachen.«
Georg verdrehte die Augen. »Was weiß ich, die Zeitschrift heißt eben so.«
Er hatte kürzlich sein gespartes Taschengeld für einen ganzen Stapel dieser Hefte ausgegeben. Die Zeitschrift war im Mai eingestellt worden, und seitdem las er die alten Ausgaben Wort für Wort, als wollte er sie auswendig lernen. Er hatte sich schon immer für Autos interessiert und half einmal in der Woche in einer Autowerkstatt aus, um sein Taschengeld aufzubessern.
»In Amerika, in Oklahoma City, gibt es ein Hotel nur für Autos. Das ist sieben Stockwerke hoch. Könnt ihr euch so was in Berlin vorstellen?«
»Wie nett, dass die Autos auch mal Urlaub machen dürfen«, warf Marie ein, was ihr einen Rippenstoß eintrug.
»Jetzt hört auf mit dem Unsinn«, brummte Leo.
Clara stellte ein Körbchen mit gekochten Eiern auf den Tisch. »Ich finde Fräulein Stinnes großartig. Sie fährt einen Adler Standard 6, habe ich gelesen.« Sie vermittelte geschickt wie immer, dachte Leo und zwinkerte ihr zu.
»Wenn ich erst Chemikerin bin und eine Stelle an einer Universität oder in einer großen Firma habe, kaufe ich mir auch ein Auto«, verkündete Marie entschlossen.
Leo staunte immer wieder, wie unterschiedlich seine Kinder geraten waren. Die elfjährige Marie plante gern, sie liebte Chemie und alles, was mit Naturwissenschaften zu tun hatte, Exaktheit und feste Regeln verlangte. Ihr älterer Bruder Georg dagegen arbeitete lieber mit den Händen, und Leo fragte sich, ob es überhaupt lohnte, ihn Abitur machen zu lassen, da er offensichtlich davon träumte, Automechaniker zu werden. Andererseits würde er es womöglich bereuen, wenn er irgendwann auf den Gedanken käme, Ingenieur zu werden, um selbst Autos zu bauen.
Leo stützte den Kopf in die Hand und betrachtete seine Familie. Es war nett, ein bisschen später zum Dienst zu gehen, sodass sie Zeit für ein gemeinsames Frühstück hatten. Die Eier gab es wohl als kleines Extra, weil er den Fall abgeschlossen hatte.
»Wir haben den nächsten Vortrag übrigens auf den 13. November verlegt, sonst hätten wir den Raum nicht bekommen«, sagte Clara. Sie hielt seit einiger Zeit literarische Vorträge an der Freien Sozialistischen Hochschule. Leo wusste, dass sie vorher immer nervös war und sich wünschte, dass er mitkam. Allerdings hätte sie das nie laut gesagt, um ihn nicht zu bedrängen. Ein Kriminalbeamter musste immer mit unvorhergesehenen Dingen rechnen, die eine Verabredung zunichtemachten. Doch er würde sich das Datum in den Kalender eintragen und alles daransetzen, dass er Clara begleiten könnte.
Der Mann mit dem Bürstenschnitt und dem gezwirbelten Schnurrbart saß hinter dem größten Schreibtisch, den Clemens Marold je gesehen hatte. Er gestattete sich den boshaften Gedanken, dass die Maße des Tisches im umgekehrten Verhältnis zu Alfred Hugenbergs geringer Körpergröße standen und diese durch die Wucht des Mobiliars ausgleichen sollten. Die Tischplatte war so blank poliert, dass sich die Deckenlampe kaum verzerrt darin spiegelte, und es lagen nur wenige Akten darauf. Das mochte von Fleiß zeugen oder davon, dass der Mann viele Zuarbeiter hatte und sich selbst nicht um lästigen Papierkram kümmern musste.
Marold schaute sich um. Der Raum hatte mit seiner dunkel-gewichtigen Einrichtung und den gerahmten Bildern deutscher und ausländischer Würdenträger etwas von einem Allerheiligsten, in dem zwei Göttern gehuldigt wurde: Deutschland und Alfred Hugenberg, wenn auch nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.
Ein Glück, dass sein Gegenüber nicht Gedanken lesen konnte. Es war bekannt, dass Hugenberg keinerlei Humor besaß, was seine Person betraf.
»Nehmen Sie Platz, Herr Marold.« Hugenberg deutete auf einen der Sessel.
Marold zog das schwere Möbelstück nach hinten und ließ sich darin nieder. Es war geradezu militärisch straff gepolstert, von Komfort konnte keine Rede sein. Doch das ertrug er gern, wenn er dafür in Hugenbergs Privatbüro bestellt wurde. Denn Clemens Marold ahnte, dass ihn kein Tadel des Konzernchefs erwartete, im Gegenteil.
»Erlauben Sie mir, Ihnen herzlich zu gratulieren, Herr Geheimrat. Der Vorsitz der Deutschnationalen Volkspartei ist ein Amt, in dem Sie segensreich wirken werden.«
Hugenberg drückte die Schultern durch. »Ich danke Ihnen. Es ist eine Bürde, ein solches Amt auszufüllen, aber ich betrachte es als Ehre und werde alles tun, um Deutschland zu dienen. Daher ehrt mich das Vertrauen, das die Parteivertreter in mich setzen.«
Marold musste ein Lächeln unterdrücken. Gerade eben hatte er den Artikel im Jungdeutschen gelesen, der den vielsagenden Titel »Hugenbergs Pyrrhus-Sieg« trug. Darin wurde berichtet, dass die Mehrheit des Geheimrats denkbar knapp ausgefallen war, vielleicht sogar nur eine einzige Stimme betragen hatte, obwohl es keinen Gegenkandidaten gab.
»Im Übrigen werden wir alle verleumderischen Behauptungen zurückweisen«, fügte Hugenberg hinzu, als hätte er nun doch Marolds Gedanken gelesen. »Sie haben womöglich gesehen, was dieses Schmutzblatt schreibt.« Er hielt eine Ausgabe des Jungdeutschen hoch und ließ sie verächtlich auf den Tisch flattern. »Das lasse ich mir nicht gefallen.«
»Selbstverständlich nicht, Herr Geheimrat.« Allmählich wurde Marold ungeduldig. Hugenberg hatte ihn wohl kaum herbestellt, um über die Berichterstattung einer unbedeutenden Tageszeitung zu debattieren.
»Marold, Sie sind nun seit Jahren bei uns im Haus und haben sich vorbildlich bewährt, sowohl was politische als auch finanzielle Fragen angeht. Aber meine Ziele sind höhergesteckt. Geld ist nicht das, wonach ich strebe, sondern die nationale Gesundung unseres Vaterlandes. Zu diesem Zweck habe ich in den vergangenen Jahren einen schlagkräftigen Apparat geformt, der sich auf alle Bereiche der Presse und der damit verbundenen …«
Hugenberg, alles andere als ein begnadeter Redner, war für seinen hölzernen Umgang mit der deutschen Sprache in Wort und Schrift berüchtigt. Ihm zuzuhören erforderte Marolds ganze Disziplin.
»Wie Sie wissen, ist die WiPro eines unserer besten Pferde im Stall. Inzwischen drucken weit über tausend deutsche Zeitungen jeden Tag unsere Artikel, sodass man sagen kann, wir bestimmen, was die Leute in der Provinz lesen.«
Oh ja, das war ein besonders cleverer Schachzug gewesen, dachte Marold. 1916 hatte Hugenberg die Übernahme des einflussreichen Zeitungsverlags August Scherl in die Wege geleitet, in dem auflagenstarke Blätter wie der Berliner Lokal-Anzeiger erschienen, und war Aufsichtsratsvorsitzender geworden. Vor sechs Jahren dann hatte er die sogenannte »Wirtschaftsstelle für die Provinzpresse« gegründet, ein trockener, für Hugenberg typischer Begriff, hinter dem sich jedoch ungeheure politische Macht verbarg. Zeitungen im ganzen Reich erhielten täglich sauber verpackte, vorgefertigte Matrizen, aus denen sie nur noch ihre Druckvorlagen erstellen mussten. Die WiPro lieferte ihnen politische Leitartikel, Sportberichte und Unterhaltung, sodass sich die Zeitungen lediglich um den Lokalteil selbst kümmern mussten. Damit sparten sie Geld und Personal. Aber es bedeutete auch, dass die Leser dieser zahlreichen Zeitungen nur erfuhren, was Hugenberg und seine DNVP sie wissen lassen wollten. Im Reich gab es in vielen Orten nur eine einzige Zeitung, sodass es für Hugenberg und seine mächtigen Geldgeber ein Leichtes war, die politischen Ansichten in die von ihnen gewünschten Bahnen zu lenken. Hinzu kam noch die Wochenschau, produziert von der Ufa, die seit letztem Jahr ebenfalls Hugenberg gehörte.
»Nun, da ich Vorsitzender der DNVP bin, werden noch ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten auf mich und meine Freunde zukommen.« Er hielt kurz inne und räusperte sich. »Wie Sie wissen, ist im August mein geschätzter Weggefährte Herr Dr. Brüder verstorben, mit dem Sie auch zusammengearbeitet haben.«
Marold neigte pietätvoll den Kopf. »Ein schwerer Verlust für den Konzern, Herr Geheimrat.«
»Und auch für mich persönlich, sein Tod hat mich schwer getroffen. Bei meinen Bemühungen um den Parteivorsitz habe ich festgestellt, wie sehr mir Brüder fehlt. Und nun, da ich in dieses hohe Amt gelangt bin, brauche ich jemanden im Konzern, dem ich ebenso vertrauen kann, wie ich ihm vertraut habe. Einen Mann, der im Pressewesen erfahren ist und das Dickicht der Politik nicht scheut. Ich musste nicht lange überlegen, um mich für den mir als am besten geeignet erscheinenden Mann zu entscheiden.« Er legte eine wirkungsvolle Pause ein. »Hiermit übertrage ich Ihnen, Herr Dr. Marold, mit sofortiger Wirkung die Direktion der Zentralstelle der Redaktionen des August Scherl Verlags und damit die Verantwortung für die politische Ausrichtung und Berichterstattung unserer Zeitungen. Sie sind mir direkt unterstellt und nehmen nur von mir Handlungsanweisungen entgegen.«
Marold konnte seinen Triumph nicht verbergen und musste es auch nicht. Hugenberg sollte seine Freude ruhig sehen. »Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, Herr Geheimrat. Es ist mir eine Ehre, ich werde diese große Aufgabe mit aller Leidenschaft erfüllen. Auch wenn ich es zutiefst bedaure, dass ein verdienter Mann wie Dr. Brüder nicht mehr unter uns ist.«
Hugenberg nickte. »Wir sollten unsere enge Verbindung jedoch diskret handhaben. Man macht sich angreifbar, wenn man zu offen vorgeht. Mein Erfolg besteht gerade darin, mit verdeckten Karten zu spielen, dem Gegner ein verflochtenes Labyrinth zu präsentieren, damit er nicht sieht, wie wir in Wahrheit arbeiten.«
»Verschwiegenheit ist unser Kapital.«
»So ist es. Übrigens möchte ich Sie dringend bitten, Remarque von der Sport im Bild im Auge zu behalten.«
»Worauf soll ich achten?«, fragte Marold, der sich wunderte, weshalb ein Sportredakteur besondere Aufmerksamkeit verdiente.
»Wie mir zu Ohren kam, hat er einen Buchvertrag mit Ullstein geschlossen. Es gefällt mir nicht, dass sein Roman bei unserer größten Konkurrenz erscheint. Vorabdruck in der Vossischen, heißt es. Mir schwant Übles, also Augen auf.«
Hugenberg erhob sich und reichte Marold die Hand, vermied es aber, ihn von unten anzusehen.
»Und nun gehen Sie frischen Mutes an die Arbeit.«
Im Korridor blieb Clemens Marold stehen und genoss die Wärme, die ihn durchflutete. Macht war wie ein Rausch, dachte er. Sex, Drogen, Alkohol, Geld, er hatte alles ausprobiert und dann erkannt, dass nichts berauschender war als Macht. Am berauschendsten war es jedoch, Macht über jene auszuüben, die es nicht merkten und sich für unantastbar hielten.
Er warf im Gehen einen Blick auf die Doppeltür mit den Goldbeschlägen, hinter der sich Hugenbergs Büro befand, und lächelte zufrieden. Auf diesen Tag hatte er lange hingearbeitet.
August Friese wankte die Kochstraße entlang. Seine dunkle Hose war feucht und schmutzig, der Mantel stank nach Urin – nicht seinem eigenen, er wusste schon, wohin er pissen musste, aber in dem Keller, in dem er untergekrochen war, hatte er eine Pfütze übersehen.
An der nächsten Ecke blieb er stehen und schaute an dem gewaltigen Haus empor. Trat rückwärts auf die Straße und sprang hastig wieder nach vorn, weil ein Auto hupend hinter ihm vorbeischoss.
Er war betrunken, aber nicht betrunken genug, um gnädig mit sich selbst zu sein. Hätte er mehr Mumm in den Knochen, dann würde er in das feine Haus marschieren, vorbei an dem aufgeblasenen Portier, den er von hier aus sehen konnte, rauf ins Büro, in dem der Kerl mit seinesgleichen hockte, und ihm tüchtig den Marsch blasen. Ihm vor den Augen der Kollegen eine reinhauen. Und allen erzählen, was für ein mieses Schwein er war. Mit welchen Tricks er arbeitete.
Endlich nahm er seinen Mut zusammen und setzte sich in Bewegung, wollte durch die Drehtür in die Eingangshalle, doch der Portier in seiner Operettenuniform vertrat ihm den Weg.
»Ich hab ’nen Termin«, nuschelte Friese, was den Uniformierten nicht beeindruckte.
Sein gewaltiger Schnauzbart zitterte, als er herablassend verkündete: »Das glaube ich kaum. Gehen Sie schon weiter.«
Woher nahm der Kerl die Unverfrorenheit? Bildete der sich so viel auf seine blöde Uniform ein? Friese ließ sich nicht abwimmeln. Mit dem Mut, den ihm der Alkohol verlieh, drängte er weiter. »Doch, ich muss zu …« Verdammt, wo war nur der Name geblieben? Wo die Erinnerung sein sollte, klaffte ein schwarzes Loch. »Zur B. Z. am Mittag. Ich kenn da wen.«
Aber der Portier blieb unerbittlich. »Verschwinden Sie, sonst rufe ich die Polizei.« Er hob die Hand, um einen Schupo herbeizuwinken.
Friese wusste, dass er verloren hatte. Er begann zu lachen, stand einfach da vorm Ullsteinhaus, umbraust vom Verkehrslärm und den Rufen der Zeitungsjungen, und lachte. Er war besoffen, weil er keine Arbeit und kein Dach über dem Kopf hatte. Er hatte keine Arbeit und kein Dach über dem Kopf, weil ein Schwein so über ihn geschrieben hatte. Und nun ließ man ihn nicht vor zu diesem Schwein, das ihm das eingebrockt hatte, eben weil er besoffen war. Ein hübscher Kreis, dachte er benebelt.
Friese taumelte weiter, wohin, wusste er nicht. Nur weg hier, wo man ihn so …
Dann hörte er eine Stimme hinter sich, blieb stehen und drehte sich langsam um, stützte sich an einer Hauswand ab.
»Was machen Sie denn hier?«
Da stand er leibhaftig vor ihm, und jetzt wusste Friese auch wieder den Namen. Graf. Aber die Worte, die er sich für diesen Augenblick zurechtgelegt hatte, wollten nicht kommen. Er stand nur da und schaute den Mann an, dessen Gesicht vor seinen Augen zu verschwimmen schien.
»Sie arbeiten doch bei Siemens-Schuckert, stimmt’s? Was ist denn mit Ihnen passiert?«, fragte Graf und klang aufrichtig besorgt.
Friese warf einen Blick ins nächste Schaufenster. Sah und roch sich plötzlich, ungekämmt und abgerissen und nach Pisse stinkend.
Er lachte rau. »Wollen Sie das wirklich wissen? Für ’ne Wurst und ’ne Weiße erzähle ich’s Ihnen.«
3
Bei Jaedicke in der Kochstraße drängten sich die Gäste an den runden Marmortischen, manche standen auch und hielten Kaffeetassen oder Teller mit Baumkuchen in den Händen. Andere rauchten nur. Hier ging es nicht um Bequemlichkeit, sondern darum, dem Körper Nahrung zuzuführen, damit man danach umso energischer wieder an die Arbeit eilen konnte. Außerdem diente das Café als Nachrichtenbörse. Den kürzesten Weg hatten die Ullsteiner, die nur die Straße überqueren mussten. Es gab zwar eine Kantine im Haus, die günstige Mahlzeiten anbot – von den Eigentümern aus eigener Tasche finanziert –, aber da gingen alle Angestellten hin, während hier die Schreiber unter sich blieben.
Auch die Verlagskollegen von Mosse und Scherl kamen hierher, denn die Berliner Presse war nicht nur vielfältig – sie wuchs und gedieh auch auf engstem Raum in der südlichen Friedrichstadt. Kochstraße, Zimmerstraße, Jerusalemer Straße, Schützenstraße – das waren die Adressen, an denen bei Mosse das Tageblatt, bei Scherl der Lokal-Anzeiger, bei Ullstein die Vossische und die B. Z. am Mittag entstanden und binnen Stunden in Berlin und dem ganzen Reich ausgeliefert wurden.
Das Stimmengewirr hing wie ein Schleier über den Köpfen, dann und wann durchbohrten Gelächter und spitze Bemerkungen das gleichmäßige Rauschen. Wann immer die Tür aufflog, drangen Motorenlärm und Hupen von der Kochstraße herein.
Hugo Behrendt linste wiederholt zu seiner Tischnachbarin, einer blonden jungen Frau mit Bubikopf, hinüber. Er hatte sofort ja gesagt, als sie gefragt hatte, ob der Stuhl am Zweiertisch noch frei sei. Er kannte sie vom Sehen und wusste, dass sie seit kurzem im Ullstein-Buchverlag arbeitete. Und er hatte mitbekommen, dass sie Jette Klammroth hieß. Er hätte gern mehr über sie erfahren, war aber ziemlich schüchtern, und sie schien es auch zu sein, was jeden Versuch einer Annäherung bislang torpediert hatte. Nun saß sie an seinem Tisch, und er brachte keinen brauchbaren Satz über die Lippen.
Hugo war beim Feuilleton der B. Z. am Mittag angestellt und hätte Fräulein Klammroth mit so mancher Anekdote unterhalten können – nur musste er dafür überhaupt erst eine Unterhaltung beginnen. Und genau das war der Haken.
Er löffelte seine Suppe und bemerkte, wie sie zu Moritz Graf hinüberschaute, der allein an einem Tisch saß. Graf war um die vierzig, ein schmaler, beinahe ausgemergelter Mann mit scharfem Profil, der Kaffee trank und dabei in ein Notizbuch kritzelte. Der erfolgreiche Reporter der B. Z. am Mittag war ein Einzelgänger, der ungern mit anderen zusammenarbeitete und sich partout nichts sagen ließ, auch nicht von den Ullsteins persönlich. Graf war dafür bekannt, dass er kaum Zeit im Büro verbrachte. Legendär war die Geschichte, dass er sich auf dem Dach des Ullsteinhauses eine Ecke mit Stuhl und Tisch eingerichtet hatte, um dort seine Artikel zu verfassen. Gesehen hatte diese Ecke allerdings kaum jemand, denn Graf war nicht der Typ, der sich über ungebetene Besucher freute. Jedenfalls trug die Geschichte zu seinem Ruf als Exzentriker bei, für die man im Zeitungsviertel eine Schwäche hatte.
Fräulein Klammroth tauchte ein Stück Bulette in den Senf und kaute langsam, während ihre Augen alles um sich herum begierig aufzunehmen schienen. Irgendwann, dachte Hugo und schob die runde Hornbrille zurecht, um sie besser zu betrachten, irgendwann gelingt es mir, sie anzusprechen. Vielleicht sogar jetzt gleich.
Er holte schon tief Luft, als eine Bewegung durch den Gastraum ging, eine Welle, die alle mitzureißen schien.
Köpfe schossen hoch, Besteck fiel klirrend auf die Tische. Ein junger, schmal gebauter Mann, dessen Haaransatz bereits nach hinten wanderte, war an Grafs Tisch getreten. Er nahm den Hut ab, hängte den Mantel über die Stuhllehne und winkte in Richtung Theke. »Kaffee und Baumkuchen!« Dann setzte er sich und schaute Graf gelassen an. Er hatte ein offenes, freundliches Gesicht, und in seinen Augen blitzte der Schalk.
Ein Geschenk des Himmels für Hugo Behrendt, denn Fräulein Klammroth fragte ihn tatsächlich, was denn da vorgehe.
»Wilder hat sich zu Graf gesetzt.«
Sie sah ihn verwundert an. »Na und? Ich habe mich doch auch zu Ihnen gesetzt. Ist eben eng hier.«
Er lächelte. »Man setzt sich nicht einfach zu Graf an den Tisch.«
»Erklären Sie mir das?«
Das ließ Behrendt sich nicht zweimal sagen.
»Wilder ist Österreicher, er hat schon einige Coups als Reporter für die B. Z. gelandet. Er schreibt meist kürzere Feuilletons und Kritiken. Einmal war er zwei Monate als Eintänzer in einem Luxushotel und hat eine Reportage darüber verfasst. Die hat ganz schön eingeschlagen.«
Fräulein Klammroth machte große Augen. »Natürlich, die habe ich gelesen! Das war sehr interessant, wenn auch ernüchternd. So romantisch, wie man sich das vorstellt, war es ja nicht. Meinen Sie, Graf betrachtet Wilder als Rivalen? Was schreibt er denn so?«
»Graf ist auf Skandale aus, will aufdecken, aufklären, möglichst spektakuläre Geschichten bringen. Dafür schlüpft er in Rollen, arbeitet in verschiedenen Berufen und Milieus. Allerdings nimmt er wenig Rücksicht auf die Menschen, die er in gewisser Hinsicht täuscht.« Er fühlte sich plötzlich unbehaglich und setzte rasch hinzu: »Verstehen Sie mich nicht falsch, Graf ist ein fabelhafter Reporter.«
»Aber ihm fehlt der moralische Kompass?«
»Manchmal zumindest.« Er zuckte mit den Schultern. »Andererseits braucht man wohl eine gewisse Skrupellosigkeit, um in diesem Geschäft voranzukommen. Und er ist einer der Besten, nicht umsonst nennt man ihn ›der Graf vom Zeitungsviertel‹.«
Sie rührte lächelnd in ihrem Kaffee. »Wissen Sie, woran Graf gerade arbeitet? Was Sie über ihn erzählen, klingt spannend.«
Behrendt schüttelte den Kopf. »Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Er ist sehr zurückhaltend, was das angeht. Man munkelt, er sage nicht einmal dem Chef, was er gerade treibt. Und dann landet er einen Coup, und die Heimlichtuerei ist vergeben und vergessen.« Er konnte sich die Anekdote nicht verkneifen. »Er arbeitet gern oben auf dem Dach, ob Sie’s glauben oder nicht. Sein Freiluftbüro nennen es manche.«
Er schaute zum Nebentisch, wo Graf jetzt Wilder anfunkelte, der ungerührt auf ihn einredete. Leider verhinderte der Lärm im Café, dass Hugo hörte, was er sagte. Die Antwort fiel hingegen laut genug aus.
»Ich brauche keinen dahergelaufenen Galizier, der mir Geschichten liefert.«
Wilder zündete sich eine Zigarette an und deutete damit auf den Kollegen. »Ihr Hochmut bricht Ihnen noch das Genick.«
Worauf Graf aufsprang, ein paar Münzen auf den Tisch warf und wortlos das Café verließ.
Fräulein Klammroth sah ihm nach. »Ein interessanter Mann. Ich werde mir seine Reportagen wohl besorgen müssen.« Hugo spielte mit seinem Kaffeelöffel, während um ihn herum gelacht und diskutiert wurde. Er überlegte, was er Fräulein Klammroth noch erzählen könnte, und hörte nur mit halbem Ohr auf seine Umgebung, sodass sich die Gesprächsfetzen, die zu ihm herüberwehten, in eine Art Tongedicht verwandelten.
»… nicht bei Tag, das wäre zu geschmacklos …«
»Die neuen Schnitte … haben sich selbst übertroffen …«
»Correll ist ein anständiger Kerl, Hugenberg hin oder her …«
»Aber wird er die Ufa in den Tonfilm führen können?«
»… mir war’s lieber, als sie nicht geredet haben …«
»Was hat Korff dazu gesagt?«
»Kinder, haben wir uns lange nicht gesehen!« Eine dunkelhaarige Frau im Sportkostüm trat an den Nachbartisch und wurde mit großem Hallo begrüßt.
Hugo sah seine Chance gekommen. »Das ist Gabriele Tergit«, sagte er. »Kennen Sie die? Erstklassige Frau. Gerichtsreporterin beim Börsen-Courier. Letztes Jahr hat sie über den Prozess wegen der Fememorde der Schwarzen Reichswehr geschrieben, das war spannend wie ein Roman.« Er verstummte. War er zu geschwätzig, hatte er sie überfahren?
Doch sie streckte ihm die Hand hin und lächelte. »Ich heiße übrigens Jette Klammroth, ich bin Assistentin im Buchverlag.«
»Hugo Behrendt, B. Z. am Mittag.«
Er ergriff ihre Hand, sie war warm und trocken. Sie fühlte sich gut an.
»Wie ist die Suppe heute?«, fragte Tergit nebenan und ließ sich auf einen Stuhl fallen.
»Schön heiß«, entgegnete Kurt Korff, der Herausgeber der Berliner Illustrirten.
»Na, dann lieber eine Wurst.« Tergit legte Korff die Hand auf den Arm. »Sag rasch, Lieber, wie die Wintermode wird. Was muss ich kaufen, um en vogue zu sein?«
»Das bist du doch immer, Liebste. Die Mode folgt den Frauen. Wir erahnen, was sie wollen, und geben es ihnen. Nicht umgekehrt.«
Mehr bekam Hugo nicht mit, denn er erzählte nun von der Feuerland-Expedition, über die sie demnächst berichten würden, und Jette Klammroth hing an seinen Lippen.
Und Billie Wilder saß da und verzehrte lustvoll seinen Baumkuchen.
Robert Walther stieg am Kaiserplatz aus der S-Bahn und ging in Richtung Weimarische Straße. Der Abend war regnerisch, aber nicht zu kalt. Verzerrt zuckten die Spiegelbilder der Leuchtreklamen über das regennasse Pflaster. Er klappte schützend den Mantelkragen hoch und beschleunigte seine Schritte. Es war ein langer Tag gewesen.
In einem Lebensmittelgeschäft am Kaiserplatz kaufte er Brot und Aufschnitt, zögerte bei den Bierflaschen und kehrte ihnen dann den Rücken. Er trank nicht mehr allein. Er genehmigte sich das eine oder andere Bier, wenn er mit Kollegen in die Kneipe oder zu einer Versammlung ging, mehr nicht.
Manchmal fiel es ihm schwer, die Flaschen im Regal zu lassen, vor allem an Abenden wie heute, an denen er nichts zu tun hatte, aber bis jetzt war es ihm gelungen, und so sollte es auch bleiben.
Er verdrängte die Erinnerung an früher, als er bei solchem Wetter mit Leo und den anderen auf eine Suppe zu Aschinger gegangen war. Nach seiner Versetzung hatte er den Freund monatelang nicht gesehen – bis letzte Woche, als er Leo im Präsidium begegnet war.
Er sollte über einen Fall berichten, der sich in seinem Revier ereignet hatte. Da sein Vorgesetzter Ludwig Richter verhindert war, musste Walther ins Präsidium. Er war ungern zum Alexanderplatz gefahren, da er befürchtete, dort ehemalige Kollegen zu treffen. Er wusste nicht, ob Leo die Gründe für seine Versetzung bekanntgemacht hatte. Falls nicht, hatte es sicher wilde Spekulationen gegeben.
Also hatte er die Inspektion A, in der er so lange gearbeitet hatte, peinlichst gemieden, einen Umweg in Kauf genommen und das Präsidium durch einen anderen Eingang betreten. Alles war gut gegangen, er hatte die fragliche Abteilung erreicht, ohne Bekannten zu begegnen. Er hatte seine Meldung erledigt, denselben Weg zurück genommen und wollte gerade durch die Tür auf die Straße treten, als ihm ein Mann entgegenkam, der abrupt stehenblieb, als er Walther bemerkte.
Leo hatte nur kurz innegehalten und war dann mit ausgestreckter Hand auf ihn zugekommen.
»Robert! Das ist ja eine Überraschung. Kommst du auf eine Tasse Kaffee mit nach oben?«
Walther hatte mit sich gekämpft und dann den Kopf geschüttelt. »Danke, aber ich muss zurück ins Büro.«
Er hatte die Enttäuschung in Leos Gesicht bemerkt und keine Genugtuung empfunden. Im Gegenteil, er hatte sich geschämt, weil er nur zu gut wusste, dass er nicht aus Zeitnot, sondern aus Feigheit abgelehnt hatte. Walther konnte sich den früheren Kollegen nicht stellen, wollte nicht den vertrauten Flur mit den Büros betreten, in denen er so selbstverständlich ein- und ausgegangen war. Er wollte nicht von den banalen Fällen erzählen, mit denen er sich auf seinem Revier beschäftigte, während seine Kollegen nach wie vor spektakuläre Kapitalverbrechen aufklärten.
Es war, als hätte Jennys Verrat ihn so verunsichert, dass er sich selbst nicht mehr kannte. Leo war der Einzige, mit dem er darüber hätte sprechen können, aber sie schienen dieser Tage auf gegenüberliegenden Seiten eines Abgrunds zu stehen, den er nicht zu überbrücken wusste.
Fast hätte er seine Straße verpasst, so tief hatte er sich in seine Gedanken fallenlassen. Das war gefährlich, dachte Walther, er musste sich beherrschen. Disziplin. Nach vorn schauen.
Er wusste nicht, ob er jemals in die Inspektion A zurückkehren würde, ob die Freundschaft mit Leo noch zu retten war, aber er hatte neue Bekanntschaften geschlossen. Es mochten keine engen Freundschaften sein, aber sie konnten ihm nützen.
Für Robert Walther gab es eine Zukunft, auch jenseits des Alexanderplatzes.
4
Applaus brandete auf, als Clara Wechsler am Rednerpult die Mappe zuklappte. Sie hatte über die Romane Joseph Roths gesprochen, vor allem über Das Spinnennetz, der ihr sehr am Herzen lag. In seiner Hauptfigur Theodor Lohse konzentrierte sich für sie die Gefahr, die von jenen Menschen ausging, die nach unten traten und nach oben buckelten, die sich stets ungerecht behandelt fühlten und die Schuld bei jenen suchten, die man ihnen als Feindbild präsentierte, wie im Roman die Juden. Die andere verrieten, um sich bei ihren Vorgesetzten beliebt zu machen, die sich in eine Vergangenheit zurücksehnten, in der sie, so glaubten sie zumindest, einen Status besessen hätten, der ihnen von Natur aus gebührte und um den man sie betrogen hatte.
»Erinnern wir uns an die Worte des ehemaligen Reichskanzlers Wirth: ›Da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. Da steht der Feind, und darüber ist kein Zweifel: Dieser Feind steht rechts!‹ Und dort steht er noch immer. Was Roth vor fünf Jahren schrieb, gilt heute umso mehr«, erklärte Clara abschließend. »Denn wer hat damals in Wirths Rede hineingeschrien, mit der er Walther Rathenaus gedachte? Die Abgeordneten der DNVP. Und nun hat Hugenberg den Vorsitz dieser Partei inne. Er räumt gewaltig auf, und alle, die ihm zu gemäßigt sind, nehmen den Hut, freiwillig oder unter Zwang. Aber es gibt viele, die sich beugen und seiner Führung folgen werden. Und sein Weg führt geradewegs an die Seite der NSDAP. Seien wir wachsam! Ich danke für eure Aufmerksamkeit.«
Sie verbeugte sich leicht und verließ das Podium, obwohl der Applaus lange anhielt. Unten wartete Elly Kaiser und umarmte sie. »Gut gebrüllt«, flüsterte sie ihr ins Ohr.
Elly hatte Clara vor etwa einem Jahr für die Freie Sozialistische Hochschule angeworben, um ab und zu dort Vorträge über Literatur zu halten, die das politische Programm ergänzten. Elly war Sekretärin der SPD-Fraktion im Reichstag. Sie lebte mit einem Mann zusammen, mit dem sie nicht verheiratet war, und hatte im vergangenen Jahr eine kleine Tochter namens Hanna geboren. Dass sie eine sogenannte ledige Mutter war, kümmerte sie nicht.
»Ich glaube, ich habe mich richtig in Rage geredet. War es zu politisch?«, fragte Clara.
Elly lachte. »Unsinn, das war wunderbar. Und dass du noch den Schlenker zu Hugenberg geschafft hast – ausgezeichnet. Dieser Mann … Oh, da will dir jemand gratulieren.« Sie trat lächelnd beiseite, als Leo Wechsler dazukam, Elly begrüßte und Clara auf die Wange küsste.
»Ich hatte gedacht, du schaffst es nicht«, sagte sie und strahlte ihren Mann an.
»Es sollte eine Überraschung sein.« Er trug seinen besten Anzug und hatte die Haare zum zweiten Mal am selben Tag mit Brillantine frisiert, was er gar nicht mochte.
»Die ist dir gelungen.« Dann schaute sie hinüber zu dem kleinen Verkaufstisch ihrer Buchhandlung, den sie vorhin mit Elly aufgebaut und vor dem sich eine Schlange gebildet hatte. »Verzeih, Leo, aber ich kann die Leute nicht warten lassen.«
»Geh nur.« Er schaute ihr nach. Sie bewegte sich anmutig, und das schimmernde dunkelgrüne Kleid betonte ihre rötlichbraunen Haare. Leo war so in den Anblick versunken, dass er Elly Kaiser völlig vergaß. Jedenfalls bis sie ihn ansprach.
»Sie sehen sehr stolz aus, Herr Wechsler.«
»Oh ja. Das bin ich«, sagte er und rieb sich verlegen den Nacken. »Nicht jeder kann seine Frau bei einem Vortrag vor großem Publikum erleben.«
»Nicht jeder will das«, konterte sie lachend. »Aber ich weiß, dass Sie nicht zu dieser Sorte Mann gehören, das hat Clara mir oft genug erzählt.«
Er lachte auch. »Ich hoffe, sie langweilt Sie nicht damit.«
»Ganz und gar nicht. Meist sprechen wir über Politik oder Bücher, aber dann und wann natürlich auch über unsere Männer. Wobei ich zugegeben lieber von Ihrer beruflichen Arbeit höre als von Ihren Vorzügen als Ehemann«, erklärte Elly entwaffnend. »Da war doch dieser aufsehenerregende Fall im Ballhaus. Und die Sache mit dem Cabaret des Bösen gleich zu Jahresanfang.«
Leo nahm sich ein Glas Bier vom Tablett. »Nicht alle Fälle sind so spektakulär wie diese, und nicht alle erhalten so viel Aufmerksamkeit in der Presse.«
Sie schien seine Gedanken zu lesen. »Aber alle verdienen den gleichen Respekt?«
»So ist es.« Er trank einen Schluck. »Es macht nicht viel her, wenn im Wedding eine Näherin im zweiten Hof von ihrem Ehemann erschlagen wird. Das gibt eine Notiz in der Zeitung, vielleicht noch eine, wenn der Mann verurteilt wird. Aber für die Kinder, die das mitansehen, ist es gleichgültig, ob die Presse den Fall banal oder sensationell findet. Sie haben Mutter und Vater verloren, kommen womöglich ins Heim, werden voneinander getrennt. All das interessiert die wenigsten.« In seiner Stimme schwang leise Bitterkeit mit. »Niemand hätte sich für die Garderobiere interessiert, wäre sie nicht ausgerechnet im Hof von Clärchens Ballhaus getötet worden. Oder für den abgerissenen ehemaligen Soldaten, der tot neben Louis Lemasques Cabaret gefunden wurde.«
Elly sah ihn aufmerksam an. »Macht Ihnen das nicht zu schaffen? Ihr Mitgefühl, meine ich.«
»Gelegentlich. Aber was wären wir ohne Mitgefühl?«
Sie sah ihn nachdenklich an. »Da haben Sie recht.«
Leo wechselte das Thema. »Clara erwägt, in die Partei einzutreten.«
»Was halten Sie davon?«
»Ist das eine Fangfrage?«, meinte er belustigt. »Da müssen Sie früher aufstehen. Es ist einzig und allein ihre Entscheidung.«
»Sie selbst sind auch nicht unpolitisch, oder?« Elly Kaiser hatte eine direkte Art, die überraschend, aber nicht unangenehm war. Sie schaute auf die Narbe an seiner linken Schläfe, wo ihn vor Jahren ein Gummiknüppel getroffen hatte. Der Gummiknüppel eines Polizisten, der Leo daran hindern wollte, einen demonstrierenden Arbeiter zu schützen.
»Nein.« Er zögerte. »Und Claras Worte können einen aufrütteln, nicht wahr?«
»Oh ja. Schauen Sie.« Sie deutete auf den Bücherstand, um den sich die Leute drängten. »Sie macht ein gutes Geschäft heute Abend. Und der rote Joseph auch.«
Sie lachte, als Leo sie fragend ansah. »Roth schreibt auch für den Vorwärts.«
»Der Hugenberg ein Dorn im Auge ist.«
»Sie kennen sich ja gut in der Presselandschaft aus, Herr Wechsler.«
Er hob abwehrend die Hand. »Ich lese Zeitung, damit endet mein Expertentum. Aber dass Hugenberg es nicht mit den Sozialdemokraten hat, ist kein Geheimnis.«
»Und sie es nicht mit ihm.« Elly hob ihr Glas. »Darauf trinken wir.«
Der Pianist sah aus, als spielte er nur für sich. Über die Tasten gebeugt, fast gekrümmt, den Kopf dabei schräg nach oben gewandt, als wollte er nicht sehen, was seine Finger taten. Moritz Graf aber wusste es besser. Lenny musste nicht hinsehen, denn nichts von dem, was er um diese Uhrzeit spielte, hatte es je zuvor gegeben, nichts davon war in Noten aufgezeichnet worden. Wenn die anderen Musiker gegangen waren, improvisierte Lenny. Die Musik entstand in ebenjenem Augenblick, in dem sie aus ihm herausfloss.
Graf selbst war ein Mann des Wortes, doch diese Musik in Worte zu fassen, gelang ihm nicht. Nie hätte er darüber schreiben oder auch nur annähernd wiedergeben können, was er empfand, wenn er Lenny hörte. Graf kam meist erst in den Club, wenn die anderen Gäste schon wieder aufbrachen und es leerer wurde. Es ging ihm nicht um Gesellschaft oder Zerstreuung. Wenn Lenny spielte, war es wie eine Begleitmusik zu seinen Gedanken, die nie störend, sondern anregend und herausfordernd war.
Und wenn Lenny endlich den Deckel behutsam schloss, als wäre das Klavier aus Glas, den Hocker zurückschob, nach der Schirmmütze griff und mit wiegendem Schritt, die Zigarette im Mundwinkel, zu Graf herüberkam, begann das freundschaftliche gemeinsame Schweigen.
Doch sie schwiegen nicht immer. Manchmal erzählte Lenny von seiner kleinen Heimatstadt in Georgia, der kargen Kindheit, wie er nach Chicago gegangen war, um als Musiker sein Glück zu suchen, und irgendwann gehört hatte, dass man in London, Paris und Berlin ganz anders leben konnte. Dass die Leute dort seine Musik liebten und ihn zuerst als Musiker und dann erst als schwarzen Mann betrachten würden. Es stimmte nicht ganz, sagte er lächelnd. Bisweilen glotzte man ihn auf der Straße an, zogen Mütter ihre Kinder rasch an ihm vorbei, aber die meisten wollten vor allem seine Musik hören und bewunderten ihn dafür.
Wenn Lennys anfangs noch stockendes Deutsch und Grafs rudimentäres Englisch nicht ausreichten, füllten sie die Lücken eben mit Gesten. Sie verstanden einander immer irgendwie und verabschiedeten sich stets mit einem Handschlag und ohne einen Tag zu nennen, an dem sie sich wiedersehen würden. Ihre Freundschaft funktionierte ohne Daten und Uhrzeiten.
Lenny spielte selbstvergessen, und Graf trank. Er war kein großer Trinker, aber heute war ihm danach. Er hatte einen kleinen Sieg errungen und wollte sich dafür belohnen. Also Musik und Schnaps und dann hoffentlich noch ein bisschen Zeit mit Lenny.
Der Sieg befriedigte ihn ungemein. Als Ernst Wallenberg ihn am frühen Abend in sein Büro zitiert hatte, war Graf völlig klar gewesen, worum es ging.
Der Chefredakteur, dessen Halbglatze von einem krausen Haarkranz umrahmt wurde, hatte ihn über die kreisrunde Brille angesehen und zu seiner Rede angesetzt.
»Herr Graf, Sie kennen das Prinzip unserer Zeitung. Sie wissen, warum unsere Auflage bei kolossalen 600 000 Exemplaren am Tag liegt. Wir haben alle anderen deutschen Zeitungen weit hinter uns gelassen, weil wir den Lesern etwas bieten, das ihnen bei anderen fehlt: objektive, sachliche Darstellungen, die nicht von politischer Meinung gefärbt sind.« Er hatte sich in Rage geredet. »Wir trommeln nicht für die Sozialdemokraten oder die Kommunisten oder das Zentrum – wir sind für alle da. Wir liefern die Informationen, und das Publikum bildet sich die Meinung. So geht das in einer Demokratie.«
Graf hatte die Arme verschränkt, um seinen Widerstand zu signalisieren. »Das kann ich nicht.«
Wallenbergs Kopf war hochgeschossen. »Was soll das heißen, Sie können das nicht? Sie sind einer der Besten bei Ullstein, was sage ich, einer der besten Journalisten in der Hauptstadt, auf gleicher Höhe wie Kisch und Tucholsky. Das wissen Sie, das weiß ich, und darum lasse ich Ihnen auch fast jede Freiheit. Aber ich kann Ihnen nicht gestatten, wochenlang eine Geschichte zu recherchieren, ohne dass Sie mir wenigstens einen Hinweis liefern, worum es geht.«
Kritik, verpackt in Schmeichelei. Das war nicht neu. Er war aufgestanden. »Ich kündige.«
Er tauchte lange genug aus seinen Erinnerungen auf, um einen weiteren Schnaps zu bestellen. Die Kellnerin stellte ihm das Glas wortlos hin, ihr war wohl nach Feierabend. Doch solange Lenny spielte, blieb der Club offen.
Wallenberg hatte die Beherrschung verloren. »Setzen Sie sich! Lassen Sie den Unsinn, wir sind doch erwachsene Menschen.«
»Erwachsene Menschen haben eine Meinung und sagen sie auch. Ich gehöre keiner Partei an. Aber ich nehme mir die Freiheit, jemanden einen Lumpen zu nennen, wenn er einer ist.« Er hatte die Hände in die Hosentaschen gestoßen und sich vorgebeugt. Er kannte Wallenberg lange genug, um zu wissen, worum es eigentlich ging.
»Sie haben mich nicht herzitiert, weil ich mehr Zeit für meine Recherche haben will. Sie wollen mir die Leviten lesen, weil ich Hugenberg einen Giftzwerg genannt habe, was er zweifellos ist. Seine Körpergröße ist umgekehrt proportional zu seiner Aufgeblasenheit, Wichtigtuerei und, am schlimmsten, seiner schamlosen Annäherung an die Nazis.«
Wallenberg hatte resigniert die Hände nach außen gekehrt. »Sie haben ja recht, Graf. Ich unterschreibe jedes Wort. Aber nicht, wenn es in unserer Zeitung steht.«
Damit hatte Graf sich zufriedengegeben. Der Chefredakteur hatte seine Heuchelei eingestanden, das genügte ihm. »Na schön. Ich verspreche Ihnen, Hugenberg nie wieder einen Giftzwerg zu nennen, und nehme die Kündigung zurück. Sie bekommen übermorgen den ersten Teil der Reportage. Dafür geben Sie mir danach Zeit, um nur an dem Projekt zu arbeiten. Und im Übrigen stehe ich nicht für Herrn Wilders Vorschläge zur Verfügung. Wünsche einen angenehmen Abend.«
Er hatte Wallenbergs Antwort nicht abgewartet, aber das war auch nicht nötig. Moritz Graf hatte kaum Freunde im Verlag, doch er kannte seinen Wert.
Und nun saß er hier und kostete seinen kleinen Triumph aus.
Plötzlich wurde es still. Lenny stand auf und klappte den Deckel zu. Dann kam er zu Graf herüber, setzte sich und beugte sich vor. »Let’s drink, my friend.«
Auf dem Heimweg legte Leo den Arm um Claras Schultern. Sie schmiegte sich an ihn, die Aktentasche schwang in ihrer rechten Hand.
»Dein Vortrag hat mir sehr gefallen«, sagte Leo. »Schade, dass Roth den Roman nicht zu Ende geschrieben hat. Was mag ihn davon abgehalten haben?«
Clara zuckte mit den Schultern. »Kann sein, dass es praktische Gründe hatte. Er schrieb damals für so viele Zeitungen, reiste zwischen Wien und Berlin hin und her. Aber es wäre auch denkbar, dass die Ideen versiegt sind, dass der Plan, den er sich für den Roman vorgenommen hatte, nicht funktionierte. Ich würde ihn fragen, wenn er hier wäre, aber man sagte mir, er sei für die Frankfurter Zeitung in Italien unterwegs.«
Leo schwieg nachdenklich. Dann sagte er: »Der Roman klingt stellenweise fast bedrohlich.«
»Du meinst, wegen der Nationalsozialisten?«
»Ja. Sicher, sie haben bei der letzten Wahl keine drei Prozent geholt, aber Hitler redet demnächst im Sportpalast. Sie rechnen mit einem ausverkauften Haus. Offenbar reißt er die Leute mit.«
Clara wirkte still.
»Verzeih, ich wollte dir nicht den Abend verderben«, sagte er rasch. »Nur haben mir deine Worte zu denken gegeben.«
Sie drängte sich enger an ihn. »Leo, du verdirbst mir nicht den Abend. Ich war es doch, die darüber gesprochen hat, und mir macht es auch Sorgen. Und jetzt noch Hugenberg als Parteivorsitzender.« Sie holte tief Luft. »Aber ich bin glücklich, dass du dabei warst. Und dass wir hier durch den Nieselregen gehen und zusammen sind. Das ist doch nicht so schlecht.«
Er blieb stehen und umfasste ihr Gesicht mit beiden Händen. »Nicht schlecht? Es ist das Beste auf der Welt.«
Sie gingen weiter, Hand in Hand wie Jungverliebte.