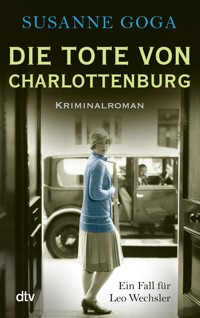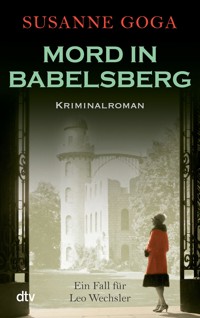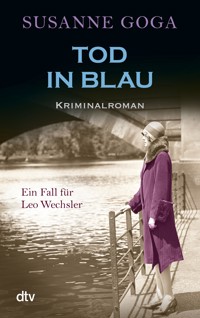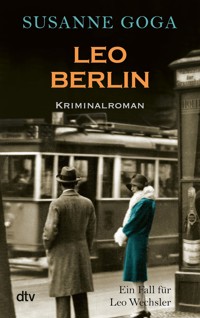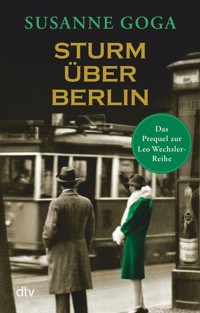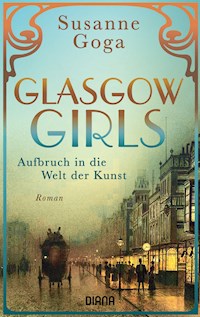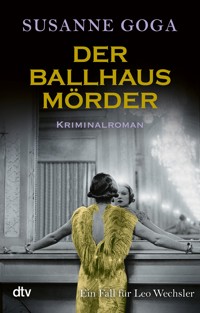3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Reise nach Irland, die alles verändert
Hamburg 1912: Gegen den Willen ihrer Eltern begibt sich die Kaufmannstochter Ida auf eine gewagte Reise, fort von ihren Pflichten, auf nach Irland. Dublin empfängt sie weltoffen, kreativ und gegensätzlich – genau die Abwechslung, die Ida gesucht hat. Schnell findet die junge Künstlerin Arbeit, schließt Freundschaften und lernt den Arzt Cian kennen – und lieben. Voller Zuversicht hofft Ida auf eine Zukunft mit ihm und ein neues Leben in Irland. Doch Europa stehen blutige Zeiten bevor, und bald muss Ida um ihre Träume kämpfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über das Buch
Dublin Anfang des 20. Jahrhunderts: Die Stadt brodelt. Gegensätze spalten die Gesellschaft, die politische Situation ist aufgeheizt. Die junge Malerin Ida Martens verlässt ihre wohlhabende Familie in Hamburg, um in Irland eine Freundin zu besuchen – und bleibt. Sie findet Arbeit, macht neue Bekanntschaften und begegnet Cian O’Connor. Der Arzt gibt sich nach außen schroff und unzugänglich, aber nach und nach kommen er und Ida sich näher. Cian engagiert sich für die Ärmsten der Stadt, und Ida hilft mit ihren Porträts, auf die Missstände aufmerksam zu machen. Doch dadurch wird sie in die gefährlichen Ereignisse in Dublin hineingezogen. Welchen Preis muss Ida für ihr neues Leben zahlen? Und kann sie verhindern, dass auch Cian in den Freiheitskampf verwickelt wird?
Über die Autorin
Susanne Goga, 1967 geboren, ist eine renommierte Literaturübersetzerin und Autorin. Im Diana Verlag erschienen bereits drei Romane, darunter Die Sprache der Schatten, für den sie 2012 mit dem DeLiA-Literaturpreis ausgezeichnet wurde, und der Spiegel-Bestseller Der verbotene Fluss. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Mönchengladbach.
SUSANNE GOGA
Der dunkle Weg
Roman
Originalausgabe 05/2015
Copyright © 2015 by Diana Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Redaktion | lüra – Klemt & Mues GbR, Gisela Klemt
Umschlaggestaltung | t.mutzenbach design, München
Umschlagmotiv |© Robert Harding World Imagery/
Getty Images; Elisabeth Ansley/Trevillion Images; shutterstock
Satz | Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
e-ISBN 978-3-641-16148-4
www.diana-verlag.de
Für Felix –
bester Reisebegleiter, Dublin 2013
PROLOG
Mai 1916
Sie ging durch einen langen Flur. Kahler Steinboden, hölzerne Türen, in die kleine, viereckige Gitter eingelassen waren. Ein feuchter, muffiger Geruch und eine Kälte, die bis ins Innerste drang.
Die Stille war so grenzenlos, dass sie ihr Blut in den Ohren rauschen hörte. Kein Laut kam aus den Zellen. Sobald sie an die vergitterten Fenster herantreten und hineinschauen wollte, stieß etwas sie zurück, so wie zwei Magnete einander abstoßen. Sie wusste, sie suchte jemanden, konnte sich aber nicht an sein Gesicht erinnern.
Der Flur schien endlos. Wann immer sie die letzte Zellentür erreicht hatte, verlängerte er sich wieder, dehnte sich ins Unendliche, verjüngte sich, bis in der Ferne Außenwand und Zellenreihe zu verschmelzen schienen.
Ihr war kalt. Sie zog die Jacke enger um die Schultern, doch das half nicht gegen die Kälte tief in ihrem Inneren. Sie streckte die Hand nach der nächstbesten Tür aus, krallte die Finger in das Gitter, wollte sich an die Tür heranziehen, doch der Widerstand war zu groß. Sie taumelte zurück und schleppte sich weiter.
Irgendwann würde der Flur zu Ende sein. Dann würde sie ihn finden.
Eine laute, schneidende Stimme zerriss die Stille. Sie blieb stehen und schaute nach links zur kahlen Wand. Dort gab es keine Zellen, nur einige Fenster, ziemlich weit oben, sie wusste nicht, ob sie hoch genug hinaufreichen konnte.
Sie reckte die Arme, umfasste die Gitter des Fensters und zog sich empor, stemmte sich mit den Sohlen ihrer Schuhe gegen die weiß getünchte Mauer, klammerte sich verzweifelt fest und konnte endlich durch das Fenster schauen.
Hinunter in einen Hof, umgeben von hohen grauen Mauern, die keinen Blick nach draußen erlaubten. In der Mitte des Hofes stand ein Mann mit rötlich-braunem Haar, dem man die Augen verbunden hatte. An seiner Brust haftete ein Zettel, der das Herz markierte. Seine Hände konnte sie nicht sehen, vermutlich waren sie auf dem Rücken gefesselt.
Wenige Meter vor ihm zwei Reihen Soldaten, die hinteren stehend, die vorderen kniend.
Sie spürte, wie ihre Füße abrutschten, ihre schwitzenden Finger sich von den Gitterstäben lösten … Verzweifelt reckte sie den Hals, bis die Soldaten die Gewehre hoben und das letzte Kommando erklang.
Als die Salve ertönte, stürzte sie nach hinten und fiel und fiel.
Ida setzte sich mit einem Ruck im Bett auf. Ihr Herz schlug so heftig, dass sie kaum atmen konnte. Sie tastete verzweifelt zur Seite, doch das Bett neben ihr war leer.
I ÜBERS MEER
I
ÜBERS MEER
»In Irland passiert nie das Unvermeidliche
und geschieht ständig das Unerwartete.«
SIR JOHN PENTLAND MAHAFFY
1
Februar 1912
Die Koffer standen im Flur. Ida Martens zog den Wintermantel an und griff gerade nach ihrer Mütze, als sie hörte, wie sich die Tür des Salons hinter ihr öffnete.
»Willst du es dir nicht noch einmal überlegen?«, fragte ihre Mutter vorwurfsvoll und klagend zugleich.
Ida drehte sich resigniert um. Sie hatte die Frage oft gehört, zu oft. »Es ist doch kein Abschied für immer. Ich besuche nur eine Freundin in Irland, die ich seit drei Jahren nicht gesehen habe.«
Ein harter Zug erschien auf Luise Martens’ Gesicht. »Nach deiner letzten Reise bekam ich eine andere Tochter zurück. Seit London bist du nicht mehr die, die du warst.«
Vielleicht war ich das nie, dachte Ida. Vielleicht hast du mich nie wirklich gesehen. »Mutter, fang bitte nicht wieder davon an. Mit dem Studium an der Slade School habt ihr mir meinen größten Wunsch erfüllt, dafür werde ich euch immer dankbar sein. Aber ich muss für eine Weile weg aus Hamburg. Es ist an der Zeit, etwas Neues zu sehen.« Sie zögerte. »Es wäre schön, wenn ihr euch mit mir freuen könntet.«
»Das kannst du nicht verlangen, Ida. Eine so weite Reise für eine junge Frau ohne Begleitung, zu Leuten, die du kaum kennst. Überdies bist du in einem Alter, wo andere Dinge –«
Ida hob die Hand, um ihre Mutter zum Schweigen zu bringen. »Lass uns nicht im Streit auseinandergehen.« Sie nahm ihre Handschuhe vom Garderobentisch. »Grüße Vater und Christian von mir. Ich werde euch schreiben.«
Luise Martens machte keine Anstalten, auf sie zuzugehen, geschweige denn, ihre Tochter zu umarmen.
In diesem Augenblick rollten draußen Räder übers Pflaster und hielten vor dem Haus. Ida nickte noch einmal, wandte sich ab und öffnete die Tür.
Ida hatte den Hafen immer geliebt und früher oft ihren Großvater hierher begleitet. Er hatte ihr die großen Schiffe gezeigt und erklärt, woher sie kamen. Oft waren es geheimnisvoll klingende Namen wie Rio de Janeiro, Madagaskar oder Surabaya gewesen, die Idas Fantasie stärker anregten als jedes Märchen.
Als sie an der Reling stand, musste Ida an ihren Aufbruch vor drei Jahren denken. Wie nervös und jung sie gewesen war, voller Erwartung – die erste Reise allein und dann gleich nach London! Nun sah sie ohne Bedauern, wie die vertrauten Stadtviertel an ihr vorbeizogen, Altona, Othmarschen, Flottbek. Sie blickte hinüber zur Elbchaussee, die sie bis nach Blankenese begleitete, wo ihr Großvater gewohnt hatte. Danach wurden die Häuser weniger, der Fluss immer breiter, bis er sich in der weiten Nordsee auflöste.
Ida fühlte sich stark und erwartungsvoll, als sie in den Zug stieg und zusah, wie der Bahnsteig hinter ihr kleiner wurde und die hohen Gebäude der Londoner Innenstadt den endlosen braunen und roten Reihenhäusern der Vororte wichen. Zum Glück hatte sie das Abteil für sich allein und war nicht gezwungen, Konversation zu machen.
Sie lehnte sich in die Polster zurück und dachte an ihren ersten Besuch in London, als sie verspätet in den Zeichensaal der Slade School of Fine Art, einer angesehenen Kunstakademie, gekommen und neben einer selbstbewussten jungen Frau gelandet war. Rote Haare, energisches Kinn, große Augen – ihre erste Begegnung mit Grace Gifford. Ida dachte an die Picknicks auf dem Russell Square und die Abende am Kamin, wenn die Wohnung in Bloomsbury zum Bersten voll gewesen war und alle wild durcheinanderredeten. An Professor Tonks, von dem sie so viel gelernt hatte.
Nach einer Weile tauchte sie aus den Erinnerungen auf und schaute aus dem Fenster, sah die Landschaften wie ein Bilderbuch an sich vorbeiziehen, bemerkte im Vorbeifahren Burgen und hübsche Dörfer, bei denen sich ein Innehalten und Betrachten gelohnt hätte. Nachdem sie die Grenze zu Wales überquert hatten, wurde das Land einsamer und rauer, die Wälder wurden dichter, und die Menschen, die zustiegen, sprachen in einem fremdartigen, singenden Tonfall.
Ida spürte, wie ihre Erregung mit jedem Kilometer wuchs. Was erwartete sie in Irland? Grace hatte in ihren Briefen nicht nur von den Lebensverhältnissen auf der großen Insel, sondern auch so viel von ihrer Familie erzählt, dass Ida beinahe meinte, die Menschen zu kennen. Die strenge Mutter und die begabten Schwestern, von denen Grace ihr gelungene Karikaturen geschickt hatte. Das geliebte Kindermädchen.
Habe ich Dir schon von unserem Kindermädchen Bridget erzählt? Wir haben viel von ihr gelernt – verbotene Rebellenlieder, kleine gälische Redewendungen, Sagen und Legenden. Sie hat uns auch vom großen Hunger erzählt, dem vor sechzig Jahren so viele Menschen zum Opfer gefallen sind. Ich habe fünf Schwestern, und Bridget hat uns alle zu Rebellinnen gemacht.
Wenn der Zug anhielt, versuchte Ida, die Umgebung zu zeichnen, doch die Aufenthalte reichten meist nur für eine flüchtige Skizze. Außerdem war das Zeichnen von Landschaften nicht das, woran ihr Herz hing – eine nützliche Übung, mehr nicht.
Ida zeichnete unauffällig auch einige Mitreisende – einen kräftigen Herrn mit karierter Mütze und buschigem Schnurrbart, der sich in ein Buch über die Vogelwelt Großbritanniens vertieft hatte. Eine ältere, gut gekleidete Frau mit ihren Enkelkindern, die einen eleganten Hut trug und streng und ungeduldig wirkte, was Ida für die Kinder leidtat, was aber ein gutes Motiv abgab. Im Geiste hörte sie dabei die Stimme von Professor Tonks: Unter der Farbe liegt die Präzision. Ohne sie gibt es keine Menschlichkeit.
Sie erinnerte sich an das letzte Porträt, das sie gemalt und das zu einem heftigen Streit mit ihren Eltern geführt hatte.
Ida hatte die Frau bei einem Spaziergang durch St. Pauli entdeckt. Sie saß vor einer Kneipe, ihr Gesicht hatte Ida sofort fasziniert. Sie war Mitte vierzig und sicher einmal wunderschön gewesen – bis jemand ihr die rechte Gesichtshälfte mit einem Messer zerstörte. Die Narben waren stumme Zeugen einer längst vergangenen Tat. Ida hatte die Frau gefragt, ob sie sie malen dürfe. Den Blick würde sie nie vergessen – erst Argwohn, dann ungläubiges Staunen, als sie erkannte, dass es Ida ernst war.
Ihre Eltern waren entsetzt gewesen, als die Frau, die sich die grüne Lotte nannte, zu ihnen nach Hause kam. Doch wo sonst hätte Ida sie malen sollen? Das Licht war nirgendwo besser als im Atelier, das sie sich unter dem Dach eingerichtet hatte.
Zuerst hatte die Frau befangen gewirkt und die Haare über die entstellte Hälfte ihres Gesichts gezogen, doch nachdem Ida ihr versichert hatte, dass sie weder Abscheu noch Furcht empfände, wurde sie vertrauensvoller und gehorchte Idas Anweisungen, bis sie die richtige Position gefunden hatten.
Sie hatte das Bild an einen Anwalt aus Berlin verkauft, vorher jedoch einige Fotografien davon anfertigen lassen. Eine hatte sie Grace nach Dublin geschickt.
Ich habe meinen Schwestern das Bild gezeigt, und alle waren beeindruckt. Sidney hat es mit zu ihrer Zeitung genommen, worauf man sie gefragt hat, ob sie es abdrucken dürfen. Wärst Du damit einverstanden? Stell Dir vor, Dein Name in einer Dubliner Zeitung!
Ida erwachte aus ihren Gedanken. Die Küste rückte näher, sie meinte, die Nähe des Meeres zu spüren – sicher eine Einbildung, denn noch waren sie von hohen, teils in Schnee gehüllten Bergen umgeben. Und doch kam ihr das Gebirge vor wie eine letzte Schwelle, hinter der sie etwas völlig Neues erwartete. Und sie wurde nicht enttäuscht.
Es war ein klarer Tag, und der Blick, der sich bot, als sie kurz darauf den Kopf wagemutig aus dem Zugfenster streckte, nahm ihr den Atem. Sie blickte auf eine Insel, weit, flach und grün, die nah am Festland lag und zu der sich zwei Brücken hinüberspannten: zum einen eine kühne Hängebrücke zwischen zwei gewaltigen Pfeilern, die zu beiden Seiten der Meerenge aufragten. Ein Stück weiter eine Eisenbahnbrücke, auf die sie sich nun zubewegten. Die Schienen führten durch zwei eiserne Röhren. Staunend zog Ida den Kopf ein und schloss das Fenster, blieb aber stehen, um nichts zu verpassen. Es war ein sonderbares Gefühl, in die Dunkelheit einzutauchen und zu wissen, dass tief unter einem Schiffe entlangfuhren. Doch dann verließen sie die Röhre, und beiderseits des Zuges breitete sich die weite, grüne Landschaft aus.
Ida atmete tief durch und setzte sich wieder, während der Zug sich Holyhead an der äußersten westlichen Spitze von Wales näherte. Dort würde sie an Bord des Postdampfers gehen, der die Irische See überquerte und in Kingstown nahe Dublin anlegte.
Nicht lange danach tauchten die ersten Häuser von Holyhead auf. Der Zug fuhr bis zum Hafen durch. Auf dem Bahnsteig fand Ida einen Gepäckträger, der ihre Koffer auf einen Wagen lud.
»Zum Postdampfer, Miss?«, fragte der Mann, als er sich mit seiner Last in Bewegung setzte.
»Ja, bitte.«
Sie kamen an einem von Säulen getragenen Tor vorbei, das an eine Miniaturausgabe des Arc de Triomphe erinnerte. Dann stand Ida unvermittelt am Wasser, wo die Hafenmauer ohne Geländer steil zum Meer hin abfiel. Sie blickte auf die See, die an diesem dunklen Februartag bleigrau schimmerte.
»Kann man bei klarem Wetter bis nach Irland sehen?«, fragte sie unvermittelt.
Der Gepäckträger warf ihr einen erstaunten Blick zu. »Das ist eine gute Frage, Miss. Ich bin jetzt fünfundsechzig und hab noch nie was gesehen.« Er kratzte sich am Kopf. »Kann natürlich dran liegen, dass ich mit meinem Karren meist nach vorn gebeugt gehe. Aber keine Sorge, der Dampfer braucht nicht lange, wenn Sie es nicht erwarten können.«
Die SS Anglia war tatsächlich eindrucksvoll. Ein schlanker Dampfer mit zwei hohen, schwarz-weißen Schornsteinen und einem schwarzen Rumpf, der sich sanft auf dem Wasser wiegte.
»Waren Sie schon einmal drüben?«
Der Mann schaute sie entgeistert an. »Was soll ich denn da? Mir reicht es, wenn ich von hier aus die Schiffe sehe. Komme manchmal nach Feierabend her und schaue sie mir an. Ich kenne jedes einzelne mit Namen, kann Ihnen das Baujahr und die Geschwindigkeit und die Tonnage sagen. Aber damit fahren … nein.«
Menschen waren sonderbar. Manche wohnten am Meer, ohne je über den Strand zu laufen, einige führten ein Angelgeschäft, ohne zu fischen, und wieder andere liebten Schiffe, ohne je an Bord zu gehen.
Sie selbst hingegen konnte es kaum erwarten, die Anglia zu betreten.
Es war kalt, und der Aufenthaltsraum unter Deck erschien verlockend. Ida rang kurz mit sich, zog dann aber die Mütze tiefer ins Gesicht, wickelte sich den Schal eng um den Hals, schlug den Kragen ihres Tweedmantels hoch und machte sich daran, das Deck des Schiffes zu erkunden. Sie ging die Reling entlang, so weit es den Passagieren erlaubt war, und schaute immer wieder aufs Meer und zum Land zurück, als wollte sie die Strecke mit den Augen messen.
Als die Maschinen ansprangen, erbebte das Deck unter ihren Füßen, und die Aufregung schlug wie eine Welle über ihr zusammen. Vor ihr lag nun das Land, über das sie so viel gehört hatte und das ein Widerspruch in sich zu sein schien. Wann immer sie glaubte, sie habe etwas verstanden, lieferte Grace eine Geschichte oder Anekdote, die das genaue Gegenteil zu beweisen schien. Die Sprache selbst war Teil dieser Verwirrung, die schon beim Namen ihres Zielorts anfing.
Du wirst in Kingstown ankommen, das liegt ganz in der Nähe von Dublin. Eigentlich heißt es Dún Laoghaire, und eines Tages wird man den Ort auch so nennen. Wenn du hier bist, bringen wir Dir ein bisschen Irisch bei, aber keine Sorge, hier sprechen alle Englisch, Du wirst also verstehen und verstanden, hatte Grace in ihrem letzten Brief geschrieben.
Ida stand in Gedanken versunken da, während ihr die Kälte in die Glieder drang, konnte sich aber immer noch nicht überwinden, unter Deck zu gehen. Außer den Seeleuten war niemand hier oben, kein vernünftiger Mensch setzte sich freiwillig diesem Wetter aus.
Ein heftiger Wind kam auf und zerrte an ihrem Mantel. Ein Schauer überlief sie. Sie warf einen letzten Blick auf Anglesey und das Festland dahinter, dann begab sie sich in den Aufenthaltsraum, wo es angenehm warm war. Sie bestellte Tee und Sandwiches und suchte sich einen bequemen Platz.
Ida bedauerte es sehr, dass sie den Hafen von Kingstown an einem Winterabend erreichte, denn trotz der Lichter am Ufer war nicht viel zu erkennen. Sie konnte immerhin die geschwungenen Mauern ausmachen, die den Hafen begrenzten und sie wie zwei ausgebreitete Arme empfingen. Trotz der eisigen Kälte spürte sie eine seltsame Vertrautheit, als würde das Land sie willkommen heißen. Zu ihrer Linken zeichneten sich die Umrisse eines lang gestreckten Gebäudes ab, neben dem das Schiff anlegen würde. Weiter rechts befand sich ein großer, pavillonartiger Bau, vielleicht ein elegantes Hotel.
Sie holte tief Luft und schloss kurz die Augen. Ihr Herz schlug bis zum Hals, und sie bekam Angst vor der eigenen Courage. Bald würde sie die Freundin wiedersehen, der sie jahrelang nur auf dem Papier verbunden gewesen war. Würden sie einander immer noch so gut verstehen? Wie würde die Familie Gifford sie aufnehmen? Konnte sie als Malerin hier etwas erreichen?
Ich hoffe sehr, dass ich Dir unser armes, verrücktes Land irgendwann zeigen kann. Nichts ist einfach in Irland, nichts nur schwarz oder weiß, hatte Grace einmal geschrieben.
Ja, dachte Ida bei sich, ich bin bereit.
An Deck wurde es voll, die Passagiere drängten an die Reling und winkten Freunden und Verwandten zu, die sie am Anleger erwarteten. Ida hielt Ausschau nach Grace, konnte sie aber in der Dunkelheit nicht erkennen. Mit einem leichten Ruck legte das Schiff an, die Gangway wurde ausgeklappt, und die Reisenden schoben sich nach vorn. Ida ließ sich Zeit und wartete, bis die meisten von Bord gegangen waren. Dann rückte sie ihre Mütze zurecht und verließ das Schiff.
»Ida!« Sie hörte die Stimme schon, bevor sie ihre Freundin entdeckt hatte. Dann sah sie die zierliche Gestalt auf sich zukommen und lief los, ohne auf ihr Gepäck zu achten, um Grace zu umarmen.
»Lass dich ansehen.« Grace löste sich von ihr und trat einen Schritt zurück. »Du siehst erwachsener aus.«
»Das Gleiche könnte ich von dir sagen. Und du bist so elegant.«
Grace trug einen Wintermantel mit Pelzkragen und einen hübschen Hut mit breiter Krempe. »Komm, wir holen dein Gepäck. Meine Schwester hat einen Bekannten überredet, ihr sein Automobil zu leihen.« Sie deutete vage über die Schulter, wo eine junge, ebenfalls rothaarige Frau mit verschränkten Armen neben einem schwarzen Wagen auf sie wartete.
Grace fand einen Gepäckträger, der Idas Koffer auf seinen Karren wuchtete. »Zu dem Wagen dort drüben.« Sie drückte dem Mann eine Münze in die Hand und zog Ida mit sich zu der jungen Frau.
»Darf ich vorstellen? Meine Schwester Sidney Gifford. Seit sie Journalistin ist, nennt sie sich John Brennan. Das solltest du beachten, falls du eine Antwort wünschst. John, das ist Ida Martens.«
Grace hatte ihr geschrieben, dass John politische Artikel für die Zeitung Sinn Féin verfasste.
Die junge Frau streckte ihr lächelnd die Hand entgegen. Sie hatte ein rundes Gesicht mit Wangen, für die Ida nur das Wort Apfelbäckchen einfiel. Als sie jedoch den Mund öffnete, wurde Ida sofort klar, dass sie nichts Niedliches an sich hatte und weder die Ruhe noch die Sanftheit ihrer älteren Schwester besaß. »Vermutlich wissen Sie alles über unsere Familie, nachdem Grace Ihnen so oft geschrieben hat. Ein Freund, dessen größter Vorzug darin besteht, ein Automobil zu besitzen, war so freundlich, es mir heute zur Verfügung zu stellen.«
Der Gepäckträger hatte die Koffer abgestellt und wartete auf seine Bezahlung. Während Grace das erledigte, hievten Ida und John die Koffer in den Wagen.
»Ich hoffe, dir ist nicht allzu kalt. Hier hast du eine Decke.« Grace breitete eine karierte Decke über Idas und ihre Beine, während John sich ans Steuer setzte. Der Motor sprang dröhnend an, der Wagen fuhr langsam los.
»Sie sind Journalistin?«, fragte Ida.
»Das ist nur eine meiner vielen Beschäftigungen«, antwortete John. »Ich bin in der Sozialistischen Partei, halte Vorträge, kämpfe für das Frauenwahlrecht und die irische Republik. Habe ich etwas vergessen? Ach ja, und ich verteile Essen an Schulkinder.«
»Man könnte sie die Heilige Johanna der Sozialisten nennen.« In Graces Stimme schwang leiser Spott mit.
»Und du?«, fragte Ida ihre Freundin. »Machst du auch bei so etwas mit?«
»Natürlich«, antwortete John an Graces Stelle. »Unsere Schwestern Muriel und Nellie sind ebenfalls dabei. Was wäre Irland ohne die Giffords?«
Ida bedauerte, dass sie Graces Gesicht im Dunkeln nicht sehen konnte. Die Freundin hatte in ihren Briefen von John berichtet, von ihrer scharfen Zunge, dem spöttischen Humor, der unruhigen Energie, die sie ständig in Bewegung hielt und dazu antrieb, neue Herausforderungen zu suchen. Manchmal glaube ich, sie nimmt mich nicht ernst, weil ich ihr zu brav und ruhig erscheine, hatte sie einmal geschrieben.
Sie war natürlich zu unbarmherzig mit sich. Grace war eine Künstlerin, die sich bemühte, von ihrer Arbeit zu leben und von ihren Eltern unabhängig zu werden. Wie schwer das war, wusste Ida nur zu gut, und sie respektierte die Freundin dafür. Sie spürte die Spannung zwischen den Schwestern, die unterschwellige Distanz.
»Erzähle mir von deiner Arbeit«, sagte Ida, um Grace ihre Wertschätzung zu bezeugen.
»In letzter Zeit gehe ich häufig in den United Arts Club, dort würde ich dich gern einführen«, antwortete Grace, und Ida hörte die Dankbarkeit in ihrer Stimme. »Er wurde vom Ehepaar Markievicz gegründet, ich habe dir von ihnen geschrieben.«
»Die Frau, die den polnischen Grafen geheiratet hat und kleinen Jungs das Schießen beibringt, ich erinnere mich. Die würde ich gern kennenlernen.«
»Dort verkehren interessante Leute, und alles ist ganz zwanglos. Fast wie mit den Leuten von der Slade. Du wirst dich sicher wohlfühlen und Kontakte knüpfen können.«
»Zwanglos und bohemienhaft, aber nicht unpolitisch«, warf John von vorn ein. »Nichts, was die Markievicz machen, ist wirklich unpolitisch.«
»Nun aber Schluss damit«, sagte Grace mit fester Stimme. »Dies ist Idas erster Abend in Dublin, da wollen wir sie nicht gleich mit irischer Politik überfallen.«
Das Haus der Giffords lag in Rathmines, einer wohlhabenden Gegend, die sich durch nichts von den gutbürgerlichen Vierteln einer englischen Stadt unterschied. In der Dunkelheit konnte Ida nicht viel erkennen, doch was die Straßenlaternen enthüllten, bestätigte ihren Eindruck. Großzügige, teils villenartige Häuser mit weitläufigen Gärten, aus deren Fenstern warmes Licht nach draußen fiel.
Bei dem Gedanken, Graces Eltern kennenzulernen, wurde Ida ein bisschen mulmig. Wenn Grace über ihre Mutter schrieb, hatte sie stets eine gewisse Kälte gespürt, und die Vorstellung von Isabella Gifford inspiziert zu werden war nicht gerade beruhigend. Sie erinnerte sich, wie liebevoll Grace damals von ihrem Kindermädchen gesprochen hatte, das den Gifford-Kindern die Zuwendung geschenkt hatte, die sie bei der Mutter vermissten. Sie zuckte zusammen, als Grace sie aus ihren Gedanken riss.
»Wir sind da.«
Isabella und Frederick Gifford warteten im Salon, um den Gast ihrer Tochter zu begrüßen. Mr. Gifford empfing sie herzlich und bot ihr einen Platz an, bevor er sich nach ihrer Reise erkundigte. »So so, die Anglia, ein schönes Schiff.«
Mrs. Gifford klingelte und ließ einen kalten Imbiss bringen. »Sie müssen nach der langen Reise sehr hungrig sein, Miss Martens.« Sie klang höflich, aber ein wenig distanziert.
Ida griff dankbar zu, während Grace sie beobachtete, als könnte sie es noch nicht ganz fassen, dass ihre Freundin tatsächlich bei ihnen zu Hause saß. John hatte sich verabschiedet und war weitergefahren, ohne sich um den mahnenden Blick ihrer Mutter zu kümmern.
Während Ida aß, stellte Mr. Gifford weitere interessierte Fragen nach ihrer Reise.
»Erst mit dem Schiff nach London und von dort aus mit dem Zug nach Wales …«
»… und dann wieder mit dem Schiff hierher«, sagte Ida unbekümmert. »Ein ziemlich weiter Weg. In London habe ich zwei Tage bei Bekannten meiner Eltern verbracht.«
Mrs. Gifford hielt sich still im Hintergrund, während ihr Mann freundlich plauderte. Ida erkannte in ihm den Vater wieder, von dem Grace in ihren Briefen liebevoll erzählt hatte.
Als Idas Teller leer war und sie den Tee getrunken hatte, spürte sie plötzlich, wie ungeheuer müde sie war.
»Ich glaube, Sie möchten sich jetzt zurückziehen«, sagte Mrs. Gifford, die ihr die Erschöpfung wohl angesehen hatte.
»Ja, das würde ich gern. Vielen Dank für das Essen und den freundlichen Empfang.«
Grace führte sie nach oben und öffnete eine weiß lackierte Tür. »Unser Gästezimmer. Hier haben zwei meiner Schwestern gewohnt, die inzwischen ausgezogen sind.«
Ida schaute sich um. Ihre Koffer warteten schon neben dem Schrank, das Bett war mit blau geblümter Wäsche bezogen, im Raum duftete es zart nach Lavendel. Die Möbel waren alt, aber gepflegt, und in der Ecke am Fenster stand noch ein Schaukelpferd aus Kindertagen.
Grace umarmte Ida flüchtig. »Ich wünsche dir eine gute erste Nacht. Bis morgen.«
Nachdem sie gegangen war, konnte Ida kaum noch ihre Kleider ablegen, bevor sie ins Bett fiel und schon bald darauf einschlief.
2
Falls Ida geglaubt hatte, dass sie den nächsten Tag gemächlich beginnen würde, wurde sie eines Besseren belehrt. Grace klopfte um halb acht an die Tür und steckte den Kopf herein, als Ida verschlafen »Ja, bitte?« fragte.
»Tut mir leid, dass ich dich so früh wecke, aber meine Schwester Muriel hat uns zum Frühstück eingeladen.«
Ida setzte sich auf, schob sich die Haare aus dem Gesicht und sah sich ihr Zimmer zum ersten Mal bei Tageslicht an. Es war schlicht, aber hübsch eingerichtet. Zartblaue Vorhänge mit einem kleinen Blumenmuster, die zu der Bettwäsche passten, ein abgenutzter, aber hochwertiger Teppich in Blau- und Grüntönen. An einer Wand hing eine gerahmte Karikatur, unverkennbar das Werk von Grace. Karikaturen waren immer ihre starke Seite gewesen, und sie versuchte seit geraumer Zeit, damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen, indem sie sie zum Beispiel an Zeitungen verkaufte.
Ida lächelte ihre Freundin an. »Bei so vielen Geschwistern kann man leicht den Überblick verlieren! Mal sehen, ob ich wenigstens die Mädchen zusammenbekomme.« Sie begann, an den Fingern abzuzählen: »Da wäre Ada, die nach Amerika gegangen ist, Katie, die Sprachen studiert hat und mal Lehrerin in Deutschland war, Nellie, die auf dem Land Hauswirtschaft unterrichtet, Sidney, die für Zeitungen schreibt und einen Männernamen trägt, Muriel, die gerade einen Professor geheiratet hat, der gern Röcke, Verzeihung, Kilts trägt, und Grace, die mich um halb acht aus dem Schlaf gerissen hat.«
Grace wurde ein bisschen rot, kam aber herein und setzte sich auf den gepolsterten Hocker vor der Frisierkommode.
»Und das sind tatsächlich nur die Mädchen«, sagte sie mit gespielter Zerknirschung.
Um neun Uhr nahmen sie die Straßenbahn, und Ida schaute aus dem Fenster, ohne viel zu sagen. Grace schwieg ebenfalls – vielleicht wusste sie aus eigener Erfahrung, dass Ida als Künstlerin die Stadt mit den Augen erleben wollte, bevor sie sich Erklärungen anhörte. Schließlich begann sie doch: »Mutter hat sich nur zögernd damit abgefunden, dass Muriel in ihren Augen einen unpassenden Mann geheiratet hat, zumal sie als Erste eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen sollte. Und was macht sie stattdessen? Verliebt sich in einen Professor, der gälische Sprache unterrichtet und patriotische Theaterstücke schreibt.«
Ida schaute ihre Freundin von der Seite an, und Grace musste lachen.
»Es war ein Schlag für Mutter. Dabei ist er einer der wunderbarsten Menschen, die ich kenne. Du wirst ihn sicher mögen.«
Ida lächelte. »Hört sich an, als hätte deine Schwester die richtige Wahl getroffen. Wie ist es eigentlich, mit so vielen Geschwistern aufzuwachsen? Ich selbst habe ja nur einen Bruder.«
Grace überlegte kurz. »Wir sind zwölf, da bilden sich unweigerlich Gruppen. Ada und Katie sind deutlich älter und haben viel mit unseren Brüdern unternommen. Nellie, John, Muriel und ich hingegen waren oft zusammen und sind es noch heute. Was nicht heißt, dass wir einander sehr ähnlich wären. Du hast John und mich ja erlebt. Und gegen Muriel bin ich ein Temperamentsbündel«, sagte sie lachend.
»Ist sie so ruhig?«
»Oh, ja. Glaube bitte nicht, sie würde sich in deiner Gegenwart unwohl fühlen. Sie ist einfach ein Mensch, der gern still dabeisitzt und beobachtet und zuhört.«
Grace stand auf, als die Straßenbahn klingelnd abbremste. »Hier müssen wir raus.«
Sie gingen die Straße mit den bescheidenen Reihenhäusern entlang, und Ida nahm alles, was sie sah, in sich auf – die Frau, die die Stufen vor der Tür putzte, den Milchhändler mit seinem Pferdewagen, der die karierte Mütze tief ins Gesicht und den Schal bis über die Nase gezogen hatte, die spielenden Kinder, so dick eingepackt gegen die Februarkälte, dass sie kaum in ihren Hinkelkästchen hüpfen konnten. Ida fragte sich, wie die Menschen hier lebten, ob sie die tiefe Zerrissenheit des Landes, von der Grace so oft geschrieben hatte, spürten und dagegen kämpften oder lediglich darauf bedacht waren, für ihre Familien zu sorgen und das Essen und die Miete für den nächsten Monat zu sichern.
»Die Leute hier sind nicht arm«, sagte Grace, als hätte sie Idas Gedanken gelesen. »Armut sieht in Dublin anders aus. Für die Armen wäre diese Straße der Himmel.«
Als sie Idas Blick bemerkte, fügte sie hinzu: »Wir geben Essen an Schulkinder aus, weil sie zu Hause nichts bekommen. So etwas wäre hier nicht nötig.«
Sie blieb vor einem Haus mit einer hübschen, blau gestrichenen Tür stehen. »Wir sind da.«
Auf ihr Klopfen hin erklangen leichtfüßige Schritte, dann öffnete ihnen eine schlanke junge Frau, die Grace recht ähnlich sah. »Guten Morgen!« Sie lächelte Ida an. »Ich bin Muriel MacDonagh. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen.«
Sie hatte eine leise, angenehme Stimme und wirkte tatsächlich ruhiger als ihre Schwester. Nachdem sie die Mäntel, Schals und Mützen an die Garderobe gehängt hatte, bat sie Ida und Grace ins Wohnzimmer, das zur Straße hinausging und ein hübsches Erkerfenster aufwies. Ida bemerkte sofort die übervollen Bücherregale, die sich an zwei Wänden entlangzogen.
Muriel MacDonagh sah sie ein wenig verlegen an. »Die meisten gehören meinem Mann. Sein Arbeitszimmer ist sehr klein, darum haben sie sich bis hierher ausgebreitet.«
»Unsinn, Muriel, ich weiß genau, wie viele Kisten wir zu Hause hinaus- und hier hereingeschleppt haben«, warf Grace mit sanftem Tadel ein. »Du solltest dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Meine Schwester ist sehr belesen, selbst wenn sie die Häuslichste von uns allen ist …«
»Noch häuslicher als Nellie, die sogar Hauswirtschaft studiert hat«, ergänzte Muriel lachend. Ihre Wangen röteten sich, sie wurde etwas lebendiger. Ida spürte die starke Bindung zwischen den Schwestern.
»Ist dein Mann auch da?«, fragte Grace.
»Er kommt gleich. Er muss noch etwas für die Reviewvorbereiten. Joe ist hier, um den Artikel abzuholen. Er hat MacDonagh schon auf die Füße getreten und gesagt, das Eheleben mache ihn träge.«
Gleich darauf hörten sie, wie sich zwei Männer im Flur voneinander verabschiedeten. Ida, die am Fenster saß, warf einen neugierigen Blick hinaus und sah einen großen, schlanken Mann aus dem Haus eilen, der statt eines Mantels einen dramatisch wirkenden Umhang trug. Dann drehte er sich abrupt um, rief etwas zur Haustür und ging anschließend lachend davon. Unter seinem Hut blitzte eine goldgerahmte Brille auf, mehr konnte Ida auf die Schnelle nicht erkennen. Umhang, Brille, Joe. Das konnte sie sich merken. Sie wusste, dass Grace und ihre Schwestern einen kaum überschaubaren Freundeskreis besaßen.
Dann wurde die Wohnzimmertür schwungvoll geöffnet, und ein kleiner, dunkelhaariger Mann trat geradewegs auf Ida zu. Er trug Hemd und Weste, doch als ihr Blick nach unten wanderte, bemerkte sie den Kilt. Sie hatte noch nie einen Mann im Rock gesehen, aber Grace hatte sie vorgewarnt, und so schaute sie ihm gelassen entgegen.
Thomas MacDonagh ergriff ihre Hände. »Miss Martens, es freut mich sehr, Sie kennenzulernen! Unsere liebe Grace hat natürlich von Ihnen berichtet. Eine Künstlerin aus Deutschland bei uns zu haben ist uns ein besonderes Vergnügen.« Er schaute zu seiner Frau. »Wenn ich überlege, wem wir sie alles vorstellen können …«
»Lass ihr Zeit, Liebling, sie ist gerade erst angekommen«, erwiderte Muriel sanft. »Wir sollten jetzt frühstücken, unsere Gäste sehen schon ganz schwach aus.«
»Verzeihung, wie gedankenlos von mir«, sagte MacDonagh und hielt ihnen die Tür auf.
Im kleinen Esszimmer war der Tisch liebevoll gedeckt. Muriel hatte trotz der Jahreszeit einen Blumenstrauß aufgetrieben. Der Raum war angenehm hell, und in einer Ecke bemerkte Ida einen kleinen Arbeitstisch mit einem Nähkorb.
Ein sehr junges, schüchtern wirkendes Hausmädchen trug Rührei, Porridge, Speck, Würstchen, verschiedene Sorten Marmelade und Toast auf. Dazu gab es starken Tee mit viel Milch und Zucker. Ida bemerkte, wie die Hände des Mädchens zitterten, als sie das Frühstück servierte.
Als sie gegangen war, lächelte Muriel verlegen. »Unsere Schwester Nellie hat uns Maeve empfohlen. Ihr Vater hatte sie auf die Straße gesetzt, weil sie ein Kind erwartete und nicht verheiratet war. Leider hat sie das Kind verloren. Sie wollte nicht zurück zu den Eltern, und Nellie hat uns gebeten, sie einzustellen. Nachmittags arbeitet sie in einem Laden. So kommt sie einigermaßen zurecht.«
Ida war überrascht, wie offen Muriel über diese intime Angelegenheit sprach. »Ich interessiere mich für Ihre Arbeit mit den Armen«, sagte sie spontan. »Darf ich einmal mitkommen und mir anschauen, was Sie und Ihre Schwestern machen?«
Die drei anderen sahen sie an, worauf Ida einen Schluck Tee trank, um ihre Verlegenheit zu verbergen. Er war heiß und süß und wärmte sie von innen. »Ich … ich wollte mich nicht aufdrängen.«
Grace legte ihr die Hand auf den Arm. »Unsinn, das tust du nicht. Aber ich möchte dir eigentlich zuerst die schönen Seiten von Dublin zeigen.«
»Natürlich will ich die sehen, aber ich bin auf alles neugierig. Seit du mir damals in London erzählt hast, in Irland sei nichts einfach und nur schwarz oder weiß, wollte ich immer herkommen und es mit eigenen Augen sehen.« Sie suchte nach den richtigen Worten. »Daheim bin ich immer noch Ida, die Tochter von Kaufmann Martens aus Rotherbaum. Dass ich Bilder male und sogar verkaufe, interessiert dort niemand.« Plötzlich war sie verlegen, weil sie diese Menschen erst seit einer halben Stunde kannte und nun so unvermittelt mit ihrer persönlichen Geschichte herausplatzte. »Ich mache hier nicht nur Ferien«, fügte sie hinzu, als wäre damit alles gesagt. Dann schaute sie auf ihren Teller, weil sie nicht wagte, den anderen in die Augen zu sehen.
Doch als jemand in die Hände klatschte, blickte sie abrupt hoch. Thomas MacDonagh applaudierte, und in seinen Augen las sie Respekt. »Bravo, Miss Martens, das nenne ich ein offenes Wort am Frühstückstisch.«
Muriel nickte zustimmend. »Ich freue mich über Ihr Interesse. Wir nehmen Sie gern einmal zur Schulspeisung mit.«
Die vier schauten einander erleichtert an. Ida wusste jetzt, was Grace gemeint hatte, als sie mit solcher Wärme über ihren Schwager sprach, und nahm noch einmal allen Mut zusammen. »Miss Martens klingt so förmlich. Nennen Sie mich bitte Ida.«
Als es klingelte, stand MacDonagh auf und ging zur Tür. Aus dem Hausflur hörte Ida die Stimmen ihres Gastgebers und eines anderen Mannes, konnte aber nicht verstehen, was gesagt wurde.
Muriel sah ihre Schwester fragend an und wollte schon vom Tisch aufstehen. »Ich glaube, das ist Dr. O’Connor. Vielleicht will er zu mir.«
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür, und MacDonagh schob einen großen, unordentlich gekleideten Mann ins Zimmer, der kurz in die Runde schaute und offenkundig auf dem Absatz kehrtmachen wollte.
»Nein, nein, lassen Sie, ich komme später wieder. Sie haben Besuch.«
Muriel zog den Mann leicht am Ärmel, worauf er sie überrascht ansah.
»Was gibt es, Dr. O’Connor? Trinken Sie wenigstens eine Tasse Tee mit uns. Es ist so kalt heute Morgen.«
Der Besucher, der keinen Hut trug und den Schal nur nachlässig um den Hals gewickelt hatte, schob sich die Haare aus dem Gesicht. Ida bemerkte, dass sie eine auffällige Farbe hatten. Nicht das leuchtende Rot vieler Iren, sondern ein dunkles Rotbraun, wie von Herbstlaub.
»Keine Zeit, Mrs. MacDonagh. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass in der St. Anthony School die Masern ausgebrochen sind. Daher wird dort bis auf Weiteres kein Schulessen ausgegeben.«
Muriel sah ihn entsetzt an. »Aber die Kinder verlassen sich auf uns!«
»Die Schule wird geschlossen, bis die Krankheit eingedämmt ist.«
»Muss denn tatsächlich gleich die ganze Schule geschlossen werden? Dann bekommen die Gesunden ja auch kein Essen«, sagte Grace besorgt, worauf der Mann ungeduldig die Augen verdrehte.
»Ja, natürlich. Wer die Krankheit in sich trägt, steckt die anderen an, die schleppen sie in die Familien, infizieren alle, der Vater nimmt sie mit zur Arbeit und so weiter und so fort. Sie wollen doch nicht schuld an einer Epidemie sein.« Mit diesen Worten griff er nach der Türklinke.
Ida schaute den Arzt verwundert an. Er verhielt sich schroff und unhöflich, verströmte jedoch eine Energie, die etwas durchaus Anziehendes besaß. Jedenfalls schien er mit den freundlichen MacDonaghs gut bekannt zu sein.
»Wirklich kein Tee?«, fragte Thomas, doch der Arzt schüttelte den Kopf.
»Danke, aber ich muss meine Runde machen.« Er nickte knapp und war verschwunden, bevor ihn die MacDonaghs hinausbegleiten konnten.
Als alle wieder am Tisch saßen, goss Muriel Tee nach und sah Ida entschuldigend an. »Er ist in Wahrheit gar nicht so schlimm.«
Als Ida und Grace sich verabschiedet hatten und zur Straßenbahnhaltestelle gingen, schwiegen sie eine Weile. Ida spürte, dass die Freundin ihr Zeit lassen wollte, die vielen Informationen zu verarbeiten, die in so kurzer Zeit auf sie eingeprasselt waren. Gemeinsam zu schweigen, ohne sich unbehaglich zu fühlen, war ein Zeichen echter Freundschaft.
»Danke«, sagte Ida schließlich, als die Haltestelle in Sicht kam. Dort warteten schon einige Leute, darunter eine Frau mit einem großen Korb und drei alte Männer, von denen einer keinen einzigen Zahn mehr im Mund hatte und eher an seinem Pfeifenstiel lutschte, als darauf kaute.
»Wofür?«
»Dass du mich in Ruhe nachdenken lässt.«
Grace lehnte sich gegen einen Laternenpfahl und lachte leise. »Wenn ich in meiner Familie eines gelernt habe, dann, wann ich reden und wann ich schweigen muss.«
»Ich glaube, ich habe diesen Joe Plunkett vorhin durchs Fenster gesehen. Kennst du ihn auch?«
»Ich bin ihm nie begegnet, habe aber viel von ihm gehört. Kein Wunder, wenn man mit MacDonagh verwandt ist, die beiden stecken dauernd zusammen. Joe hat bei ihm Gälisch gelernt.«
»Und der Arzt?«, fragte Ida zögernd.
»Ziemlich schroff, was eigentlich nicht die irische Art ist. Aber …« Sie sprach nicht weiter, weil die Straßenbahn heranratterte und klingelnd vor ihnen anhielt. Sie stiegen nach der Frau mit dem Riesenkorb und den drei alten Männern ein, die sich ganz nach hinten setzten und ihre Pfeifen anzündeten.
»Aber was?«, fragte Ida nach, als sie einen Platz gefunden hatten.
»Dr. O’Connor ist nicht übel. Er hat eine Praxis in Sandymount, macht aber zweimal in der Woche eine Runde durch die Armenviertel.«
»Meinte er das vorhin?«
Grace nickte. »Dafür schließt er jeden Dienstag und Donnerstag die Praxis. Seine wohlhabenderen Patienten müssen sich damit abfinden.« Sie lachte. »Ich habe mal eine Geschichte über ihn gehört, und so wie ich ihn kenne, stimmt sie auch. An einem Mittwoch kam eine Patientin in die Praxis und beschwerte sich, sie habe am Vortag vor verschlossener Tür gestanden, obwohl ihr Ischias sie furchtbar quälte. O’Connor schaute sie lange an und sagte: ›Madam, wenn Sie es heute noch einmal hierhergeschafft haben, kann es nicht allzu schlimm gewesen sein.‹ Die Frau lief rot an und erklärte, sie werde allen, die es wissen wollten, erzählen, was für ein impertinenter und arroganter Kerl er sei, den zu konsultieren man tunlichst vermeiden solle. Worauf er erwiderte: ›Bitte verzeihen Sie, dass ein medizinisch bedeutsamer Fall wie der Ihre vor drei Kindern mit Rachitis, einer Totgeburt in einer verschimmelten Wohnung und einem offenen Beinbruch zurückstehen musste.‹«
Ida sah Grace überrascht an. »Das hat er wirklich gesagt?«
»Ich war nicht dabei. Aber ich kann es mir lebhaft vorstellen – du hast ihn ja gesehen.«
Sie hatten sich ein Café in der belebten Sackville Street gesucht, in dem sie eine Kleinigkeit essen konnten, nachdem Grace ihre Freundin von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten geschleppt hatte. Ida war begeistert. Die Stadt gefiel ihr sehr. Dublin war kleiner als Hamburg und viel kleiner als London und somit ein Ort, den man mit der Zeit sicher so gut kennenlernte konnte, dass er einem ganz und gar vertraut wurde.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte Grace leise.
Ida lachte. »Natürlich. Ich dachte gerade, wie gut es mir gefällt, dass Dublin keine so große Stadt ist. Und dann kam mir der Gedanke, dass ich sie gern richtig gut kennenlernen würde, nicht nur die schönen Seiten, die du mir gezeigt hast, sondern alles, bis in den kleinsten Winkel.«
Grace wirkte plötzlich ernst. Ida meinte, sogar eine leichte Röte auf ihren Wangen zu sehen. »Tut mir leid, dass ich dich so gehetzt habe, aber … ich hatte Sorge, dass es dir nicht gefällt. Dublin kam mir auf einmal so klein und unbedeutend vor. Ich bin hier geboren und habe mich an all das gewöhnt, aber Dublin ist immer noch der Hinterhof des Empire.«
Ida beugte sich vor und legte Grace die Hand auf den Arm. »Was soll der Unsinn? Es waren doch gerade deine Erzählungen, die mich neugierig gemacht haben, und du hast mir nie ein zweites London versprochen. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Und ich habe mir etwas überlegt: Ich würde gern länger bleiben und möchte die Gastfreundschaft deiner Eltern nicht über Gebühr beanspruchen. Vielleicht sehe ich mich nach einer Unterkunft um, einem eigenen Zimmer, in dem ich malen und Gäste empfangen kann. Und dann werde ich schauen, wie lange mein Geld reicht.« Den letzten Satz sagte sie so unbekümmert, dass sie Grace zum Lachen brachte und die Sorge aus ihrem rundlichen Gesicht vertrieb.
Ida versuchte, den leichten Ton zu wahren. »Du hast mir vom Theater vorgeschwärmt. Und von der interessanten Gräfin.«
»Ja, Constance Markievicz. Ich werde dich ihr so bald wie möglich vorstellen. Und was das Theater angeht – MacDonaghs neues Stück wird demnächst im Theatre of Ireland aufgeführt, wir können zu den Proben gehen.« Graces Gesicht begann zu leuchten.
Ida war erleichtert. »Ja zu allem. Und würdest du mir bei der Suche nach einem Zimmer helfen? Natürlich möchte ich deinen Eltern gegenüber nicht unhöflich sein. Ich werde nicht sofort ausziehen, aber es wäre schön, für die Zukunft etwas zu haben.«
»Ich habe eine Idee. Ein Bekannter von John hat einen Tabakladen ganz in der Nähe. Er kennt Gott und die Welt, da können wir mal fragen.« Sie lächelte. »Ich tue doch alles, damit du mir erhalten bleibst.«
Sie gingen die Sackville Street entlang. Ida war nervös, weil sie nicht damit gerechnet hatte, dass ihr Plan so schnell Gestalt annehmen könnte, doch sie ließ sich vom Klappern der Pferdehufe und dem Klingeln der Straßenbahnen ablenken. Die breite Sackville Street war die Hauptstraße von Dublin und wurde an einem Ende von der gewaltigen Säule mit der Statue von Daniel O’Connell beherrscht, über den Grace ihr viel erzählt, von dem Ida jedoch nur wenig behalten hatte.
Sie bogen nach links ab. Grace blieb vor einem kleinen Laden stehen, in dessen Schaufenster Tabakwaren ausgestellt waren. Draußen auf dem Gehweg standen Werbetafeln für Zeitungen, die ebenfalls drinnen verkauft wurden. Die Titel klangen politisch, die Begriffe »Irland« und »Freiheit« tauchten mehrfach auf.
»Ich erkläre es dir später«, sagte Grace und trat an die Theke, hinter der ein hagerer, grauhaariger Mann mit dickem Schnurrbart Zigarettenpäckchen in ein Regal sortierte. Es roch nach Papier und Tabak, und Ida spürte etwas, das sie nicht genau benennen konnte – eine Wärme, als würde man sie hier willkommen heißen.
Der Mann blickte auf und lächelte verhalten, als er Grace vor sich stehen sah. »Guten Tag, Miss Gifford. Was kann ich für Sie tun?« In seiner Stimme schwang ein leichter amerikanischer Akzent mit.
Grace räusperte sich. »Mr. Clarke, ich habe eine Bitte. Dies ist meine Freundin Miss Martens. Sie ist zu Besuch in Dublin und sucht ein Zimmer oder eine kleine Wohnung. Bei Ihnen gehen so viele Leute ein und aus, da dachte ich mir …«
Sie verstummte, als der Ladenbesitzer an ihr vorbei zur Tür schaute. Ein junger Mann, der am Stock ging, hinkte in den Laden und grüßte die beiden Frauen freundlich, bevor er an die Theke trat.
»Ist es da, Tom?«, fragte er ohne Vorrede, worauf Clarke sich bückte und ein Päckchen unter dem Tresen hervorholte.
»Bis bald, Séan«, sagte er nur.
Der junge Mann wollte schon gehen, blieb dann aber vor Grace stehen und sah sie fragend an. »Ich möchte nicht aufdringlich sein, aber wenn mich nicht alles täuscht, sind Sie eine Schwester von John Brennan.«
»Das stimmt. Ich heiße Grace Gifford.«
»Dann richten Sie John bitte Grüße von Séan Mac Diarmada aus. Sie soll sich mit dem Artikel beeilen, und wenn sie Nachtschichten in der Bibliothek einlegt. Die Bewegung zählt auf sie.« Er tippte sich an den Hut, lächelte Ida zu und hinkte zur Tür hinaus.
Sie schauten einander an, und Ida musste lachen, als sie Graces zerknirschten Blick bemerkte. »Das habe ich inzwischen verstanden – Dublin ist ein Dorf.«
»Meine Damen«, ließ sich Mr. Clarke vernehmen, »mein junger Freund ist gewiss charmant, aber wir können nun gern wieder zu Ihrem Anliegen kommen …«
Ida beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. »Wie Miss Gifford schon sagte, suche ich ein Zimmer oder eine kleine Wohnung, nicht zu teuer und mit gutem Licht.«
Clarke zog eine Augenbraue hoch. »Das suchen viele.«
Sie schluckte, erwiderte aber mit fester Stimme: »Ich bin Malerin.«
»Ach so.« Er musterte sie nachdenklich. »Ich schreibe es mir auf. Wo kann ich Sie erreichen?«
Ida nannte die Adresse der Giffords, die er sich notierte, ehe er den Zettel an ein Brett hinter der Theke hängte.
»Sie ziehen allein dort ein?«, fragte er in einem Ton, der frei von jeder Neugier war.
»Ja. Und noch etwas – die Unterkunft sollte möbliert sein.«
Er nickte. »Ich sehe, was sich machen lässt.«
Draußen auf der Straße blickte Ida ihre Freundin an. »Er hat etwas, wie soll ich sagen – Besonderes. Würdevoll wirkt er. Ist er wirklich ein einfacher Ladenbesitzer?«
Grace zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nur, dass sein Laden eine Art Poststelle für politische Organisationen ist. Du kannst davon ausgehen, dass der gut aussehende Mr. Mac Diarmada keinen Pfeifentabak abgeholt hat.«
ENDE DER LESEPROBE