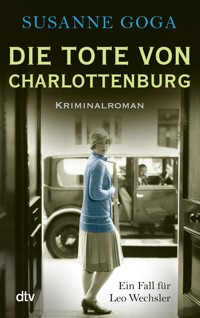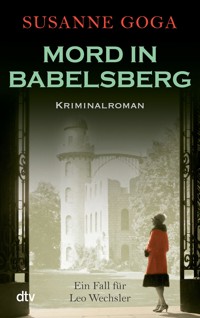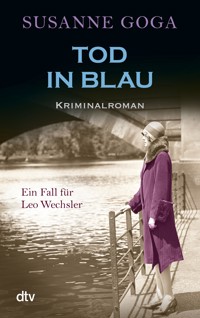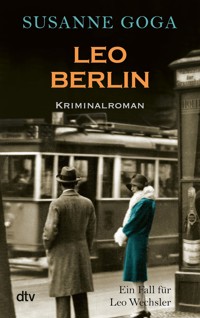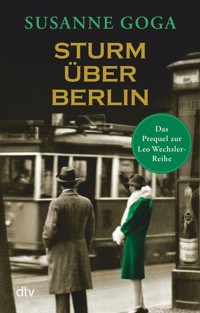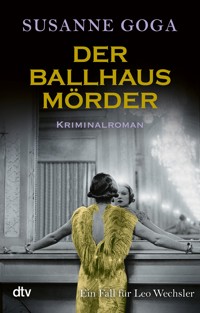9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Krimi
- Serie: Leo Wechsler
- Sprache: Deutsch
Der fünfte Fall für Leo Wechsler Berlin 1927. Bei einer Modenschau im Romanischen Café werden zwei Vorführdamen verletzt: Ihre Kleider wurden mit einem Kontaktgift präpariert. Offenbar ein gezielter Anschlag gegen den Modesalon Morgenstern & Fink, den aufsteigenden Stern am Berliner Modehimmel. Kurz darauf wird in Schöneberg ein Toter gefunden. In seiner Wohnung entdeckt man einen Prospekt des Modesalons ... Leo Wechsler, inzwischen Oberkommissar bei der Berliner Kripo, nimmt die Ermittlungen auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Susanne Goga
Es geschah in Schöneberg
Kriminalroman
dtv
Für die ersten Leserinnen –
Angelika, Rebecca und Sabine
Prolog
Leo Wechsler blickte von seiner Akte auf, als jemand in die Hände klatschte. Sein Kollege Robert Walther stand im Türrahmen, eine Zeitung unter dem Arm, und applaudierte grinsend. »Der Witwenretter vom Alex – Leo, du hast einen neuen Ehrentitel!«
Er warf seinem Freund die Zeitung hin, doch Leo winkte ab. »Danke, damit hat Clara mich schon geärgert. Ob sie jetzt eifersüchtig werden müsse?«
»Sie dachte wohl eher an einen Witwentröster«, feixte Walther und ließ sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch fallen. »Aber mal im Ernst, das war gute Arbeit.«
»Nicht meine allein«, sagte Leo und schlug die Akte zu.
»Das nicht, aber du hattest die entscheidende Idee.«
Vier Frauen, die einander nicht kannten und in unterschiedlichen Gegenden wohnten, alle verwitwet und wohlhabend. Und alle vier waren beraubt und in ihrer Wohnung erschlagen worden.
Die Presse hatte mächtig Druck gemacht, weil es sich offenkundig um einen Serientäter handelte, der sich den Zugang zu den Wohnungen der Frauen erschlich. Weder Fenster noch Türen wiesen Einbruchsspuren auf. Ältere alleinstehende Damen wurden von Polizei und Presse aufgefordert, Unbekannten entweder gar nicht oder nur bei vorgelegter Kette die Tür zu öffnen. Es gab keine weiteren Vorfälle, doch damit war die Gefahr nicht aus der Welt.
Leo hatte seine Kommission eine Liste von Personen zusammenstellen lassen, die für eine solche Tat in Frage kamen: Handwerker, Dienstboten, Kohlenhändler, Ärzte, selbst vor Pfarrern hatten sie nicht Halt gemacht, was für einige Aufregung gesorgt hatte.
»Wenn du nicht gesagt hättest, es müsse jemand sein, der schwer zu fassen ist, auf den niemand achtet, der vielleicht keinen festen Wohnsitz hat, wären wir Bartels nicht auf die Spur gekommen.«
Peter Bartels war Hausierer und lebte in leerstehenden Häusern, bis man ihn von dort vertrieb. Gelegentlich kampierte er auch in Unterführungen und Wartesälen, doch es war ihm gelungen, dabei eine gepflegte Erscheinung zu wahren. Immer sauber, die Haare ordentlich geschnitten und frisiert, nicht mit einem schäbigen Bauchladen unterwegs, sondern mit einer Ledertasche, in der er seine Kollektion aufbewahrte. Er trug sogar Visitenkarten mit Wellenrand bei sich, auf denen er sich als Peter Bartels, Reisender in feinen Kurzwaren vorstellte.
Es klopfte. Auf Leos »Herein« trat sein Chef Ernst Gennat ein. Walther stand sofort auf und bot dem schwergewichtigen Kriminalrat seinen Stuhl an. Nachdem sich dieser ächzend niedergelassen hatte, wollte Walther zur Tür gehen, doch Gennat winkte ab.
»Sie können ruhig hören, wie ich Ihren Chef belobige. Sind ja nicht ganz unbeteiligt am Erfolg.« Er lehnte sich zurück und schaute zu Leo. »Gute Arbeit, das mit Bartels. Wie man mir sagte, war es nicht nur Ihre Idee, dass der Täter Hausierer sein könnte, Sie haben auch die Nachbarn nach sprachlichen Eigenheiten gefragt.«
»Nun ja, laut einer Zeugin hatte der Mann einen Sprachfehler. Also haben wir uns das noch einmal ganz genau beschreiben lassen.«
Walther lachte. »Gude Taach, gnädische Fraa. Ick frage Ihnen, wer redet denn so?«
»Ein Frankfurter«, sagte Leo. »Das fällt in Berlin anscheinend unter ›Sprachfehler‹.«
Daraufhin hatten sie eine Fahndung ausgelöst und einen entscheidenden Hinweis auf Peter Bartels erhalten. Bei seiner dramatischen Flucht war der Hausierer aus dem zweiten Stock eines leerstehenden Hauses gesprungen und hatte sich mit gebrochenem Knöchel noch einige hundert Meter weit geschleppt, bevor sie ihn stellen konnten.
Bei der Befragung war er zusammengebrochen und hatte seine Verstecke genannt, in denen die Beamten einen Teil der Beute fanden. Den Rest hatte er bereits verkauft.
Vierfacher Mord aus Habgier – er musste mit der Todesstrafe rechnen.
»Jedenfalls haben Sie ausgezeichnete Arbeit geleistet, Herr Wechsler. Und darum habe ich zwei Nachrichten, eine gute und eine zweite, die Sie weniger freuen wird.«
Leo rieb sich nachdenklich das Kinn. »Fangen Sie bitte mit der schlechten an.«
Gennat grinste und deutete auf Walther, der neben ihm stand. »Da Sie alle diesen Fall so vorbildlich gelöst haben und zurzeit nichts Großes ansteht, wird Herr Walther für einige Wochen in die Inspektion B versetzt. Dort sind einige Kollegen an Grippe erkrankt, die anderen ersticken in Arbeit.«
Leo und Walther sahen einander an. Sie verstanden sich ohne Worte.
»Ja, Herr Kriminalrat, gewiss«, sagte Walther. »Du kommst sicher ein paar Wochen ohne mich zurecht, Leo.«
»Das erwarte ich auch von einem Oberkommissar«, sagte Gennat und ging mit schweren Schritten zur Tür. »Das war übrigens die gute Nachricht, meine Herren.«
1
10. Januar 1927
Wer heute in Berlin in die Zukunft schauen will, geht nicht zum Hellseher, sondern blickt nach Westen. In wenigen Jahren ist rund um den Kurfürstendamm ein zweites Zentrum entstanden, und wer im Osten Rang und Namen hat, eröffnet eine Dependance drüben in Berlin W. Dies ist auch der Ort für aufstrebende neue Modeateliers. Und unter ihnen sollte man sich einen Namen merken: Morgenstern & Fink.
Lotte Morgenstern ist ein frischer Wind im ohnehin wilden Westen. Ihre Spezialität ist Kleidung für die Frau von heute – elegant, aber ohne Schnörkel, sportlich, aber nur aus den besten Materialien.
Vor vier Jahren hat sie ihr eigenes Atelier am Kurfürstendamm eröffnet, doch richtig Schwung kam in die Sache, als sie den bekannten Modeschöpfer Carl Fink für sich gewinnen konnte.
Er hat sich einen Namen gemacht, als er den sogenannten »Fink-Rücken« erfand. Niemand gestaltet die Rückenausschnitte eleganter Abendroben hinreißender als er – Höhepunkt der letzten Kollektion war ein Kleid, über dessen Rücken sich eine Goldkette mit edelsteinbesetztem Vorhängeschloss spannte.
Fink hat lange am Hausvogteiplatz gearbeitet, und so können wir sagen, dass sich hier eine gelungene Verbindung von Ost und West, von männlichem und weiblichem Modeverständnis ergeben hat. (Und auch eine eheliche Verbindung, wie wir im vergangenen Jahr berichten konnten.)
Robert Walther faltete die Berliner Illustrirte zusammen, als sie am Zoo ausstiegen. Überall drängten Menschen zur Arbeit, rempelten einander an, in der Luft lag der Duft von hundert Parfüms und Rasierwässern, der sich mit den Schwaden vom Bratwurststand vor dem Bahnhof vermischten.
Sie gingen zu Fuß weiter in die Hardenbergstraße. Walther kam das ganze Tempo dieser Ermittlung sehr gemächlich vor, so etwas war er von Einsätzen bei Mordermittlungen nicht gewöhnt. Vor allem nicht, seit die Inspektion A im vergangenen Herbst ihren speziell gefertigten Einsatzwagen erhalten hatte, den die Presse rasch »Mordauto« getauft hatte. Ernst Gennat hatte das bahnbrechende Fahrzeug entworfen, das ein Büro und eine vollständige Ausrüstung zur Spurensicherung enthielt und Aufsehen erregte, wann immer die Kripo damit vorfuhr.
Ranke sah den Kollegen von der Seite an. »Schauen Sie nicht so, Walther, Sie dürfen bald wieder in die Inspektion A.«
Walther grinste verlegen. »Tut mir leid. Merkt man mir das so sehr an?«
»Ach was, so ist das eben, wenn man vorübergehend vom Olymp herabsteigt.«
Die Umstellung fiel Walther schwer, und er zählte die Tage, bis er wieder in die vertraute Umgebung zurückkehren konnte. Seine Freundin Jenny, die als Blumenverkäuferin arbeitete und auf eine Karriere als Sängerin hoffte, hatte ihn schon damit aufgezogen und gedroht, ein Lied über seinen Abstieg innerhalb der Kripo zu verfassen.
Ranke zeigte auf die gegenüberliegende Straßenseite. »Sehen Sie mal, schon für heute Abend.«
Nun bemerkte auch Walther die Arbeiter, die Absperrungen vor dem Ufa-Palast aufstellten. An der Fassade prangte in riesigen Lettern das Wort »Metropolis«, darunter, ähnlich groß, »Ein Film von Fritz Lang«, rechts und links eingerahmt vom charakteristischen Symbol der UFA.
»Oh, den will ich mir ansehen«, sagte er. »Letztes Jahr haben wir den Mordfall Viktor König bearbeitet. Seit König tot ist, ist Lang wieder Alleinherrscher des deutschen Films.«
Ranke zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht – wenn der Film sein Geld wert ist, müsste er schon ein Meisterwerk sein. Fünf Millionen Mark, stellen Sie sich das vor! Der teuerste Film, der je in Deutschland gedreht wurde.«
Als sie sich dem Kurfürstendamm näherten, kam Walther auf den Grund ihres Einsatzes zu sprechen. »Was genau ist bei Morgenstern passiert?«
»Komische Sache. Die Chefin ist heute Morgen ins Atelier gekommen und hatte sofort das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Keine Anzeichen von Gewalt an der Tür, kein Vandalismus, auf den ersten Blick nichts gestohlen.«
»Aber?«
»Sie sagt, die Atmosphäre sei anders gewesen.« Walther bemerkte Rankes leicht verächtlichen Ton. »Einige Entwürfe hätten nicht so gelegen wie zuvor. Entwürfe für die neue Kollektion.«
»Werksspionage?«, fragte Walther interessiert. Seltsam, genau das, was den Kollegen zu belustigen schien, ließ ihn die Angelegenheit ernster nehmen.
»Ich weiß nicht. Es klang alles sehr vage. Sie wissen schon, künstlerisch veranlagte Frauen neigen gelegentlich zur Hysterie …«
Walther schaute ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an, verkniff sich aber eine Antwort. Ranke wäre ein handfester Einbruch mit aufgestemmter Tür und herausgerissenem Safe vermutlich lieber gewesen. Er selbst hingegen war dankbar, wenn er sich die Zeit fern der Mordinspektion mit etwas Ausgefallenem vertreiben konnte.
»Die Presse berichtet lobend über Frau Morgenstern«, sagte er beiläufig.
»Ihr Modegeschmack ist sicher über jeden Zweifel erhaben. Aber ob wir es mit einem Verbrechen zu tun haben, wird sich noch zeigen.«
Sie betraten den Kurfürstendamm, der selbst am Vormittag von Menschen wimmelte. Die Theater und Kinos waren noch geschlossen, dafür drängte sich alles in den Cafés und Geschäften.
Walther kam privat nicht oft in diese Gegend, da viele der Vergnügungsstätten für einen Kriminalbeamten unerschwinglich waren. Vor ein paar Wochen war er mit Jenny im nahe gelegenen Lunapark gewesen, wo sie sich prächtig amüsiert hatten, obwohl der Park seine beste Zeit hinter sich hatte. Der Teddybär, den er für Jenny geschossen hatte, thronte seither auf einem Ehrenplatz in ihrem Wohnzimmer.
»Hier ist es.« Ranke war vor einem Ladenlokal mit zwei großen Schaufenstern stehengeblieben. Der Schriftzug Morgenstern & Fink über der Tür war in dezentem Gold gehalten, die Schaufensterpuppen waren aufwändig gestaltet, lenkten aber nicht von den Kleidern ab. Im rechten Fenster waren sportliche Ensembles ausgestellt, im linken herrliche Abendroben aus Seide und Brokat. In jedem Fenster stand ein Würfel aus transparentem Kunststoff, der mit den Unterschriften von Carl Fink und Lotte Morgenstern versehen war.
Die Modelle würden Jenny gefallen, dachte Walther flüchtig, doch sie überstiegen seine Möglichkeiten bei weitem. Wenn ihre Karriere als Sängerin an Schwung gewann, dann vielleicht …
Sie traten durch die Tür mit dem schönen Griff aus schwarzem, golden eingefasstem Bakelit.
Eine junge Frau kam ihnen entgegen. »Verzeihung, aber wir haben noch nicht geöffnet.«
Walther und Ranke wiesen sich aus.
»Kommen Sie bitte mit, ich führe Sie zu Frau Morgenstern.«
Walther versuchte, so viel wie möglich von den Räumen aufzunehmen – die Standspiegel, Paravents und Polstersessel, die zum Verweilen einluden. Modeillustrierte auf kleinen Tischen. Große Bodenvasen. Keine Bilder an den Wänden, nur Spiegel und vereinzelte gerahmte Modezeichnungen. Räume, in denen man sich wohlfühlen konnte und die gleichzeitig eine absolute Konzentration auf das Wesentliche erlaubten – auf die Kleider sowie die Kundinnen und ihre Wünsche.
Sein Blick fiel auf eine Schaufensterpuppe, die mit dem Rücken zum Betrachter stand. Sie trug ein dunkelgrünes Abendkleid mit einem tiefen Rückenausschnitt, über den sich Girlanden aus vergoldeten Efeublättern rankten. Ein »Fink-Rücken«, wie er nach der Lektüre in der Bahn jetzt wusste.
Lotte Morgenstern trug einen exakt geschnittenen Pagenkopf. Ihr dunkles Haar glänzte wie Lack, und sie wirkte auf den ersten Blick kühl und distanziert. Ihre grünen Augen blickten forschend, aber nicht unfreundlich, und als sich ihr Mund zu einem Lächeln verzog, trat eine unerwartete Wärme in ihre Züge. Sie trug ein weinrotes Kleid, dessen einziger Schmuck eine schwarze Knopfleiste war, die an ein Herrenhemd erinnerte.
»Danke, dass Sie so rasch gekommen sind.«
»Bitte erzählen Sie uns genau, was Ihren Verdacht geweckt hat, Frau Morgenstern«, sagte Ranke.
Walther holte sein Notizbuch heraus, um mitzustenographieren. Ihm fiel die Ruhe auf, die in den Räumen herrschte. Es war kaum zu glauben, dass das Modeatelier an einer der hektischsten Straßen Berlins lag, doch die dicken Teppiche und die Vorhänge, die die Räume geschickt unterteilten, schienen darauf angelegt, die Kundinnen von der Außenwelt abzuschirmen.
Lotte Morgenstern führte sie in einen großen, hellen Raum, dessen Fenster auf einen Innenhof hinausgingen. »Das Entwurfszimmer«, sagte sie. »Der hellste Raum. Wir brauchen viel Licht.«
Große Tische mit Zeichenutensilien, Regale voller Stoffmuster, zwei Schneiderpuppen, Modefotos aus Illustrierten an den Wänden, aufgeschlagene kostümgeschichtliche Bildbände.
»Wo sind Ihre Mitarbeiter?«, erkundigte sich Walther.
»Im Pausenraum. Ich war heute Morgen als Erste hier und wollte Ihnen den Raum so zeigen, wie ich ihn vorgefunden habe.«
»Danke, das war umsichtig von Ihnen. Oft werden Tatorte verändert, das erschwert uns die Arbeit«, sagte Ranke. »Daher bin ich Ihnen sehr dankbar. Kommen Sie, Walther, schauen wir uns um.«
An diesem Abend saßen Leo Wechsler und Robert Walther in der Kneipe Ecke Turmstraße und Emdener Straße, in der Nähe von Leos Wohnung. Da sie zurzeit nicht zusammenarbeiteten, trafen sie sich alle paar Tage auf ein Bier und hielten einander auf dem Laufenden. Die Kneipe war gut besucht, der Boden blitzsauber und mit Sand bestreut.
Leo gab dem Wirt Gustav einen Wink, noch eine Runde Weiße zu bringen. Zu Walther gewandt, sagte er: »Clara kommt spät nach Hause. Sie hält einen Vortrag.«
»Einen Vortrag?«
»Über neue amerikanische Literatur.« Leo konnte den Stolz in seiner Stimme nicht verbergen. »Sie kennt einen Professor von der Universität, der seine Studenten zu ihr schickt, damit sie englische Bücher bei ihr kaufen. Über ihn hat sie Verbindung zu einem Arbeiterbildungswerk bekommen und spricht dort gelegentlich über Literatur. Sie zahlen nicht viel, aber Clara hat großen Spaß daran.«
Walther pfiff leise vor sich hin. »Deine kluge Frau …«
»Oh, ja«, meinte Leo lächelnd.
»Verliebt wie am ersten Tag. Wenn ich dran denke, wie ihr damals umeinander rumgeschlichen seid …«
Leo boxte ihm freundschaftlich gegen den Oberarm, dass das Bier in Walthers Glas gefährlich schwappte. »Wie war’s bei Morgenstern & Fink? Schon was für Jenny ausgesucht?«
Walther wischte sich mit dem Handrücken über den Mund und schüttelte den Kopf. »Frag mich das, wenn ich in der Lotterie gewonnen habe. Aber mal im Ernst, die Kleider sind erstklassig. Da wäre so einiges dabei, in dem ich Jenny gerne sehen würde.«
»Und der Fall?«, fragte Leo.
»Sofern es einer ist.« Er schilderte Leo die Umstände. »Wenn überhaupt, dann ist es kein klassischer Einbruch, sondern ein Fall von Werksspionage«, schloss er.
»Hat die Inhaberin einen Verdacht geäußert?«
»Nein«, sagte Walther und stippte seine Bulette in den Senf. »Und solange es keine Verdachtsmomente gibt, haben wir nichts in der Hand. Trotzdem hat mich Frau Morgenstern völlig überzeugt. Sie macht nicht den Eindruck, als bildete sie sich Dinge ein. Eine vernünftige Frau, klarer Verstand, präzise Ausdrucksweise. Aber ohne Spuren kommen wir nicht weiter.«
»Und ihr Kompagnon? Was sagt der dazu?«
»Carl Fink haben wir nicht angetroffen. Geschäftstermin.« Walther seufzte. »Du glaubst nicht, wie sehr ich mich darauf freue, wieder zu euch zu kommen. Ich weiß, einer musste es machen, aber ich habe einfach keinen Spaß mehr an Einbrüchen. Die Arbeit mit dir hat mich ein für alle Mal verdorben.«
Leo lachte und stellte sein Bierglas ab, bevor er dem Wirt erneut winkte. »Gustav, noch zwei Weiße für den Herrn vom Einbruchsdezernat und meine Wenigkeit.« Sie stießen miteinander an. »Ach, es gibt gute Neuigkeiten – Sonnenschein wird Vater.«
»Oh, das freut mich! Das macht sein Glück komplett.« Ihr Kollege hatte im September geheiratet. Es war eine rauschende Hochzeit gewesen, bei der sie bis in den frühen Morgen gefeiert hatten.
Leo sah ihn an. »Ich weiß, du kommst mir gleich wieder mit dem Vorwurf, dass ich immer etwas zu unken habe, dabei freue ich mich ja auch für ihn. Aber wenn ich mir die Beamtengehälter so ansehe … da wird es mit einer Familie eng.«
»Nein«, sagte Walther ernst, »da gebe ich dir recht. Die Politiker erzählen zwar, es sei uns nie so gut gegangen …«
»… was in vieler Hinsicht auch stimmt«, warf Leo ein.
»Aber die verdienen auch mehr als ein mittlerer Beamter.«
»Sehr richtig«, sagte Leo und hob sein Glas. »Na ja, trotzdem – denk mal an die Zeiten, die wir durchgemacht haben. Vor vier Jahren sind wir im wertlosen Geld ersoffen, und es sah aus, als würde Deutschland nie mehr auf die Beine kommen. Seither hat sich viel getan. Darum trinken wir auf die Zukunft, Robert!«
Sein Freund sah ihn überrascht an. »Mir scheint, du hast endlich von mir gelernt. Ein bisschen Optimismus kann nicht schaden.« Er stieß mit ihm an. »Auf die Zukunft.«
»Bist du dir ganz sicher, dass sich jemand an den Entwürfen zu schaffen gemacht hat?«, fragte Carl und setzte sich neben Lotte aufs Sofa.
Sie schaute nachdenklich in ihr Weinglas, als könnte sie darin die Antwort finden, und zuckte mit den Schultern. »Ich kann es nicht beweisen, aber es kommt mir vor, als hätte jemand darin herumgestöbert und sich große Mühe gegeben, sie genau so wieder hinzulegen, wie sie waren. Und ich hatte einen Notizzettel in eine Mappe getan, der lag am nächsten Morgen auf dem Boden.«
»Hast du der Polizei davon erzählt?« Er rutschte auf dem Sofa hinunter, bis sein Kopf auf der Lehne ruhte.
»Natürlich. Sie waren sehr freundlich, aber auch skeptisch. Ich kam mir etwas dumm vor, als würde ich einen Aufstand wegen einer Bagatelle machen …«
Carl räusperte sich. »Hast du mal überlegt, ob es jemanden in der Firma gibt, dem du nicht trauen kannst?« Er hob die Hand, als sie heftig antworten wollte. »Ich verdächtige niemanden. Du kennst die Leute länger als ich. Aber wenn nichts auf einen Einbruch hindeutet und wirklich jemand die Entwürfe durchsucht hat, muss es eine Angestellte gewesen sein. Oder jemand hat seinen Schlüssel aus der Hand gegeben.« Seine blauen Augen betrachteten forschend ihr Gesicht, als fürchtete er, sie verletzt zu haben.
Sie schluckte und sah ihn dann frei heraus an. »Du hast ja recht, aber ich habe nichts in der Hand. Vielleicht wäre es besser, die Sache auf sich beruhen zu lassen, bis die neue Kollektion steht. Wenn ich vor der Frühjahrsmodenschau unsere Leute vergraule, können wir zumachen.« Carl stand auf und ging im Zimmer umher. Er blieb vor einem Sideboard stehen, auf dem eine kleine Marmorstatue stand, die er Lotte aus Italien mitgebracht hatte.
»Lass uns nach Paris fahren, wenn die Modenschau vorbei ist.«
Sie blickte überrascht auf und lächelte. »Ja, vielleicht sollten wir das wirklich tun.«
An der Ecke Beethovenstraße/In den Zelten Nr. 10, am Rande des Tiergartens, war seit acht Jahren das Institut für Sexualwissenschaft untergebracht. An diesem Morgen saß Dr. Hirschfeld, der Gründer und Leiter des Instituts, mit seinen Kollegen Dr. Franke und Rainer Vogt zusammen.
»Der Film muss durch die Zensur, das haben wir ja gewusst. Sollen sie ruhig ihren Senf dazugeben. Wir reichen ihn so lange ein, bis er genehmigt wird«, sagte Hirschfeld und nahm die kleine, runde Brille ab, um sie mit einem weichen Tuch zu polieren.
Rainer Vogt warf einen Blick auf das Schreiben der Film-Oberprüfstelle. »Sie verlangen, dass wir die Szene herausschneiden, in der mit einem Pinselstrich der Paragraph 175 beiseitegefegt wird. Das war immer eine meiner Lieblingsstellen«, fügte er leise hinzu.
Er erinnerte sich gut daran, wie er Anders als die Andern als junger Mann gesehen und sich zum ersten Mal verstanden und gewürdigt gefühlt hatte. Selbst als ein Trupp lärmender Soldaten durchs Lichtspielhaus gezogen war und Beleidigungen in Richtung Leinwand geschrien hatte, war er still sitzengeblieben und hatte beschlossen, den Film am nächsten Tag noch einmal anzusehen. Was er auch getan hatte, in der Elf-Uhr-Vorstellung, die bei weitem nicht so überfüllt war und in der niemand die Schöpfer des Films in Grund und Boden verdammt hatte.
»Wir sind darauf gefasst, Kompromisse einzugehen«, sagte Franke. »Es wäre schon ein Erfolg, den Film wieder in die Theater zu bekommen, selbst wenn wir die eine oder andere Szene streichen müssen.«
Hirschfeld wiegte den Kopf. »Gewiss. Es täte mir weh, die Szene herauszuschneiden, weil sie unser Anliegen so treffend verdeutlicht, aber der Tag wird kommen, an dem wir sie offen zeigen können.«
Franke sah ihn mit leisem Zweifel an. »Deinen Optimismus möchte ich haben.«
Hirschfeld lächelte nachsichtig. »Ich bin fast sechzig Jahre alt. Zu meinen Lebzeiten hat sich viel verändert, und wir stehen erst am Anfang. Wenn wir drei Schritte vor und zwei zurückgehen, gelangen wir dennoch irgendwann ans Ziel. Selbst wenn ich es nicht mehr miterlebe.« Er schaute Vogt an. »Die nach uns kommen, werden ihren Nutzen davon haben.«
»Soll ich die Stelle herausschneiden und den Film erneut einschicken?«, fragte Vogt.
Die beiden Männer nickten.
»Ich kann es nicht erwarten, ihn endlich wieder auf der Leinwand zu sehen«, sagte Hirschfeld. »Schade, dass Veidt nach Hollywood gegangen ist, sonst hätten wir ihn zur Premiere einladen können.«
Conrad Veidt hatte im Film den homosexuellen Geiger verkörpert, der einem tückischen Erpresser zum Opfer fällt. Im vergangenen Jahr war er nach Amerika gegangen, ein Abschied für immer, wie manche munkelten.
»Und Anita Berber ist schwerkrank, auf sie können wir auch nicht zählen«, sagte Vogt bedauernd. Es war kein Geheimnis, dass die berühmte Tänzerin, die im Film mitgespielt hatte, seit Jahren drogensüchtig war.
»Wir brauchen keine berühmten Gesichter, unser Werk spricht für sich«, sagte Franke selbstbewusst. »Wenn sonst nichts ansteht, gehe ich wieder an die Arbeit.« Er nickte den beiden Männern zu und verließ den Raum.
Hirschfeld schaute Vogt interessiert an. »Wann haben Sie den Film zum ersten Mal gesehen? Ich dachte daran, einige Zuschauerstimmen ins Programmheft zu setzen.« Er machte eine auffordernde Handbewegung. »Nur zu, Rainer, erzählen Sie.«
2
Februar 1927
Lotte Morgenstern hatte sich einen möglichst ausgefallenen Rahmen für die nächste Modenschau gewünscht und war aufs Museum für Naturkunde verfallen – Vorführdamen zwischen Vitrinen mit anatomischen Präparaten, das würde Aufsehen erregen –, doch die Museumsleitung hatte entschieden abgelehnt. Man sei eine ernsthafte wissenschaftliche Institution und dulde keinen Modezirkus.
Lotte war enttäuscht. Sie lief im Büro auf und ab und blieb dann unvermittelt vor ihrem Mann stehen. »Das Romanische Café.«
Carl Fink, an die Schreibtischkante gelehnt, zog eine Augenbraue hoch und schüttelte dann den Kopf. »Das schaffst du nie und nimmer. Als wenn Fiering sein Lokal für eine geschlossene Gesellschaft hergeben würde. Das würde ihm seine Stammkundschaft nie verzeihen.«
Das Romanische Café, gleich gegenüber der Gedächtniskirche, war der berühmteste Künstler-Treffpunkt in Berlin und hatte es nicht nötig, seine Räume für solche Veranstaltungen herzugeben. Umso aufregender würde es sein, wenn Morgenstern & Fink dort ihre Modelle zeigen durften.
»Ich brauche nur einen einzigen Raum. Er muss nicht einmal besonders groß sein. Aber es wird die Kundinnen anlocken, die ganze Schau bekommt dadurch etwas Künstlerisches. Denk doch mal an Kersten & Tuteur, die ihre Kollektion im Theater am Nollendorfplatz vorgeführt haben. So etwas müssen wir den Kundinnen auch bieten.«
Lottes Begeisterung spiegelte sich in Carls Augen. Sie sah, wie seine Miene weicher wurde, und fuhr fort: »Es wäre nur für ein paar Stunden. Wir werden den Raum so nutzen, wie er ist, ohne große Dekorationen oder Aufbauten. Die Kleider sollen für sich sprechen. Aber die Atmosphäre trägt zur Wirkung bei, das Gefühl, an einem besonderen Ort zu sein, an dem sich besondere Menschen aufhalten.«
Carl nickte. »Wenn wir Fiering die Getränke abnehmen, könnte er sich womöglich überreden lassen.«
Lottes Gesicht leuchtete auf. »Das Bassin für Schwimmer, du weißt schon, der kleinere Gastraum für die Arrivierten. Wenn wir den bekommen könnten …« Sie biss sich auf die Lippe. »Allerdings fürchte ich, dass Fiering es sich mit denen nicht verscherzen will.«
Carl trat zu ihr und legte ihr die Hände auf die Schultern. »Meine liebe Frau Fink«, so nannte er sie gern, auch wenn sie bei der Heirat ihren Namen behalten hatte, »du bekommst wohl Angst vor der eigenen Courage. Hier wird nicht gekniffen. Du hast mich überzeugt, dann wird uns das auch bei Herrn Fiering gelingen.«
Lotte lächelte ihn an. Dann legte sie einen Finger an die Lippen und begann erneut, auf und ab zu gehen, weil sie dabei am besten nachdenken konnte. »Vielleicht schreibt sogar jemand ein bissiges Gedicht über die Schau. Das wäre eine Gratis-Reklame.«
»Eben. Denn wir schneidern nicht für Kaiser Wilhelm, sondern für moderne, anspruchsvolle Frauen, für die der Kurfürstendamm der Nabel der Welt ist. Die finden ein Spottgedicht reizvoller als jede seriöse Annonce.«
Lotte sah ihn triumphierend an. »Und wenn wir erst berühmt genug sind, lassen sie uns mit unserem Modezirkus auch ins Museum.«
»Ich gehe gleich morgen hin und spreche mit dem Geschäftsführer«, sagte Carl. »Oder möchtest du das übernehmen?«
»Nein, er ist sicher stärker beeindruckt, wenn du dort auftauchst. Wie schrieb die BIZdoch gleich? Die stattlichste Erscheinung der Berliner Modewelt.«
»Die schreiben viel, wenn der Tag lang ist«, sagte Carl mit einer wegwerfenden Handbewegung, setzte sich und griff nach einem Notizblock. »So, ich warte auf deine Anweisungen.«
Lotte zählte die einzelnen Punkte an den Fingern ab und sprach so schnell, dass er kaum mitkam. »Wie viele Zuschauer wollen wir unterbringen? Datum? Uhrzeit? Wie viele Vorführdamen? Dekoration. Miete für den Raum. Verzehr.« Sie zögerte. »Frag Fiering, wann der Raum am wenigsten genutzt wird, das zeigt guten Willen und Entgegenkommen von unserer Seite.«
Carl lehnte sich zurück und klopfte mit dem Stift gegen die Zähne. »Was für eine kluge Frau du bist. Und noch etwas – wir sollten uns ein Motto ausdenken. Ein Thema für die Schau, etwas, das zieht und den Leuten im Gedächtnis bleibt.« Er dachte kurz nach und schnippte mit den Fingern, bevor er rasch den Schriftzug aufs Papier warf.
Mode von Morgenstern und Fink.
Lotte nickte. »Das ist gut. Schlicht und einprägsam.« Ihre Lippen berührten flüchtig sein Haar. »Was würde ich ohne dich anfangen?«
»Du bist doch früher auch ganz gut ohne mich zurechtgekommen«, sagte er, doch der Schalk in seinen Augen war nicht zu übersehen.
Lotte wurde ernst und setzte sich auf seine Armlehne. »Ja, das bin ich, aber es gibt immer eine Steigerung von gut. Ich möchte nicht mehr ohne dich sein. Es gibt kein besseres Gespann als uns.«
»Der Nächste, bitte«, sagte Ilse Wechsler und schaute ins Wartezimmer. Dort saß nur noch ein Herr von etwa fünfzig Jahren, der einen Cellokasten neben sich stehen hatte. Er blickte überrascht auf, als wäre er in Gedanken versunken und hätte gar nicht erwartet, aufgerufen zu werden.
»Herr Dohm, Sie sind jetzt dran.«
Er stand auf und strich seinen Mantel glatt. Mittlere Größe, glatte dunkle Haare, deren Scheitel wie eine weiße Kreidelinie exakt über den Kopf verlief. Er trug eine runde Brille und schaute schüchtern von Ilse zu seinem Instrument. »Kann ich es so lange … ich meine, ist es hier sicher?«
Sie musste sich ein Grinsen verkneifen. »Ich behalte Ihr Cello im Auge, Herr Dohm. Wenn Sie jetzt bitte zur Frau Doktor hineingehen möchten …« Sie wusste, dass Magda gerne Feierabend machen wollte, weil sie Karten für die Oper hatte. Und Herr Dohm war der letzte Patient.
Ilse räumte das Wartezimmer auf und die Krankenakten weg, fegte die Räume und überzeugte sich davon, dass alle Fenster geschlossen waren. Es bestand immer die Gefahr, dass Diebe Substanzen stahlen, die sie an Süchtige verkaufen konnten.
Ilse freute sich ebenfalls auf den Feierabend. Sie hatte mehr Zeit für sich, seit Marie und Georg älter waren und allein bleiben konnten, wenn ihre Eltern arbeiteten oder ausgingen. Sie hatte sich für einen Zeichenkurs angemeldet und besuchte gern Dia-Vorträge über weit entfernte Länder. In den letzten Jahren hatte sie sich verändert, auch äußerlich. Erst kürzlich hatte ihre Schwägerin Clara ihr gesagt, sie sehe heute jünger aus als vor fünf Jahren, und das spürte Ilse auch. Sie ging beschwingter als früher, hielt sich aufrechter, legte mehr Wert auf Frisur und Kleidung. Sie würde nie eine schöne Frau werden, hatte aber gelernt, das Beste aus sich zu machen.
Als sie ein Räuspern hinter sich hörte, drehte sie sich um.
»Herr Dohm, ich habe gut auf Ihr Cello aufgepasst.«
Er stand da, den Hut in der Hand, und nickte. Dann räusperte er sich erneut. »Danke, Fräulein Wechsler, das ist sehr freundlich. Ich wünsche einen angenehmen Abend.« Er nickte noch einmal, wickelte den Schal fester um den Hals, hängte sich den Cellokasten über die Schulter und verließ die Praxis.
Ilse steckte den Kopf ins Sprechzimmer, wo Dr. Magda Schott die Stiftablage auf dem Schreibtisch geraderückte. Eine Art Ritual und immer ihre letzte Handlung, bevor sie nach Hause ging.
»So, es wird Zeit. Erst Così fan tutte und danach heiße Suppe. Genau das Richtige bei diesem Wetter.«
»Sag mal«, sagte Ilse zögernd und deutete mit dem Daumen über die Schulter. »Was ist eigentlich mit Herrn Dohm? Er sieht eigentlich ganz gesund aus.«
Magda schaute sie an und zuckte mit den Schultern. »Frag mich was Leichteres. Ich habe schon überlegt, ob er ein Hypochonder ist. Mal klagt er über Husten, dann wieder über Verspannungen im Rücken – bei seinem Beruf durchaus denkbar –, aber so richtig krank ist er nie.«
»Dafür kommt er aber ganz schön oft hierher«, erwiderte Ilse.
»Unsere Praxis scheint ihm zu gefallen«, sagte Magda trocken und griff nach ihrem Mantel. »Lass uns gehen, mir reicht es für heute.«
Als sie auf der Straße standen, fragte die Ärztin: »Hast du vielleicht Lust, mit in die Oper zu kommen? Alice ist krank geworden, wir haben eine Karte übrig.«
»Danke, das ist nett, aber ich gehe in einen Vortrag. ›Expedition nach Peru‹.«
»Dann viel Spaß und bis morgen.«
Magda Schott ging in Richtung Straßenbahn. Nach ein paar Schritten drehte sie sich noch einmal um und schaute ihrer Freundin lächelnd nach.
Bertha Focke drückte seufzend die Hände in den Rücken. Sie hatte vier Stunden ununterbrochen an der Nähmaschine gesessen und konnte kaum atmen vor Schmerzen. Sie stützte sich am Küchenschrank ab und schob ihren Stuhl mit dem Fuß an den Tisch, damit er in der übervollen Küche nicht so viel Platz wegnahm. Sie trat an den Korb, in dem ihr jüngstes Kind schlief, und warf einen Blick hinein. Immerhin blieb ihr Zeit, für die anderen zu kochen. Die drei älteren würden gleich aus der Schule kommen und Herbert von der Frühschicht.
Sie machte sich daran, die Kartoffeln zu waschen, und gab sie in einen großen Topf mit Salzwasser. Dann feuerte sie den Kohleherd an, holte mit einem Haken die inneren Ringe der Kochstelle heraus und stellte den Topf darauf. Sie öffnete das Kastenfenster und nahm eine Schüssel Quark heraus, die sie dort gekühlt hatte. Sie gab getrocknete Petersilie und Schnittlauch dazu, die sie in Dosen aufbewahrte.
Das übliche Essen für die Familie. Fleisch gab es höchstens sonntags, aber nur, wenn Herbert keine Kurzarbeit hatte und der Zwischenmeister genügend Arbeit für sie hatte.
Bertha Focke betrachtete den Stapel, der noch auf dem Tisch lag, und seufzte. Wie sie die Mäntel bis morgen schaffen sollte, war ihr schleierhaft. Vielleicht, wenn sie bis zehn weitermachte. Aber es war noch viel in der Wohnung zu tun. Dann mussten Gisela und Bernhard eben helfen, wenn sie mit den Schulaufgaben fertig waren.
Es klingelte. Sie nahm den Deckel vom Topf, damit die Kartoffeln nicht überkochten.
Vor der Tür stand Egon, der Laufjunge von Zwischenmeister Ehrhard.
»Was gibt es?«, fragte Bertha, wobei sie mit einem Ohr auf die Küche horchte.
Egon griff nach einem Paket mit Mantelstoff, das neben ihm auf dem Bogen lag. »Bis morjen Mittag, sagt Herr Ehrhard. Ick hole allet nach zwölfe ab.«
Bertha streckte abwehrend die Hände aus. »Nein, Egon, das geht nicht. Ich schaffe es so schon kaum.«
Egon bedachte sie mit einem hämischen Blick. »Dann soll ick Ihnen sagen, det Schluss is. Wenn Se nich liefern, muss er sich ’ne andere suchen. Et jibt jenuch Frauen, die für ihn nähen wollen.«
Also hatte der Zwischenmeister schon damit gerechnet, dass sie in Zeitnot geraten würde, und Egon die Antwort gleich mit auf den Weg gegeben. Und am schlimmsten war, dass er recht hatte. Es gab so viele Heimarbeiterinnen, dass er sich das erlauben konnte. Immer öfter nähten auch gut situierte Frauen, die keine Familie davon ernährten, sondern sich ein Zubrot verdienen wollten.
Bertha Fockes Mäntel landeten in Geschäften, wo sie auf hübschen Puppen drapiert wurden und zu beachtlichen Preisen angeboten wurden. Bei einem Schaufensterbummel hatte sie einen leichten Sommermantel gesehen, der fünfundzwanzig Mark kosten sollte. Sie selbst hatte fünf Stunden daran genäht und eine Mark verdient. Den Stoff hätte sie unter Tausenden erkannt, er war ihr lange genug durch die Finger geglitten.
Sie schluckte. Also nicht bis zehn, sondern bis zwei an der Maschine sitzen. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, würde sie es dann schaffen.
»Das eine Mal noch«, sagte sie mit aller Würde, deren sie fähig war. Doch Egons Blick verriet ihr, dass er sie durchschaute. Bertha verharrte reglos, bis unten die Haustür ins Schloss gefallen war, griff nach dem Paket und kehrte in die Küche zurück.
Als Gisela aus der Schule kam, hielt sie einen Brief in der Hand und streckte ihn ihrer Mutter aufgeregt entgegen. »Der war im Briefkasten. Wir bekommen doch nie Post. Ist es wichtig?«
Bertha Focke nahm den Umschlag verwundert entgegen. Ihr Name und die Adresse waren mit der Maschine getippt, es stand kein Absender darauf. Sie steckte den Brief in die Schürzentasche und schickte Gisela zum Händewaschen. Erst als das Mädchen den Raum verlassen hatte, trat Bertha ans Fenster, drehte den Umschlag neugierig in den Händen und öffnete ihn. Nachdem sie ihn überflogen hatte, holte sie tief Luft und las ihn gleich noch einmal.
»Darf ich nächsten Monat mit zum Zelten fahren?«, fragte Georg und schaute seinen Vater erwartungsvoll an.
»Von der Schule aus?«, fragte Leo, der noch beim Abendessen saß, weil es im Präsidium spät geworden war.
»Nein. Wolfgang hat mich mit in seinen Jugendklub genommen. Die nennen sich die Adler und machen tolle Fahrten, mit Zelten und Lagerfeuer. Und sie lesen einander aus Büchern vor, Karl May, James Fenimore Cooper und so weiter. Sie lernen angeln und wie man mit trockenem Holz Feuer macht. Es kostet nicht viel, und ich habe was vom Zeitungsaustragen gespart.«
Leo runzelte die Stirn. »März? Bisschen früh fürs Zelten, oder?«
»Na ja, da müssen wir durch. ›Was mich nicht umbringt, macht mich stärker‹, sagt Nietzsche. Siehst du, man lernt da sogar was über Philosophie, das hat Wolfgang auch erzählt«, verkündete Georg im Brustton der Überzeugung, und Leo konnte nicht länger hart bleiben.
»Na schön, wenn du dein Taschengeld dazugibst, können wir drüber reden. Ist das der Wolfgang Müller aus der Turmstraße?«
»Ja, Vati.«
Georg war jetzt dreizehn. Seit er aufs Realgymnasium gewechselt war, hatte er alte Freunde verloren und ein paar neue gefunden, traf sich aber immer noch am häufigsten mit Wolfgang, den er aus der Volksschule kannte. In Moabit gingen nicht viele Jungen auf die höhere Schule, und Georg hatte auch einen längeren Schulweg als früher, besaß aber genügend Ehrgeiz, um die Nachteile in Kauf zu nehmen. Leo war es nicht immer leicht gefallen, die achtzehn Mark Schulgeld aufzubringen; da war die Beförderung zum Oberkommissar sehr gelegen gekommen.
»Nichts gegen Wolfgang, aber du könntest dich auch mal mit den Jungs aus deiner Klasse treffen.«
»Ja, Vati.« Es klang etwas gelangweilt, und Leo schaute seinen Sohn mit hochgezogener Augenbraue an. Georg wurde rot, und Leo boxte ihm spielerisch gegen den Arm.
»Ich habe noch einen alten Rucksack auf dem Speicher. Den kannst du haben, falls er noch zu gebrauchen ist.«
»Danke. Und übrigens – ich habe eine Zwei in Mathe.«
Leo stieß einen leisen Pfiff aus. »Respekt. Jemand anders hätte mir erst von der Note erzählt und dann wegen des Zeltens gefragt.«
»Du hast ihn gut erzogen«, sagte Clara, die gerade hereingekommen war.
»Kann ich noch eine Stunde zu Wolfgang gehen?«, fragte Georg, und Leo nickte. Er freute sich, ein bisschen Zeit allein mit Clara zu verbringen.
Erst als die Wohnungstür ins Schloss gefallen war, bemerkte Leo ihren ernsten Blick. »Was gibt’s? Geht es um das Zelten?«
»Nein, was anderes.« Sie nahm seine Hand und zog ihn vom Stuhl hoch. »Gehen wir ins Wohnzimmer. Ich möchte nicht, dass Marie uns hört.«
Bevor er ihr folgte, nahm er zwei Flaschen Bier vom Fensterbrett und Gläser aus dem Küchenschrank.
»Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes«, sagte er und goss ihnen ein. Dann setzte er sich neben Clara aufs Sofa, ließ aber ein bisschen Platz zwischen ihnen, damit er sie richtig ansehen konnte.
»Nicht schlimm«, sagte sie zögernd. »Aber es könnte sein, dass wir … uns nicht einig sind.«
»Geht es um Marie?«
»Leo, sie ist in der vierten Klasse. Wir müssen bald entscheiden, wie es weitergehen soll.«
»Weitergehen?«
Clara seufzte. »Wir sollten sie nicht auf der Volksschule lassen. Ich habe mit ihrer Lehrerin gesprochen, und sie sagt, Marie sei sehr gut in Mathematik und Naturwissenschaften. Viel besser noch als vor einem Jahr, und sie arbeitet fleißig mit.«
»Also Mittelschule?«, fragte Leo.
»Ich hatte an eine Oberrealschule gedacht.«
»Da gehen doch nur Jungs hin«, sagte Leo spontan.
»Heutzutage nicht mehr. Natürlich wäre sie eines von wenigen Mädchen, aber wenn sie es wirklich möchte, wird sie es sicher schaffen. Ich habe es noch nicht erwähnt, weil ich erst mit dir darüber sprechen wollte. Aber sie wäre sicher sehr glücklich, wenn sie dorthin gehen könnte.«
»Dass sie Tiere zeichnet und zu Weihnachten einen Chemiebaukasten bekommen hat, ist noch kein Grund, sie auf die Oberrealschule zu schicken«, sagte Leo. Er bereute es, als er Claras enttäuschten Blick bemerkte. »Verzeih mir, es war nicht so gemeint.«
»Warum hast du es dann gesagt?« Sie sah ihn über ihr Bierglas hinweg an, und er las das Unverständnis in ihren Augen. »Bei Georg hast du nicht gezögert, obwohl die Zeiten viel schwieriger waren. Und Marie hat ebenso gute Noten wie er.«
Leo wandte sich ab, weil er fürchtete, sie könnte in seinem Gesicht lesen, wie unsicher er sich plötzlich fühlte.
»Leo, was ist los? Für meine Arbeit hast du immer Verständnis gehabt. Und jetzt geht es um deine Tochter, die du so lieb hast. Du kannst Marie doch nicht verwehren, was ihr Bruder darf, nur weil …«
Sie zuckte zusammen, als er sich abrupt zu ihr umdrehte. »Ich weiß nicht, ob ich es mir auf Dauer leisten kann!« Er hatte lauter gesprochen als gewollt, und sein Atem ging heftig. Er stand auf und ging unschlüssig ein paar Schritte, bevor er stehenblieb und Clara ansah. »Ja, ich bin befördert worden, und ja, die Zeiten sind besser. Aber ich verdiene immer noch deutlich weniger als ein Geschäftsmann oder Anwalt. Zwei Kinder auf dem Gymnasium, das sind vierzig Mark im Monat. Und wenn die Wirtschaft noch einmal zusammenbricht wie vor vier Jahren, muss ich womöglich ein Kind von der Schule nehmen. Wie soll ich dann entscheiden? Wem von ihnen soll ich sagen, du darfst nicht länger dorthin gehen, weil ich es nicht mehr bezahlen kann?«
Er versuchte, seinen Atem zu beherrschen, doch es gelang ihm nicht ganz.
Clara saß ganz still da und sah ihn an. Ihre Miene war schwer zu deuten. »Hörst du dich eigentlich reden?«, fragte sie schließlich. »Du sprichst immer nur von dir. Aber du musst die Verantwortung nicht allein tragen, nicht mehr. Wie kommst du nur auf diesen Gedanken?«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich bin so erzogen. Und es ist immer noch ungewöhnlich, dass eine Frau wie du mitverdient.«
»Eine Frau wie ich?« Sie grinste ein wenig. »Du meinst, die Frau eines ehrbaren Beamten?«
»Ach, Clara, du verstehst mich schon.«
Sie trat auf ihn zu, legte ihm beide Hände auf die Brust und sah ihn an. »Ich habe einen Dummkopf geheiratet, wie konnte mir das bloß passieren?«
Clara verstand ihn manchmal besser als er sich selbst und sah klar, wo er sich in etwas verrannte. Bevor Leo etwas sagen konnte, fuhr sie fort: »Ich gebe alles, was ich mit meinen Vorträgen verdiene, für das Schulgeld. Und das Honorar für die Buchbesprechungen auch. Den Rest bezahlst du. Und wenn es irgendwann eng werden sollte, überlegen wir in Ruhe, wie es weitergeht.«
Er schluckte, musste seinen Stolz überwinden.
Clara wartete geduldig ab, bis er die richtigen Worte fand. »Du hast recht. Wir dürfen es Marie nicht verwehren.« Dann lachte er leise. »Mein Mädchen auf der Oberrealschule, wer hätte das gedacht?«
3
Dienstag, 15. März 1927
»So wie Olga Desmond«, hatte Carl gesagt. »Die Tänzerin, kennst du die noch? Sie hat ihre beste Zeit hinter sich, aber die Idee war toll.«
Lotte war zunächst skeptisch gewesen, aber die Vorstellung, zwei Vorführdamen mit Körperfarbe zu bemalen, die sie wie Marmorstatuen aussehen ließ, und dann in schwarze Abendkleider mit eng anliegendem, beinahe streng wirkendem Oberteil und hauchdünnem Chiffonrock zu hüllen, war zu verlockend.
Die Proben im Atelier hatten sie schließlich überzeugt. Der Kontrast zwischen der weißen Farbe, die die Haut wie eine Skulptur aussehen ließ, und den edlen Kleidern war verblüffend. Der Rahmen, den das Café mit seiner ganz besonderen Atmosphäre bot, begeisterte Lotte und Carl, und sie planten den Auftritt der bemalten Damen gleich für die Eröffnung der Schau. Danach würden Teekleider und sportliche Kostüme präsentiert, dann Carls Abendroben und ganz am Ende ein Brautkleid.
Sie hatten den Slogan, den Carl erfunden hatte, auf alle Einladungen gedruckt und an die Presse weitergegeben. Ausgewählte Journalisten waren eingeladen und natürlich die Stammkundinnen des Hauses, darunter auch einige Stars von Film und Bühne. Sie konnte nur hoffen, dass die eine oder andere tatsächlich kommen würde. Viele Damen fanden sich bekanntermaßen spontan ein, als würden sie den Modeschöpfern königsgleich die Ehre erweisen.
»Wie weit seid ihr?«, fragte Lotte ihre Assistentin, die mit einem Karton in der Hand am Büro vorbeiging.
Anita Haase steckte den Kopf zur Tür herein. »So gut wie fertig. Wir bringen gleich alles zusammen mit den Kleidern ins Café. Wann sollen die Vorführdamen da sein?«
Lotte sah auf die Uhr. »Wir beginnen um sieben. Also halb sechs. Dann bleibt genügend Zeit für einen letzten Durchgang, bevor sie geschminkt und frisiert werden.«
Anita nickte. »Die Dame hat angerufen. Herr Korff ist verhindert, sie schicken jemand neues.«
Lotte Morgenstern seufzte. »Schade, aber es lässt sich nicht ändern. Wir müssen nehmen, wen wir kriegen können.«
Der Raum im Romanischen Café war genau so geworden, wie Lotte und Carl es sich erhofft hatten. Als Laufsteg diente ein weinroter Läufer, und die Stühle waren versetzt angeordnet, um allen Gästen eine gute Sicht zu gewähren. Ein Pianist spielte dezent in einer Ecke, während im Nebenraum die letzten Vorbereitungen getroffen wurden. Zwei Kellner gingen mit Tabletts umher, in den Gläsern perlte der Sekt. Im überwiegend weiblichen Publikum wurde geflüstert und gelacht, der ganze Raum war von teuren Düften erfüllt.
Lotte steckte den Kopf in den Ankleideraum. »Das darf nicht wahr sein!«
Carl, der gerade letzte Hand an das Brautkleid legte, drehte sich um. »Was ist denn passiert?«
Lotte deutete mit dem Daumen über die Schulter. »Der lästige Ludwig ist da.«
»Der Kunstseidene?« Carl verdrehte die Augen. Ludwig Ellert war ein Cousin von Lotte, der sich und seine Arbeit in der Kunstseidenbranche ungemein wichtig nahm. »Hast du ihn etwa eingeladen?«
»Natürlich nicht«, zischte Lotte, »aber er hat sich am Eingang sicher aufgespielt, das kann er gut.« Sie zuckte mit den Schultern. »Na ja, letztlich tut er keinem weh. Und ich habe keine Lust auf Ärger, dann soll er eben bleiben. Er schielt schon nach dem Sekt.«
Dann änderte sich Lottes Stimmung schlagartig. »Carl, die Bergner ist gekommen!«
Er sprang auf und trat neben sie.
»Wie hast du das bloß geschafft?«
»Ein Wunder! Sie war noch nie bei uns, obwohl ich finde, dass unsere Modelle wunderbar zu ihrem zarten Typ passen.«