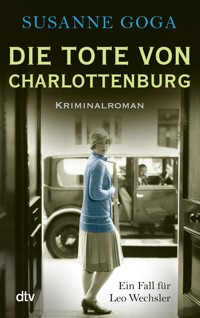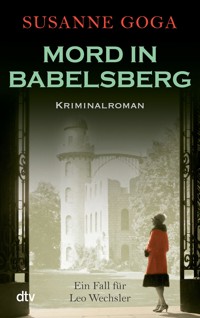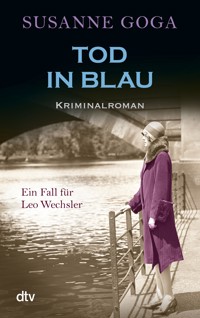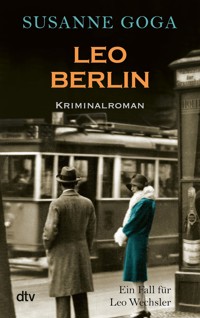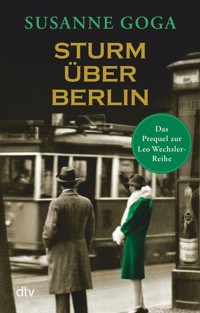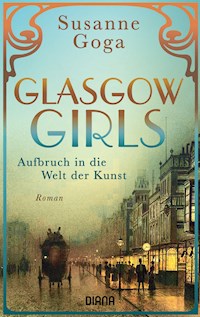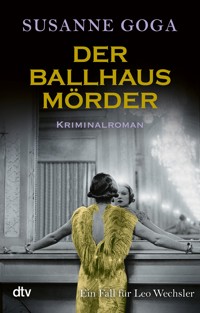10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Reise an den Rhein führt zu einem dunklen Geheimnis
1868. Paula Cooper führt ein zurückgezogenes Leben, bis sie einen unerwarteten Brief erhält. Ihr schwer kranker Onkel Rudy bittet eindringlich um ihren Besuch – im fernen Bonn. Voller Neugier reist Paula von England an den Rhein. Fasziniert von der malerischen Landschaft entdeckt sie eine fremde Welt und lernt den Fotografen Benjamin Trevor kennen. Aber sie ahnt, dass ihr Onkel etwas verheimlicht, und auch die Widersprüche um das Schicksal ihres verstorbenen Vaters mehren sich. Welcher dunklen Wahrheit über ihre Familie muss sich Paula stellen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Roman
1868. Paula Cooper führt ein zurückgezogenes Leben, bis sie einen unerwarteten Brief erhält. Ihr schwer kranker Onkel Rudy bittet eindringlich um ihren Besuch – im fernen Bonn. Voller Neugier reist Paula von England an den Rhein. Fasziniert von der malerischen Landschaft entdeckt sie eine fremde Welt und lernt den Fotografen Benjamin Trevor kennen. Aber sie ahnt, dass ihr Onkel etwas verheimlicht, und auch die Widersprüche um das Schicksal ihres verstorbenen Vaters mehren sich. Welcher dunklen Wahrheit über ihre Familie muss sich Paula stellen?
Zur Autorin
Susanne Goga, 1967 geboren, ist eine renommierte Literaturübersetzerin und SPIEGEL-Bestsellerautorin. Sie wurde mit dem DELIA-Literaturpreis sowie dem Goldenen Homer ausgezeichnet und ist seit 2016 Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Mönchengladbach. Mehr über ihre Romane erfahren Sie unter Susanne Goga im Diana Verlag oder unter susannegoga.de.
SUSANNE GOGA
Die
vergessene
Burg
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 10/2018
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 by Diana Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Gisela Klemt
Umschlaggestaltung: t. mutzenbach design, München
Umschlagmotiv: © Ildiko Neer/arcangel; Stolzenfels Castle 13th Century along the Rhine, Germany 20’s/PVDE/Bridgeman Images und akg-images
Quellennachweis: William Wordsworth »I wandered lonely as a cloud« in der deutschen Übersetzung © Bertram Kottmann (https://gedichte.xbib.de/Wordsworth_gedicht_Narzissen.htm Stand 16.04.2019)
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-641-21830-0V003
www.diana-verlag.de
Besuchen Sie uns auch auf www.herzenszeilen.de
Für meine Tochter Lena – das Beste an Bonn
»Sind Briten hier? Sie reisen sonst so viel,
Schlachtfeldern nachzuspüren, Wasserfällen,
Gestürzten Mauern, klassisch-dumpfen Stellen;
Das wäre hier für sie ein würdig Ziel.«
J. W. GOETHE, Faust. Der Tragödie Zweiter Teil
Prolog
Kein Hauch von Licht im Flur, die Türen nur Rechtecke in einem noch tieferen Schwarz. Sie tastet sich vorwärts, die Hände vor sich ausgestreckt, um nirgendwo anzustoßen, doch zugleich voller Angst, sie könnte etwas berühren, das kalt und feucht und unerwartet ist. Es ist vollkommen still, kein Geräusch verrät, ob jemand in der Nähe ist. Ihre nackten Füße bewegen sich lautlos über die Dielen, ihre Haut haftet am Holz, als wollte sie sich nur widerwillig davon lösen und den nächsten Schritt erlauben. Sie streckt eine Hand nach rechts aus, drückt gegen eine Tür, doch sie gibt nicht nach. Auch die Klinke lässt sich nicht bewegen. Also weiter.
Ihr Nachthemd bläht sich, als von irgendwo ein Luftzug hereindringt. Eine offene Tür? Ein Fenster? Ihr Herz schlägt so heftig, dass sie kaum atmen kann, es scheint in ihrer Brust zu wachsen, als wollte es ihren Körper sprengen.
Dort hinten muss die Treppe sein. Wenn sie es bis dahin schafft, kann sie in die Eingangshalle hinuntergehen und mit jemandem sprechen, irgendein Mensch muss doch da sein, der ihr helfen, der ihre Frage beantworten kann.
Dann hat sie die Treppe erreicht. Sie greift nach dem Geländer und will den ersten Schritt machen, doch unter ihr tut sich nur ein dunkles Loch auf. Sie sieht es in der Dunkelheit, das ist die Logik der Träume.
Sie steht da, einen Fuß in der Luft, die Hand am Geländer –
»Mama!«
Die Stimme trifft sie mitten ins Herz. Sie tritt abrupt vom Abgrund zurück, und dann spürt sie das Kissen in ihrem Rücken, und sie sitzt aufrecht im Bett, und der Luftzug dringt durch das Fenster und drückt ihr das feuchte Nachthemd kühl auf die Haut. Kein Flur, keine Türen, kein gähnendes Loch, wo eine Treppe hätte sein sollen. Nur ihr Herz schlägt noch so heftig wie im Traum.
»Mama!«, schluchzt es im Bettchen neben ihrem, und sie dreht sich zu ihrer Tochter um.
Sie steht auf, nimmt das Kind auf den Arm und tritt mit ihm ans Fenster. Der kleine Körper drängt sich an sie, als könnte er in sie hineinkriechen und dort Schutz finden. Es ist noch ganz dunkel draußen, also muss es mitten in der Nacht sein.
Ein Windhauch weht vom Rhein herüber.
Sie wendet sich zum Bett, schaut auf die zerwühlte Seite, auf der sie gelegen hat, und das unberührte Kissen und die säuberlich gefaltete Decke daneben.
Wieder streicht die Luft über ihre Haut, beinahe höhnisch, als wollte sie sagen, ich komme vom Rhein und ich weiß die Antwort, aber du wirst sie nicht erfahren.
1
Das Haus an der Schleuse
Kings Langley, Hertfordshire
»Es würde uns sehr freuen, Sie dabeizuhaben, Miss Cooper.« Die Pfarrersfrau strich ihr dunkelbraunes Kleid glatt und schaute Paula warmherzig an. »Es erschien mir vermessen, Sie damit zu behelligen, wir alle wissen, wie es um ihre Cousine Miss Farley steht und wie sehr sie Sie beansprucht. Wenn der Reverend hört, dass Sie uns helfen, wird er entzückt sein.«
Paula konnte sich nicht vorstellen, dass Reverend Cranston über irgendetwas in Entzücken geriet – außer vielleicht über die genealogischen Nachforschungen, die er in alten Kirchenbüchern anstellte –, nickte aber bescheiden. »Es wäre mir ein Vergnügen, einen kleinen Beitrag zu Ihrem Abend leisten zu dürfen.« Sie trank von ihrem Tee und nahm ein Ingwerplätzchen, nachdem die Pfarrersfrau ihr nachdrücklich den Teller hingeschoben hatte. »Woran hatten Sie gedacht? Wie Sie wissen, sind meine Fähigkeiten am Klavier begrenzt. Und was meinen Gesang angeht …« Sie zuckte bedauernd mit den Schultern.
Mrs. Cranston stand lächelnd auf und holte ein Buch von einem Beistelltisch. »Um die musikalische Unterhaltung brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen, Miss Cooper. Der junge Mr. Algernon Smith ist ein ausgezeichneter Bariton und wird einige Balladen vortragen. Die Schwestern Ingram spielen ein Duett mit Geige und Klavier, und der alte Charlie Ross wird uns schottische Weisen auf dem Dudelsack darbieten. Es gibt auch eine Aquarellausstellung mit Szenen aus der Umgebung.« Sie legte eine Pause ein und sah Paula feierlich an. »Ich habe Sie einmal in der Kirche vorlesen hören, Miss Cooper, und war ganz bezaubert. Sie haben eine klangvolle Lesestimme. Und damit komme ich zu meinem Anliegen – ich möchte Sie bitten, einige Gedichte vorzutragen. Die Auswahl überlasse ich Ihnen, es sei denn, Sie wünschen meinen Rat.«
»Aber Sie haben einen Wunsch?« Paula deutete auf das Buch, das die Pfarrersfrau auf den Tisch gelegt hatte.
Ein Hauch von Röte überzog Mrs. Cranstons Gesicht. »Sie haben mich ertappt. Ich habe an der Stelle ein Lesezeichen hineingelegt.«
Paula schlug den braunen Lederband auf und las neugierig das Deckblatt. Es war eine englische Übersetzung der gesammelten Gedichte eines gewissen Heinrich Heine, die vor sieben Jahren erschienen war. Sie blätterte zu der Stelle, an der ein schmaler Pappstreifen lag, der mit Vergissmeinnicht in Aquarellfarben verziert war.
Sie legte das Lesezeichen auf den Tisch und las die Überschrift: »Das Lied von der Loreley«.
»Ist das ein Gedicht über Deutschland?«
Mrs. Cranston nickte. »Sie haben sicher schon einmal davon gehört, der Felsen am Rhein.« Als sie Paulas verständnislosen Blick bemerkte, fügte sie hinzu: »Es geht um eine alte Sage, nach der eine schöne Frau auf dem Felsen sitzt und ihre goldenen Haare kämmt, womit sie die Rheinschiffer ablenkt, deren Boote an den Klippen zerschellen. Keine sehr christliche Geschichte, aber das Gedicht ist so romantisch! Mr. Cranston sieht mich immer tadelnd an, wenn ich Heine lese, aber er wird mir diese kleine Sünde wohl verzeihen.«
»Ich hatte noch nie davon gehört, will es aber gern vortragen. Und ich suche noch ein weiteres aus, das dem Reverend vielleicht genehmer ist.«
Mrs. Cranston legte ihr beschwichtigend die Hand auf den Arm. »Keine Sorge, er ist ein milder Richter. Aber Heine war Jude und politisch, nun ja, ein Freidenker, um es vorsichtig auszudrücken. Dennoch, die Loreley wird hoffentlich keinen Anstoß erregen.«
»Ich freue mich darauf, das Gedicht zu lesen«, sagte Paula und meinte es aufrichtig.
Sie hatte England noch nie verlassen und wusste kaum etwas über Deutschland. Auch von diesem Herrn Heine hatte sie nie gehört.
Nachdem sie sich verabschiedet und mit dem Buch in der Hand das Haus verlassen hatte, blieb sie auf der Straße stehen und wandte das Gesicht zur Sonne, die an diesem Tag Ende März schon angenehm wärmte. Sie würde noch ein bisschen spazieren gehen, bevor sie heimkehrte. Der Gedanke, bei Cousine Harriet im dämmrigen Zimmer hinter geschlossenen Vorhängen zu sitzen, schnürte ihr die Kehle zu.
Paula machte sich auf den Weg zum Kirchhof. Ein Spaziergang bedeutete ein bisschen Freiheit, und die war kostbar. Der Rasen war nach den letzten Regenfällen saftig grün, er hob sich geradezu grell vom grauen Stein der Kirche ab. All Saints war ein altes Gotteshaus, dessen Grundmauern bis ins 13. Jahrhundert zurückreichten. Vor zwölf Jahren war Paula als Gesellschafterin nach Kings Langley gezogen, und der Pfarrer hatte es sich nicht nehmen lassen, sie persönlich durch die Kirche zu führen. Damals hatte er ihr auch die Stelle gezeigt, an der früher ein königlicher Palast der Plantagenets gestanden hatte. Paula warf einen Blick auf den eckigen, von Zinnen gekrönten Kirchturm, der sie stets an eine Burg erinnerte.
Ihr Rocksaum schleifte durchs Gras, doch sie achtete nicht darauf, sondern genoss die Sonne auf dem Rücken. Und die Tatsache, dass sie allein war.
Sie betrachtete die Grabsteine, von denen manche wie schiefe Zähne aus dem Rasen ragten und ihre Geheimnisse auf ewig für sich behalten würden, da die Buchstaben verwittert und die Namen in der Zeit verloren waren.
Auf dem weitläufigen Rasen blühten die ersten Narzissen, und Paula blieb stehen, um sie zu bewundern, wobei ihr flüchtig das Gedicht von Wordsworth in den Sinn kam.
Der Wolke gleich, zog ich einher,
die einsam zieht hoch übers Land,
als unverhofft vor mir ein Meer
von goldenen Narzissen stand.
Sie hatte es immer sehr gemocht. Doch da sie zugleich gespannt war, was sie in den Versen erwartete, die Mrs. Cranston für sie ausgesucht hatte, setzte sie sich auf die Bank, die unter der ausladenden Eiche stand, und schlug das Buch auf.
Schon die erste Strophe nahm sie gefangen. Es war, als hätte jemand eine Stimmgabel angeschlagen, deren Klang nun in ihr weiterhallte. Und als sie zu den letzten Versen kam, war ihre Brust auf einmal eng.
Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Loreley getan.
Natürlich war das alles erfunden, ein Märchen voller Gewalt und Verlockung, doch es zog sie unwiderstehlich an. Mehr noch als das dramatische Ende hatte die zweite Strophe sie ergriffen.
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.
In diesen wenigen Zeilen beschwor der Dichter eine Stimmung herauf und malte mit Worten ein Bild, das Paula vertraut erschien, obwohl sie nie an jenem Ort gewesen war. In ihrem Leben war eigentlich kein Platz für romantische Ergriffenheit, sie lebte und dachte rational – einer musste es ja tun. Und dennoch fiel ihr für das, was sie jetzt empfand, kein treffenderes Wort als »Sehnsucht« ein.
Als die Sonne unterging, wurde es empfindlich kühl. Paula zog das Tuch enger um die Schultern, stand von der Bank auf und ging langsam davon, wobei sie noch einen letzten Blick auf die Narzissen warf.
Es waren kaum Menschen unterwegs, nur ein einzelnes Fuhrwerk klapperte die Straße hinunter, sodass Paula ihren Gedanken nachhängen konnte.
Sie liebte Bücher, doch das, was sie bei Cousine Harriet fand, war nicht dazu angetan, die Fantasie anzuregen oder Herz und Verstand anzusprechen. Es gab eine beachtliche Sammlung medizinischer Ratgeber, die Harriet ausgiebig studierte. Auch las sie mit Vorliebe Traktate von Quacksalbern und Kräuterexperten, die gegen gutes Geld ganze Kuren anboten, die man sich ins Haus bestellen konnte. Paula konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Symptome, unter denen Harriet litt, nach derartiger Lektüre stets noch zahlreicher und ausgeprägter waren. Von Romanen und Gedichten hingegen hielt sie nichts.
Paula musste sich mit dem begnügen, was ihr das Leben als Gesellschafterin bot. Viel freie Zeit blieb ihr ohnehin nicht, da sie stets für Harriet da zu sein hatte und zudem leichte Arbeiten in Haus und Garten übernahm.
»In unserer Lage ist eine vorteilhafte Eheschließung unwahrscheinlich. Und so kannst du ein würdevolles Leben führen, ohne offiziell für Geld zu arbeiten«, hatte ihre Mutter erklärt, als sie Paula vor zwölf Jahren eröffnete, dass sie von London nach Hertfordshire ziehen und von nun an Harriet Farley Gesellschaft leisten werde. »Du brauchst dich nicht mit den unerzogenen Kindern fremder Leute abzumühen oder eine Beschäftigung zu übernehmen, die unschicklich für eine junge Dame wäre. Es tut mir weh, dich ziehen zu lassen, aber du bist zwanzig Jahre alt und kannst nicht länger mit meinen Mietern unter einem Dach wohnen.«
Also machte Paula das Beste aus ihrer Lage. Sie lieh sich Bücher bei den einheimischen Damen, die sie unbemerkt in ihr Zimmer brachte und las, wann immer sie die Muße dazu fand.
Jetzt drückte sie den Gedichtband an sich, entschlossen, noch an diesem Abend darin zu lesen. Sie würde einfach sagen, sie sei müde, und sich zeitig zurückziehen, eine Kerze anzünden und gespannt abwarten, ob Herr Heine sie in deren flackerndem Schein noch einmal so gefangen nehmen konnte. Die Sehnsucht, die sie überkommen hatte, klang in ihr nach, war wie ein Stich, der nicht mehr schmerzt, aber noch spürbar ist.
Vor ihr tauchten die Bäume auf, die den Kanal säumten, manche noch fast kahl, andere schon von einem zartgrünen Schleier überzogen. Die Trauerweiden erinnerten sie an kniende Frauen, deren Haare bis zum Wasser reichten, und Paula zwang sich geradezu, die poetischen Gedanken zu vertreiben.
Denn nun musste sie über die Schleuse, die so schmal war, dass sie das Buch unter den Arm klemmte und mit der Rechten das Geländer fasste, während sie mit der anderen Hand den Reifrock flacher drückte, damit er sich nirgendwo verfing. Sie hätte die Brücke nehmen können, doch Paula gefiel es, Cousine Harriets Anweisungen in kleinen Dingen zu trotzen, und überquerte daher den Kanal auf diesem Weg.
Dann tauchte schon das Haus auf, grau und von einer kleinen Mauer umgeben, in die ein überraschend rotes Tor eingelassen war. Die Tür zierte eine schöne Laterne. Paula hatte mehr als einmal vorgeschlagen, das Haus weiß zu streichen, damit es freundlicher aussah, doch Harriet hatte auf dem Grau bestanden, weil ihr »lieber Vater« es so gehalten hatte. An regnerischen Novembertagen schien es mit der Landschaft zu verschmelzen, als würde es einfach verschluckt und alle Bewohner mit ihm. Das Grau war nur erträglich, wenn die blühende Natur ihm widerstand.
Es war ein schlichtes Haus mit zwei Fenstern im Erdgeschoss und im ersten Stock, das man mit einem kleinen Anbau nach hinten vergrößert hatte. Harriet bezeichnete ihn als Wintergarten, auch wenn sie ihn meist verdunkelte und es selbst genügsamen Pflanzen nahezu unmöglich machte, darin zu gedeihen.
Sie war noch nicht durchs Tor gegangen, als bereits die Haustür geöffnet wurde. Carrie, das Hausmädchen, sah ihr besorgt entgegen. Sie und Mrs. Wilby, die Haushälterin, waren gleichmütig und geduldig, zwei Eigenschaften, die erklärten, weshalb sie es schon länger im Haus an der Schleuse aushielten als Paula selbst.
»Miss Paula, Sie werden dringend erwartet! Miss Farley ist sehr erregt, sie musste ihre Tropfen nehmen.«
Paula warf noch einen Blick auf Bäume und Kanal, atmete tief durch und trat ins Haus, wo sie Carrie nicht nur den Hut, sondern auch das Buch reichte.
»Bring es bitte sofort in mein Zimmer.«
Das Mädchen nickte und verschwand in Richtung Treppe.
»Ich habe mir Sorgen gemacht, und dann wurde mir eng in der Brust, sodass ich meine Tropfen nehmen musste«, verkündete Cousine Harriet, die, von Kissen gestützt, auf der Chaiselongue lag. Sie trug einen Morgenrock und eine Haube, und Paula fragte sich, ob sie sich überhaupt angekleidet oder vielmehr den ganzen Nachmittag so verbracht hatte.
»Das tut mir leid. Ich habe mit Mrs. Cranston Tee getrunken und bin dann noch ein bisschen spazieren gegangen. Es war herrlich, der Frühling ist endlich da.«
Harriet streckte die Hand aus, damit Paula ihr half, sich aufrechter hinzusetzen.
»Würdest du mir noch Tee einschenken?«
Paula reichte ihr die Tasse und setzte sich dann in einen Sessel gegenüber. Die Vorhänge waren geschlossen, zwei Lampen verbreiteten gedämpftes Licht. Die Luft war stickig und roch durchdringend nach Nelken und Lavendel, die in kleinen Stoffsäckchen im Raum verteilt waren. Das Kaminfeuer loderte und verstärkte noch die Hitze. Paula knöpfte den Kragen ihrer Bluse auf und fächelte sich Luft zu.
»Dir mag es drückend erscheinen, aber wer leidend ist, weiß die Wärme zu schätzen«, sagte Harriet und stellte die Tasse ab.
»Ich soll dich von Mrs. Cranston grüßen, wir haben über den Basar gesprochen. Und an der Kirche blühen schon die Narzissen!«
Harriet seufzte. »Die würde ich auch gern sehen, ich bezweifle aber, dass ich es nächste Woche Sonntag in die Kirche schaffe. Du kannst dich glücklich schätzen, dass du gesund bist. Es muss bedrückend sein, mit einer Invalidin das Haus zu teilen, das weiß ich selbst. Du bist kein junges Mädchen mehr, aber auch keine alte Frau wie ich. Daher unterstütze ich es, dass du unter Menschen kommst, solange es sich auf ein schickliches Maß beschränkt.«
Da Harriet recht milde gestimmt schien, nahm Paula allen Mut zusammen und wagte einen Vorstoß. »Stell dir vor, nach dem Basar wird es einen Wohltätigkeitsabend geben. Der Erlös ist für das neue Kirchenfenster bestimmt. Mrs. Cranston hat mich gebeten, dabei mitzuwirken, ich soll einige Gedichte vortragen.« Sie sah vorsichtig zu Harriet hinüber. »Sie meint, ich habe eine gute Stimme zum Vorlesen. Du hast dich nie beklagt, und daher hoffe ich, dass du Mrs. Cranstons Meinung teilst.« Seit sie in Kings Langley lebte, hatte es stets zu ihren Aufgaben gehört, Harriet vorzulesen, wenn diese sich schwach fühlte oder die Augen nicht anstrengen wollte.
»Gewiss.« Ein kurzes Zögern. »Wenn du dich darauf vorbereiten kannst, ohne deine Aufgaben zu vernachlässigen, ist nichts dagegen einzuwenden.«
»Mrs. Cranston hat sich ein Gedicht gewünscht, und ich soll noch ein weiteres aussuchen.«
»Ach ja? Etwas Geistliches?«, fragte Harriet und unterdrückte ein Gähnen.
Paula musste lächeln, als sie an die todbringende Jungfrau auf dem Felsen dachte. »So würde ich es nicht nennen. Es stammt von einem deutschen Dichter und beschreibt einen Felsen am Rhein.«
Hätte Harriet nicht so schlaff auf der Chaiselongue gelehnt, wäre Paula die Bewegung wohl entgangen – doch der abrupte Übergang zum aufrechten Sitzen, die Schultern durchgedrückt und das Kinn erhoben, war nicht zu übersehen. »Einen Felsen am Rhein?«
»Ja, die Loreley. Es geht um eine alte Sage, in der eine schöne Frau, die dort sitzt, die Schiffer ablenkt, die daraufhin an den Klippen kentern. Ich war auch überrascht, dass Mrs. Cranston sich für solch ein Gedicht entschieden hat, aber dann habe ich es gelesen, und es ist wirklich schön. Ich hatte noch nie von der Sage oder dem Dichter gehört, das muss ich unbedingt nachholen.«
Cousine Harriet ließ sich wieder nach hinten sinken, wirkte aber angespannter als zuvor, und in ihrem Blick lag eine gewisse Schärfe. »Ich muss vor dem Essen noch ein wenig ruhen. Wenn du mich bitte allein lassen würdest. Du möchtest sicher die Zeit nutzen und über Gedichte nachdenken.«
Paulas Zimmer war klein, aber es gehörte ihr. Die meisten Möbel hatten schon darin gestanden, als sie hergekommen war, doch den Sessel am Fenster und den kleinen Schreibtisch hatte sie von zu Hause mitgebracht. Darauf stand eine Fotografie von ihr und der Mutter – Mrs. Cooper sitzend, Paula neben ihr stehend, die Haare zu langen Locken gedreht und in einem Kleid, das eigens für sie geschneidert worden war. Es war ein Geschenk zu ihrem achten Geburtstag gewesen und danach mehrmals umgeändert worden, um es ihrem wachsenden Körper anzupassen. Das Kleid lag zwischen Seidenpapier und mit einem Duftsäckchen versehen im Schrank, weil es zu kostbar war, um sich davon zu trennen.
Margaret Cooper war früh verwitwet. Sie gab Klavierunterricht und hatte stets bedauert, dass es ihrer Tochter an Talent fehlte. Außerdem vermietete sie zwei Zimmer im Haus, was ihnen ein bescheidenes Auskommen sicherte.
Paula strich flüchtig über den Rahmen und dachte an ihre Mutter in London, die sie lange nicht gesehen hatte.
Ihr Vater war gestorben, als sie ein Jahr alt war, und sie konnte sich weder sein Gesicht noch den Klang seiner Stimme vorstellen. Bisweilen spürte sie eine Leere, wenn sie an ihn dachte, und stellte sich vor, er stünde auf der Fotografie neben ihrer Mutter, die Hand auf ihrer Schulter, den Blick in die Kamera gerichtet oder, lieber noch, zur Seite gewandt, um seine Tochter anzuschauen.
Paula gab sich einen Ruck und versuchte, der Sehnsucht nachzuspüren, die sie vorhin an der Kirche empfunden hatte. Sie trat an das Regal, in dem sich ihre bescheidene Bibliothek befand, und zog eine Gedichtsammlung heraus. Der Besuch auf dem Friedhof hatte sie inspiriert. Die Loreley und die Narzissen sollten es sein.
Am Tag vor dem Basar kam Paula aus dem Pfarrhaus heim und trat mit geröteten Wangen ins Wohnzimmer. Sie stellte Harriet den Kuchenteller hin, den Mrs. Cranston ihr mitgegeben hatte, und setzte sich in den Sessel gegenüber.
»Du strahlst ja so! Was ist geschehen?«, fragte Harriet, die das Papier schon entfaltet und einen anerkennenden Blick auf den Kuchen geworfen hatte.
Paula konnte nicht länger an sich halten. »Mrs. Cranston hat mir ein wunderbares Buch gezeigt, es heißt Die Landschaft des Rheins und enthält ganz viele Bilder! So etwas habe ich noch nie gesehen – steile Berghänge, von denen Burgen und Ruinen herabblicken, mit Efeu bewachsen, darüber Himmel und Wolken, unten die Schiffe auf dem Fluss – und der Künstler hat auch in Öl gemalt, sagt Mrs. Cranston …«
Harriet schob den Kuchenteller beiseite und runzelte die Stirn. »Woher die plötzliche Begeisterung für den Rhein? Du hast dich doch sonst nicht für den Kontinent interessiert.«
»Weil ich nichts darüber wusste. Ich kannte den Rhein nur als blaue Linie aus meinem Geografiebuch, aber diese Bilder – es sieht überwältigend aus.«
»Wir haben hier in England ebenfalls viele schöne Burgen, und auch an Ruinen mangelt es nicht. Wenn ich mich erholt habe und das Wetter freundlich ist, können wir gern einen Ausflug nach Berkhamsted Castle unternehmen, das liegt keine sechs Meilen von hier.«
Paula vermochte sich nicht des Eindrucks zu erwehren, dass Harriet sie mit diesem Vorschlag ablenken wollte. Sie wagte sich für gewöhnlich nie über die Grenze des Ortes hinaus.
»Warum kann ich mich nicht für das eine wie auch das andere interessieren? Ich weiß, dass es in England viele prächtige Burgen gibt, aber so etwas wie diese Rheinbilder habe ich noch nie gesehen. Dort wird sogar Wein angebaut, die Gegend ist berühmt dafür. Dichter sind dort hingereist und Künstler, auch Mr. William Turner hat am Rhein gemalt und gezeichnet.«
Harriet schnaubte verächtlich. »Ich halte nichts von Mr. Turner, auf vielen seiner Bilder kann man kaum etwas erkennen. Die sehen aus, als hätte er ein Wasserglas über die Leinwand gekippt. Nein, Liebes, die Heimat hat viel für sich. Man muss nicht in die Ferne reisen, um das Herz zu erfreuen. Wenn man selten das Haus verlässt wie ich, lernt man die kleinen Dinge zu schätzen. Im Wintergarten zu sitzen und in den Garten zu schauen, die Vögel und das Spiel der Jahreszeiten zu beobachten.«
Paula war verblüfft, dass Harriet so poetisch wurde. »Ich würde gern einmal dorthin reisen. Aber weil das nie passieren wird, reise ich im Geiste dorthin, indem ich mir die Bilder ansehe.«
»Gewiss«, sagte Harriet etwas zerstreut und brach ein Stückchen Kuchen ab.
»Wenn du nichts dagegen hast, gehe ich jetzt in mein Zimmer und übe noch einmal die Gedichte für morgen. Wirst du dabei sein können?«
»Ich hoffe es, denn das möchte ich mir nicht entgehen lassen.«
Noch am Abend ging Paula in ihrem Zimmer auf und ab und sagte die Gedichte laut auf, feilte zum wiederholten Mal an der Betonung und zwang sich, die Augen zu heben. Wenn sie schon zu Boden schaute, wenn sie allein war, würde es ihr nie gelingen, ihr Publikum anzusehen. Nachdem sie beide Gedichte dreimal aufgesagt hatte, fühlte sie sich einigermaßen sicher. Morgen früh noch einmal, das musste genügen.
Sie würden den Saal mit frischen Blumen schmücken – natürlich durfte eine Vase mit Narzissen nicht fehlen –, und wenn sie nachmittags vom Basar kam, würde sie sich sorgfältig ankleiden und frisieren. Ihr Herz schlug heftig, wenn sie an den nächsten Abend dachte, und um sich zu beruhigen, setzte sie sich in den Sessel und schloss die Augen.
Unvermittelt tauchten die Bilder wieder auf, die sie im Pfarrhaus gesehen hatte: die exakten Linien der Stahlstiche, die vielfältigen Schattierungen von Grau, Schwarz und Weiß, die die Wolken, das düstere Gemäuer der Burgen, die ebenmäßigen Reihen der Weinstöcke und den dahinfließenden Strom lebendig werden ließen. Plötzlich wünschte sie sich, das alles farbig zu sehen wie in der Wirklichkeit, mit ihren eigenen Augen und nicht durch die eines fremden Künstlers.
Nachdem Paula beim Basar Kuchen verkauft und die Kinder beim Sackhüpfen beaufsichtigt hatte, ging sie nach Hause und kleidete sich um. Carrie half ihr beim Frisieren. Sie war natürlich keine Zofe, aber recht geschickt darin und hatte einiges von ihrer Mutter gelernt. Paulas Haare waren sauber gescheitelt und im Nacken zu einem kunstvollen Knoten gesteckt, der mit den Blütenblättern einer Narzisse geschmückt war. Hoffentlich welkten sie nicht, bevor sie die Gedichte vorgetragen hatte!
Das lavendelfarbene Kleid war Paulas bestes, und dazu trug sie eine silberne Amethyst-Brosche, die sie von ihrer Großmutter geerbt hatte. Sie zwickte sich behutsam in die Wangen und strich den Rock glatt, unter dem sich eine schmale Krinoline verbarg. Paula hatte nie die weit ausladenden Röcke getragen, die nun aus der Mode gekommen waren – sie waren teuer und für das Haus an der Schleuse mit seinen schmalen Fluren und Treppen gänzlich ungeeignet. Zudem hatte man von schrecklichen Unfällen gehört, bei denen Frauen verbrannt waren, weil ihre voluminösen Kleider Feuer gefangen hatten. Weite Reifröcke eigneten sich zum Müßiggang, nicht aber für eine Frau, die eine Invalidin pflegte, den Garten hegte und Besorgungen im Dorf und den angrenzenden Ortschaften erledigte.
Paula lächelte sich zu, erfüllt von Vorfreude und Lampenfieber. Der Abend würde ihr gehören. Es war ein Ereignis, über das man in der Großstadt gelacht hätte, doch für sie, die so wenig erlebte, war es ein Vergnügen, dem sie gespannt entgegensah.
Paula griff nach ihrem Beutel, in dem sie schon die Gedichtbände verstaut hatte, und ging nach unten. Sie wollte gerade den Mantel überziehen, als sie eine schwache Stimme aus dem Wohnzimmer hörte, gefolgt von einem Poltern.
Harriet lag im Wohnzimmer auf dem Boden, sie hatte das Spitzendeckchen eines Beistelltischs, auf dem eine kleine Vase gestanden hatte, mit sich gerissen. Scherben, Wasser, verstreute Blumen – und mittendrin die ohnmächtige Frau.
Sofort rief Paula nach Carrie und der Haushälterin, kniete sich hin und legte zwei Finger an Harriets Hals. Der Puls war ein wenig schneller als üblich, aber kräftig. Kein Fieber.
»Was ist passiert?«, rief Mrs. Wilby und blieb auf der Schwelle stehen. Carrie presste die Hand auf die Brust und schaute auf ihre Arbeitgeberin hinunter.
»Ich brauche ein kaltes, feuchtes Tuch, einen Brandy, verdünnt, und ein Kissen«, befahl Paula routiniert, und die beiden Frauen eilten davon. Seit sie in diesem Haus lebte, war Harriet nie lebensbedrohlich krank gewesen.
Sie nahm das Sofakissen, das Carrie ihr reichte, und schob es unter Harriets Kopf. Dann faltete sie das feuchte Tuch und legte es der Patientin auf die Stirn, stützte den Kopf und führte das Brandyglas an ihre Lippen. Harriet trank einen Schluck, ohne die Augen zu öffnen.
Paula wollte schon erleichtert aufstehen, als die Cousine die Augen aufriss und die Augäpfel verdrehte. Dann verkrampfte sie sich, wurde starr, ihre Wirbelsäule bog sich durch, und sie murmelte unverständliche Worte. Im nächsten Moment stieß Harriet das Glas beiseite, sodass sich die Flüssigkeit über Paulas Kleid ergoss.
Die drei Frauen sahen einander erschrocken an. So etwas hatten sie noch nie erlebt. Ohnmachten, Erkältungen, Kopfschmerzen, leichte Atemnot – nicht aber einen Anfall wie diesen.
»Carrie, hole Dr. Fisher. Beeil dich!«
Paula versuchte, sich daran zu erinnern, was sie in Ratgebern über derartige Notlagen gelesen hatte.
»Ich brauche ein sauberes Taschentuch.«
Mrs. Wilby zog eines aus ihrer Schürzentasche. »Frisch gewaschen, Miss Paula.«
Sie drehte es zu einer Rolle, drückte links und rechts gegen Harriets Kiefer, bis sich ihr Mund öffnete, und schob das Tuch hinein. Dann knöpfte sie die Bluse ein Stück auf, damit die Patientin besser atmen konnte, und stand auf.
»Jetzt können wir nur abwarten, bis der Arzt kommt.«
»Ich mache Tee«, verkündete Mrs. Wilby, als wäre er ein Allheilmittel. Paula trat ans Fenster, erleichtert, für einen Augenblick allein zu sein. Sie stützte die Hände auf die Fensterbank und atmete tief durch. Etwas stieg in ihr auf, und sie versuchte, es zu unterdrücken, doch es wollte sich nicht so leicht geschlagen geben.
Es war eine kleinliche, selbstsüchtige Wut, aber Paula kam nicht dagegen an. Selbst wenn Dr. Fisher Entwarnung gab, schien es undenkbar, jetzt noch das Wohltätigkeitsfest zu besuchen. Wie konnte sie ihre Verwandte und Arbeitgeberin nach diesem Zwischenfall allein lassen? Natürlich würden die Cranstons und alle anderen Gäste das verstehen, wie sie es immer verstanden. Aber das machte es nur noch schlimmer. Sie waren stets verständnisvoll und entschuldigten die Damen aus dem Haus an der Schleuse, wenn sie wieder einmal nicht am Gemeindeleben teilnehmen konnten. Und so bekam Harriet immer ihren Willen.
Abrupt fuhr Paula herum, als könnte die bewusstlose Frau ihre Gedanken lesen. Doch sie rührte sich nicht, die Brust hob und senkte sich regelmäßig, der Krampf war vergangen.
Paula wandte sich wieder zum Fenster. Ihre Augen brannten, und sie presste die Lippen aufeinander, um nicht zu weinen. Sie schämte sich, dass sie so über Harriet dachte, die sie in ihrem Haus aufgenommen und ihr eine angemessene Position geboten hatte, die ihr monatlich eine kleine Summe zahlte und dafür sorgte, dass Paula gut gekleidet und ernährt und im Dorf angesehen war. Sie hatte ein Zuhause und eine Aufgabe, was mehr war, als viele Frauen von sich sagen konnten.
Und dennoch …
Die Haustür wurde geöffnet, schwere Männerschritte erklangen im Flur, dann trat Dr. Fisher mit seiner abgewetzten Ledertasche ein.
Paula begrüßte ihn und deutete auf Harriet.
Der Arzt kniete sich ächzend hin – er war nicht mehr jung und auch nicht besonders schlank – und fühlte den Puls, bevor er behutsam die Stoffrolle hervorzog. Er schaute über die Schulter.
»Das haben Sie gut gemacht, sehr geistesgegenwärtig. Es ist äußerst unangenehm für die Patienten, wenn sie sich auf die Zunge beißen.« Er zog Harriets Augenlider hoch. »Sie kommt gleich zu sich.«
Ein leises Stöhnen. »Was ist passiert?«
»Alles gut, Miss Farley, man hat sich bestens um Sie gekümmert«, sagte der Arzt.
Zusammen mit Paula und Carrie gelang es ihm, die Patientin aufs Sofa zu betten. Als sie bequem lag und mit Kissen und Decke versehen war, setzte er sich neben sie und ergriff ihre Hand.
»Ist so etwas schon einmal vorgekommen, Miss Farley? Ich behandle Sie mittlerweile so lange und kann mich nicht erinnern.«
Harriet bewegte schwach den Kopf hin und her. »Noch nie. Vielleicht habe ich mich zu sehr aufgeregt.«
»Worüber haben Sie sich denn aufgeregt?«
Sie zögerte und schaute dann zu Paula. »Ich wollte zu dem Wohltätigkeitsfest gehen, um Miss Cooper zu applaudieren, die einige Gedichte vortragen wird, spürte aber, wie mich eine körperliche Schwäche überkam. Ich habe versucht, dagegen anzukämpfen, um sie nicht zu enttäuschen, aber das machte es nur schlimmer. Der innere Zwiespalt hat mich wohl erschöpft, sodass es zu diesem … Zwischenfall kam.«
Der Arzt strich sich zweifelnd über den Backenbart. »Es könnte auch auf eine ernstere Erkrankung hindeuten. Ich verordne Ihnen absolute Ruhe. Wir müssen abwarten, ob sich ein solcher Vorfall wiederholt.«
Harriet nickte, dann machte sie eine auffordernde Geste mit der Hand. »Paula, Liebes, du solltest längst unterwegs sein, man erwartet dich. Verzeih, wenn ich dich geängstigt habe. Du hast es wirklich schwer mit mir.« Ihre Unterlippe zitterte ein wenig.
Der Arzt räusperte sich. »Ich würde Ihnen nicht empfehlen, allein zu bleiben. Dienstboten mögen eine Stütze sein, aber es geht doch nichts über die liebevolle Pflege einer Verwandten.«
»Sie hat die Gedichte so lange eingeübt, da kann ich ihr das kleine Vergnügen wirklich nicht versagen.«
Paula seufzte stumm auf, ging zur Tür und rief Carrie. »Geh schnell in den Gemeindesaal und entschuldige mich bei Mrs. Cranston. Sag ihr, Miss Farleys Zustand lasse es nicht zu, dass ich das Fest besuche.«
Dann schloss sie die Zimmertür, um nicht sehen zu müssen, wie Carrie nach dem Umhang griff und hinaus in den Frühlingsabend lief.
2
Eine Brücke zur Welt
Seit dem Abend des Wohltätigkeitsfestes war alles anders. Nach außen ging Paula wie immer ihren Pflichten nach, doch etwas in ihr war zerbrochen. Sie versuchte, nicht daran zu denken, kümmerte sich um Harriets Gesundheit, begann neue Handarbeiten, pflanzte Blumen, ging regelmäßig am Kanal spazieren, doch abends in ihrem Zimmer fühlte sie sich nicht nur müde, sondern irgendwie leer.
Sie hatte Mrs. Cranston den Gedichtband zurückgegeben, das Gesicht leicht abgewandt, um deren aufmerksamen Augen zu entgehen. Doch die Pfarrersfrau hatte längst geahnt, wie Paula sich fühlte.
Der Umschlag war aus festem, cremeweißem Papier. Miss Cooper, mehr stand nicht darauf.
»Nehmen Sie ihn und schauen Sie zu Hause hinein.«
Er enthielt ein gefaltetes Blatt von dem gleichen kostbaren Papier, das mit Mrs. Cranstons schön geschwungener Handschrift in violetter Tinte bedeckt war.
Sechs Strophen mit jeweils vier Versen, das »Lied von der Loreley« von Heinrich Heine.
Im Umschlag lag außerdem ein Zettel.
Liebe Miss Cooper, es ersetzt nicht den entgangenen Abend, soll Sie aber an die Freude erinnern, die Ihnen das Gedicht bereitet hat. Ihre Mary Cranston
Paula bewahrte das von Hand geschriebene Gedicht wie eine Kostbarkeit auf, zusammen mit einer gepressten Narzisse. Es abends zu lesen und die getrocknete Blüte in der Hand zu halten half dabei, die Leere in ihrem Inneren ein wenig zu füllen. Tagsüber war sie Harriets Blicken ausgesetzt und bemühte sich zu verbergen, was in ihr vorging – und das sie auch gar nicht hätte erklären können –, doch die Zeit, bevor sie schlafen ging, gehörte ihr allein. Dann sagte sie sich das Gedicht auf und versuchte, die Sehnsucht wiederzufinden, die sie beim ersten Mal gespürt hatte. Manchmal schien sie ganz nah, doch sobald Paula sie ergreifen wollte, verschwand sie im Nichts.
Sie erkannte sich selbst nicht wieder. Der Verstand befahl ihr, sich zu fassen, es war doch nur um einen einzigen Abend gegangen, um zwei Gedichte, an denen sie sich jederzeit erfreuen konnte, und was waren schon fünf Minuten Ruhm in einem Gemeindesaal? Sie hatte ihre Pflicht getan, auch wenn sich Harriet rasch erholt und keinen Anfall mehr erlitten hatte. Paula hatte richtig gehandelt und musste sich daher nicht grämen.
Doch ihr Herz widersprach. Die Vorfreude hatte sie beschwingt, sie durch die Tage getragen, weil sie wusste, dass sie abends die Verse üben würde, bis sie sie nicht nur vortragen, sondern mit Leben füllen konnte. Und diese Freude, dieser Auftrieb, diese Sehnsucht waren verloren gegangen und nicht zurückgekehrt.
Du bist früher auch ohne sie zurechtgekommen, sagte der Verstand. Aber auch hier widersprach das Herz: Wenn man einmal von etwas gekostet hat, mag man den Geschmack nie wieder missen.
Ein paar Tage später arbeitete Paula gerade im Vorgarten, als der Postbote pfeifend den Kanal überquerte und sie grüßte. Mr. Finch war ebenso freundlich wie neugierig, und man musste sich hüten, ihm Dinge zu erzählen, wenn sie nicht ganz Kings Langley erfahren sollte.
Er blieb am Tor stehen und deutete auf seine Tasche. »Leider nichts für Sie dabei, Miss Cooper, aber was für ein herrlicher Morgen.«
Paula richtete sich auf und wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. »Ich glaube, ich kann es wagen, die Rosen zu schneiden. Es wird wohl keinen Frost mehr geben.«
Mr. Finch nickte. »Ich habe meine gestern geschnitten. Meine Hüfte sagt mir, der Winter ist endgültig vorbei, und auf meine Hüfte ist immer Verlass. Dann wünsche ich noch einen angenehmen Tag, Miss Cooper. Und grüßen Sie Miss Farley.«
Paula hatte sich bereits wieder den Rosen zugewandt, als sie noch einmal seine Stimme hörte.
»Ich hoffe, Sie haben keine schlechten Nachrichten aus Deutschland erhalten!«
Sie schaute sich um, da sie im ersten Moment glaubte, der Postbote habe schon den nächsten Nachbarn angesprochen. Aber nein, er stand da und schaute sie an.
»Aus Deutschland?«, fragte sie verwundert.
»Nun, der Brief vor zwei Wochen. Verzeihen Sie, aber die Schrift war schwer zu lesen, darum habe ich genauer hingeschaut. Er war an Sie adressiert und in Deutschland abgestempelt.«
»Ach ja, natürlich«, sagte Paula eilig, um ihre Überraschung zu verbergen. »Und, nein, es waren keine schlechten Nachrichten.« Als sie nicht weitersprach, nickte der Postbote enttäuscht und ging davon.
Sie stand da, die Hand mit der Rosenschere hing reglos herab. Alles in ihr war taub, und sie atmete so flach, dass sich ihre Brust kaum hob und senkte. Sie hätte nicht sagen können, ob ihr warm oder kalt war, und sie hörte auch kein Geräusch um sich herum. Die Welt hatte einen Kokon um sie gesponnen.
Irgendwann wanderten ihre Augen zum Haus, und sie sah, dass Harriet durch die Gardine schaute.
Paula legte behutsam die Schere fort, wischte sich die Hände ab und ging zur Tür. Es waren nur wenige Schritte, doch sie wusste, dass nichts mehr sein würde wie zuvor, wenn sie erst hineingegangen war.
»Gib ihn mir.«
Es kümmerte sie nicht, dass Harriet schwer atmete und die Hand aufs Herz presste. »Das kann ich nicht. Und ich verbitte mir diesen Ton.«
Paula stemmte die Hände in die Hüften. »Du gibst es also zu?«
»Was gebe ich zu?«
»Dass du einen Brief unterschlagen hast, der an mich adressiert war! Und von dem ich Wochen später zufällig erfahre, weil mich der neugierige Postbote darauf anspricht.«
Harriet gab einige Tropfen in ein Wasserglas und trank es aus. »Glaube mir, es ist besser so.«
Paula hob die Hand. »Ich glaube an das Recht, meine eigene Post lesen zu dürfen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wer mir aus Deutschland schreiben sollte, aber wenn der Brief für mich war, solltest du ihn mir geben.«
Ihr Kleid klebte am Körper. Das Zimmer war wie immer überheizt, die Vorhänge geschlossen, um die Morgensonne auszusperren. Noch nie hatte sie gegen Harriet aufbegehrt, doch nun trieb eine nahezu überwältigende Empörung sie voran.
»Ich habe mich mit deiner Mutter beraten. Sie stimmt mir nicht nur darin zu, dass es besser ist, wenn du ihn nicht liest, sie hat mich sogar ausdrücklich darum ersucht.«
Paulas Inneres war wie betäubt und zugleich von heißem Zorn erfüllt, wie sie ihn noch nie empfunden hatte. Die beiden Frauen, die ihr am nächsten standen, hatten sie hintergangen!
»Ich bin zweiunddreißig Jahre alt, und ihr wollt mich daran hindern, einen an mich gerichteten Brief zu lesen?«
Harriet stand schwerfällig auf und trat auf sie zu. »Liebes, wir haben dich immer beschützt. Nichts liegt uns mehr am Herzen, und so soll es auch bleiben. Es mag nicht leicht sein, mit einer Invalidin zusammenzuleben, aber du hast es gut bei mir, oder nicht? Alle im Dorf haben dich gern, du hast ein Zuhause, eine Aufgabe, ein bescheidenes Einkommen.«
»Wovor habt ihr mich beschützt?«, fragte Paula verwirrt.
Harriet legte ihr die Hand auf den Arm, doch Paula wich zurück.
»Ich verlange den Brief. Vielleicht verrät er mir die Antwort.«
»Das kann ich nicht, ich habe es deiner Mutter versprochen.«
Paula hatte sich in ihr Leben gefügt, weil man ihr gesagt hatte, dass es gut sei, und weil sie nie gelernt hatte, ihren Willen durchzusetzen.
Darum war das, was nun aus ihr herausbrach, mehr als bloßer Zorn wegen des Briefes. Es ging um die getrocknete Narzisse und das handgeschriebene Gedicht und die Sehnsucht nach dem, was sie gewonnen und verloren und für das sie keinen Namen hatte. Es ging um das enge Haus und die stickigen Zimmer. Die mitfühlenden, bisweilen auch ein wenig abschätzigen Blicke, mit denen die Dorfbewohner sie bedachten, das späte Mädchen, die geduldige Gesellschafterin der kränkelnden Miss Farley, die nie an sich und stets an andere dachte.
»Das ist mir egal!« Sie schrie beinahe. »Ich verlange, dass du mir meinen Brief gibst, und zwar sofort. Dann werde ich in mein Zimmer gehen und ihn lesen und …« Sie hielt erschrocken inne, als ihr ein Gedanke kam. Wenn Harriet ihn nun vernichtet hatte?
Doch ihre Furcht war unbegründet.
»Das kann ich nur mit Zustimmung deiner Mutter tun.«
Paula ging zur Tür.
»Wohin willst du?«
Sie lehnte sich dagegen und versuchte, so ruhig wie möglich zu sprechen. »Wenn du mir den Brief nicht gibst, verlasse ich sofort das Haus.« Sie holte tief Luft und stieß hervor: »Ich … ich packe meinen Koffer und nehme den nächsten Zug nach London.«
Harriet wurde blass, ging unsicher rückwärts und sank auf das Sofa. Paula las die Angst in ihren Augen.
»Geh nicht.« Harriet schluckte. »Carrie soll ihn dir geben. Er liegt auf meinem Sekretär.«
Paula war so erleichtert, dass ihre Beine zitterten. Sie war schon halb zur Tür hinaus, als ihre Verwandte leise hinzufügte: »Wir wollten nur dein Bestes. Wir sind deine Familie. Vergiss das nicht.«
Als Paula den Namen auf dem Umschlag las, schlug ihr Herz schneller. Wer mochte Rudolph Frederick Cooper sein? Ihre Hände waren feucht, die Finger hafteten am Papier, als sie den Brief herauszog.
BONN, DEN 5. APRIL 1868
Meine liebe Paula,
ich hoffe, dass meine Zeilen Dich erreichen. Es ist lange her, seit ich Miss Farley bei der Hochzeit Deiner Eltern gesehen habe und sie mir von dem hübschen Haus am Fluss erzählte, in dem sie damals wohnte. Ich vertraue darauf, dass die Anschrift noch stimmt.
Verzeih, das ist kein guter Beginn für einen Brief, und ich sollte mich wohl erst einmal vorstellen, da Du Dich gewiss nicht an mich erinnerst. Du warst noch keine zwei Jahre alt, als wir uns zuletzt gesehen haben, und Deine Mutter hat mich womöglich nie erwähnt.
Ich bin Dein Onkel Rudy.
Paula glitt der Brief aus den kraftlosen Fingern und flatterte zu Boden.
Sie hatte einen Onkel! Einen Onkel, von dem sie nie gehört, den ihre Mutter und Harriet nie erwähnt hatten. Sie drückte eine Hand auf die Brust, bückte sich und streckte die andere nach dem Blatt aus. Dann las sie gebannt weiter.
Stelle Dir einen Herrn von kräftiger Statur vor, mit lockigen Haaren (auf die war ich immer stolz) und einem Hang zu bunten Seidenwesten. Dieser Herr hat Dich so manches Mal auf den Knien reiten lassen oder umhergetragen, wenn Du geweint hast.
Sie war ihrem Onkel früher sogar begegnet! Er war liebevoll mit ihr umgegangen – doch sie konnte sich an nichts erinnern.
Auf einmal war es, als glitten die Zimmerwände davon. Ein kräftiger Herr mit bunter Weste saß im Gärtchen hinter dem Haus, neben sich auf dem Tisch eine kalte Limonade und eine glimmende Zigarre. Er trug ein kleines Mädchen umher und zeigte ihr die Blumen oder verfolgte mit ihr den Weg eines Schmetterlings.
Seither ist ein halbes Leben vergangen, und ich habe oft an die kleine Paula denken müssen. Warum dieser Brief?, fragst Du Dich, und das zu Recht.
Ich lebe schon lange nicht mehr in London, nicht einmal in England. Wie Du dem Briefkopf entnehmen kannst, bin ich nach Deutschland gezogen, an den schönen Rhein, in eine angenehme Stadt, die mich herzlich aufgenommen hat. Ich betreibe ein Geschäft, das englische Touristen und Reisende mit allem versorgt, was sie in der Fremde benötigen.
Paula ließ den Brief sinken und atmete tief durch. Die Stimme, die aus diesen Zeilen zu ihr sprach, klang seltsam vertraut, obwohl sie sich nicht an den Mann erinnerte, der sie verfasst hatte. Mehr noch, von dem sie bis vor zwei Minuten nicht gewusst hatte, dass er überhaupt existierte.
Ich bin unverheiratet und kinderlos. Vor Kurzem habe ich einen Herzanfall erlitten, und mein Arzt hat mir geraten, vorsichtshalber meine Angelegenheiten zu ordnen. Das hat mich mehr erschüttert als der Anfall selbst, von dem ich mich langsam erhole. Er kann mir nicht sagen, wie lange ich zu leben habe – er sei Arzt und kein Prophet, wie er sich ausdrückt –, doch wenn sein Rat Dich zu mir führt, würde ich mich aus tiefstem Herzen freuen.
Nun bin ich auf dem Papier damit herausgeplatzt, so, wie es auch im Leben meine Art ist. Sei’s drum: Paula, Du bist der einzige Mensch in England, an dem mir liegt und den ich noch einmal sehen möchte, falls es mit mir zu Ende geht. Du bist nicht nur meine einzige nahe Verwandte, sondern auch der einzige Mensch, der mich an meinen Bruder bindet.
Paula hielt inne und presste die Hand auf den Mund. Sie begriff, dass damit ihr Vater gemeint war. Der Vater, der kein Gesicht und keine Stimme hatte, an dessen Berührung sie sich nicht erinnern konnte und von dem ihre Mutter kaum je gesprochen hatte.
Ein weißer Fleck an der Wand, wo einmal ein Bild gehangen hatte, ein Buch mit leeren Seiten, so ungefähr empfand sie, wenn sie an ihren Vater dachte, was selten geschah. Denn gewöhnlich dachte man an Tote, um sich an sie zu erinnern, und erinnern konnte man sich nur, wenn man etwas über sie wusste.
Der Brief in ihrer Hand aber stammte von einem Menschen, der ihren Vater gut gekannt hatte, vielleicht besser und länger als jeder andere. Und sie hatte nicht einmal gewusst, dass es diesen Bruder gab, dachte sie erneut.
Und so ist es mein innigster Wunsch, Dich zu sehen. Daher bitte ich Dich herzlich, mich zu besuchen. Natürlich übernehme ich die Reisekosten und alle anderen Ausgaben, die Dir entstehen. Ich weiß, es gibt ein Hindernis, das schwerer wiegt: Deine Mutter wird sich gegen eine solche Reise stellen, aber Du bist eine erwachsene Frau, älter, als Dein Vater war, als er starb. Verschließe Dich nicht dem Herzenswunsch eines alten Mannes, der Dich in all den Jahren nicht vergessen hat.
Du kannst mir jederzeit schreiben oder telegrafieren. Bitte lasse mich nicht zu lange warten, liebe Paula, da ich nicht weiß, wie viel Zeit mir noch bleibt.
Mit den allerherzlichsten Grüßen,
Dein Onkel Rudy
Sie las noch einmal das Datum. Der Brief war vor fast drei Wochen geschrieben worden! Was, wenn ihr Onkel längst gestorben war?
Paula spürte, wie sich etwas in ihr verhärtete. Sie legte den Brief auf den Tisch und strich ihn sorgfältig glatt. Dann trat sie vor den Spiegel. Sie sah aus wie immer und fühlte sich doch neu. Ein entschlossener Zug um den Mund, der Kopf ein wenig höher, der Rücken gerader. Sie schaute sich lange an. Dann ging sie zu Harriet hinunter.
Am nächsten Tag stand Paula mit ihrem Gepäck im Hausflur. Zwölf Jahre Leben in zwei Koffern, dachte sie flüchtig, aber ohne Wehmut. Sie zog Mantel und Hut an und zögerte kurz, die Hand an der Klinke, bevor sie ins Wohnzimmer trat.
Harriet wartete am Fenster, sie hatte ihr den Rücken zugekehrt.
Paula räusperte sich. »Ich möchte mich verabschieden«, sagte sie leise.
Harriet drehte sich um. Sie sah blass und übernächtigt aus.
»Ich hatte gehofft, du würdest zur Vernunft kommen, wenn du erst darüber geschlafen hast.«
Paula versetzten die Worte einen heißen Stich. »Ich glaube, ich war noch nie so vernünftig, sofern Vernunft bedeutet, das zu tun, was einem der Verstand sagt.«
»Ich werde bestimmt weinen, wenn du weg bist. Ich habe unsere Freundschaft geschätzt, wir haben uns immer so gut verstanden. Du warst meine Brücke zur Welt.«
Paula spürte, wie sie zitterte, wollte es sich aber nicht anmerken lassen. Es gab vieles, das sie hätte sagen können – dass Harriet sie mit ihren eingebildeten Krankheiten an sich gefesselt und erstickt hatte, dass sie ihr die wenigen Freuden geraubt hatte, die sich in Kings Langley boten. Doch sie empfand auch Mitgefühl mit der einsamen Frau und sagte deshalb nichts.
»Ich wünsche dir alles Gute.«
»Du weißt, was gut für mich wäre, hast dich aber dagegen entschieden. Hoffentlich erkennst du doch noch, wo dein Platz ist. Dann werde ich mir überlegen, ob ich dir verzeihen kann.«
Harriet ahnte nicht, dass sie genau die richtigen Worte gewählt hatte, um Paula nach den Koffern greifen und durch die Tür gehen zu lassen, die Carrie ihr mit gesenktem Kopf aufhielt.
Diesmal wählte sie die Brücke über den Kanal, der Weg über die Schleuse war mit dem Gepäck zu schmal. Eine Brücke zur Welt, dachte sie.
3
Eine Werkstatt in Surrey
Guildford, Surrey
Obwohl er seit Jahren nicht mehr selbst Hand anlegte, ließ Charles Trevor es sich nicht nehmen, täglich durch die Werkstatt zu gehen. Durch einen schmalen Flur gelangte er von seinem Kontor, in dem er Kunden und Lieferanten empfing, in die Arbeitsräume, in denen die Stahlstecher an ihren Tischen saßen und Bilder auf Stahlplatten übertrugen. So hatte er auch vor vielen Jahren begonnen. Er war ein guter, vielleicht sogar ausgezeichneter Handwerker, den seine Auftraggeber schätzten, doch das war ihm nicht genug gewesen.
Er hatte es gewagt, sich seinem Vater Henry, der ebenfalls als Kupferstecher gearbeitet hatte, zu widersetzen, indem er sich Geld lieh und einen eigenen Verlag für illustrierte Reisebücher gründete. Henry Trevor war skeptisch gewesen und wäre lieber beim reinen Handwerk geblieben, doch sein Sohn hegte kühnere Pläne. Charles hatte klein begonnen – ein Bändchen über die Burgen Mittelenglands, Ansichten der Küsten von Cornwall und Devon. Doch seitdem Napoleon besiegt war, reisten immer mehr Menschen auf den Kontinent.
Damit begann Trevors Aufstieg. Seine englischen Landsleute entdeckten Deutschland und die Schweiz, und je mehr von ihnen dorthin reisten, desto größer wurde der Wunsch nach Bildern, mit denen man sich an das Erlebte daheim erinnern konnte. Und wem das Geld für solche Fahrten fehlte, der erfreute sich nur an den Bildern und reiste mit den Augen in die Ferne.
»Wie geht es voran, Dick?«, fragte er einen jungen Mann, der sich konzentriert über seine Platte beugte. Er hob den Kopf und wollte aufstehen, doch Trevor winkte ab.
»Mit Verlaub, Sir, aber die Wolken, die Ihr Sohn aufgenommen hat, sind ganz schön schwer zu stechen.«
Trevor warf einen Blick auf die Fotografie, die in einer Halterung auf dem Tisch stand. Ihn überkam ein Anflug von Mitgefühl mit dem jungen Stahlstecher. Er ahnte wohl noch nicht, dass er irgendwann ein anderes Handwerk würde lernen müssen, denn eine neue Zeit war angebrochen – die der Fotografie. Noch waren Stiche und Lithografien beliebt, doch es war zu verlockend, die Welt so zu erleben, wie sie wirklich war, sie genau so zu sehen, wie der Fotograf sie wahrgenommen hatte. Das Gefühl zu haben selbst an jenen fernen Orten zu sein.
Sein Sohn Benjamin hatte in Frankreich bei Charles Marville gelernt und unternahm seither ausgedehnte Reisen für die Firma Trevor & Son, auf denen er die Welt mit seiner Kamera einfing. Zurzeit hielt er sich in der Schweiz auf, wo er in den Walliser Alpen fotografierte.
Es waren bereits einige Aufnahmen mit der Post eingetroffen, die durchaus spektakulär waren und den Betrachter geradewegs in die gewaltigen Bergpanoramen hineinzuziehen schienen. Trevor konnte es kaum erwarten, das Buch herauszubringen; er hatte Benjamin gedrängt, früher zurückzukehren, da die Bildbeschreibungen verfasst werden mussten und er das Buch rechtzeitig vor Weihnachten veröffentlichen wollte. Es würde eine kostspielige Ausgabe werden, die hervorragend als Geschenk geeignet war.
Er trat ans Fenster und schaute wehmütig hinaus. Sein Geschäft lebte davon, dass sein Sohn auf Reisen ging, aber es bedeutete auch, dass Charles Trevor oft allein war. Seine Frau war vor drei Jahren gestorben, eine Tochter war in Schottland verheiratet, die andere in Manchester. Er besuchte sie zweimal im Jahr, häufiger ließ es seine Arbeit nicht zu, und mit den Enkelkindern zu ihm nach Südengland zu reisen war den Töchtern zu beschwerlich. Einmal in der Woche spielte er mit Freunden Whist und blieb ansonsten abends lange im Verlag, weil er sich vor seinem einsamen Haus fürchtete, in dem ihn alles an die Zeit erinnerte, da er mit Frau und Kindern dort gewohnt hatte. Trevor galt als ehrgeizig und strebsam, und kaum jemand ahnte, dass er in Wahrheit den Weg nach Hause scheute.
Benjamin hatte in seinen letzten Briefen angedeutet, er wolle diesmal länger in England bleiben, und sein Vater hoffte, dass es wirklich so käme. Natürlich würde er sich nicht anmerken lassen, wie sehr sein Sohn ihm gefehlt hatte. Nein, er musste es geschickter anstellen, ihn an seine Heimat zu binden. Deshalb hatte er Erkundigungen über neue Kameras eingezogen und sich Kataloge schicken lassen, außerdem wollte er Benjamin mit dem berühmten Fotografen Francis Frith zusammenbringen, der in Reigate einen Verlag betrieb. Wenn alles gut ging, würde es Benjamin eine Weile beschäftigen, bevor die Reiselust erneut zu groß wurde.
Trevor wollte gerade ins Kontor zurückkehren, als Jim, der Botenjunge, ungestüm in die Werkstatt gerannt kam. Als er Charles Trevor sah, blieb er stehen, fuhr sich verlegen über die Haare und hielt ihm ein Blatt entgegen.
»Sir, ein Telegramm für Sie«, sagte er atemlos.
»Danke, Jimmy.« Trevor steckte dem Jungen einen Penny zu und trat beiseite. Ein Telegramm bedeutete oft schlechte Nachrichten, und sein Herz zog sich zusammen, als er an Benjamin dachte. Aber es kam nicht aus der Schweiz.
Als er den Namen oben auf dem Kopf sah, entglitt ihm das Blatt und schwebte kreiselnd zu Boden.
4
Lambeth
Lambeth, London
Paula war der Weg von der South Western Railway Station zur Church Street, in der ihre Mutter wohnte, noch nie so lang erschienen, was daran liegen mochte, dass sie zwei Koffer bei sich trug. Sie hatte sich gegen eine Droschke entschieden. Wenn sie ihren großen Plan umsetzen wollte, durfte sie nicht einen Penny verschwenden. Sie bewahrte ihre Ersparnisse aus zwölf Jahren in einer kleinen Schatulle auf, die tief in einem der Koffer steckte, und hatte nur das herausgenommen, was sie für die Fahrkarte nach London und ein wenig Proviant benötigte. Die Passanten schauten sie verwundert an, weil eine gut gekleidete Frau zu Fuß ging und so schwer zu schleppen hatte, doch das kümmerte Paula nicht.
Sie lief durch schmale, ungepflasterte Straßen, bis rechts von ihr das weite Grün der Lambeth Palace Gardens auftauchte. Zwischen den Bäumen, deren zartgrünes Laub noch nicht so dicht war wie im Sommer, schimmerten die rötlichen Mauern des Palastes hindurch.
Wenn sie erst zu Hause war – denn die Church Street war immer ihr Zuhause geblieben, obwohl sie so lange im Haus an der Schleuse gewohnt hatte –, würde sie ihrer Mutter erklären, weshalb sie Kings Langley verlassen hatte, und dass sie diese Reise einfach unternehmen musste.
Paula blieb stehen und setzte die Koffer ab. Ihre Handflächen schmerzten trotz der Handschuhe, und sie zog sie aus und blies darauf, um sich ein bisschen Erleichterung zu verschaffen.
»Da hol mich doch einer – wenn das nicht Miss Cooper ist!«
Sie zuckte zusammen, ehe sie das kleine Fuhrwerk bemerkte, das neben ihr angehalten hatte. Auf dem Bock saß ein älterer Mann mit dickem Bauch, der sie freundlich anlächelte.
»Mr. Almsley, wie schön, Sie zu sehen!«
»Sie wollen Ihre liebe Mutter besuchen, nehme ich an.«
Paula nickte. Sie kannte Mr. Almsley, seit sie ein kleines Mädchen gewesen war. Er führte den Kolonialwarenladen neben ihrem Haus, und sie hatte oft mit seinen Kindern gespielt.
Ohne lange zu fragen, sprang er vom Wagen, wuchtete ihre Koffer auf die Ladefläche und half ihr beim Aufsteigen. Dann schnalzte er mit der Zunge, um das Pferd anzutreiben, und plauderte unterwegs von Frau und Kindern.
Vor ihnen tauchte die Kreuzung mit der breiten Lambeth Road auf. Die Straße war holprig und der Sitz hart, aber Paula genoss die Fahrt. Obwohl Lambeth eher ländlich wirkte, hätte sie mit geschlossenen Augen sagen können, dass sie in einer Großstadt war. Es roch anders, Räder rollten, von überall erklangen Stimmen, Kirchenglocken läuteten, Türen schlugen, Waren wurden in Keller geschüttet, Maschinen ratterten in Werkstätten und hinter Ladentüren.
Plötzlich merkte sie, dass London ihr gefehlt hatte.
Die Lambeth Road verengte sich zur Church Street. Dort drüben stand St. Mary, der die Straße ihren Namen verdankte, dahinter erhoben sich die Türme des bischöflichen Palastes, und genau vor ihr, geradeaus, spannte sich die Lambeth Bridge über die Themse.
Als sie durch die vertraute Straße fuhr, kehrte die Erinnerung zurück. Die Bonbongläser auf der Theke des Kolonialwarenladens, der Duft von warmem Brot, der sich, wenn der Wind richtig stand, mit dem modrigen Geruch des nahen Flusses mischte. Paula hatte sich Geschichten zum Palast mit seinem Garten ausgedacht, sich ausgemalt, dass nicht der Erzbischof von Canterbury, sondern ein Raubritter dort wohne. Damals verkehrte noch die Fähre auf dem Fluss und hatte in Paulas Fantasie Piraten von Westminster herübergebracht, die den Raubritter bekämpfen wollten.
O ja, sie hatte gern in der Church Street gewohnt, während ihre Mutter dort weniger glücklich war. Sie war freundlich zu den Nachbarn, aber auch ein wenig distanziert, als gehörte sie nicht in diese Gegend, als hätte allein das Schicksal sie gezwungen, hier zu leben.
»Da wären wir, Miss Cooper.« Das Fuhrwerk hielt vor dem Laden, und Paula zwang sich aus ihren Erinnerungen zurück in die Gegenwart.
Der Kolonialwarenhändler sprang vom Bock, holte ihre Koffer herunter und half ihr beim Absteigen.
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür des weiß getünchten Hauses nebenan, und Margaret Cooper trat auf die Schwelle.
Paula sah ihre Mutter an, wollte ihr lächelnd entgegentreten, sie umarmen – und blickte in ein Gesicht aus Stein.
»Wie konntest du Harriet das antun?«
Paula saß wie betäubt da. Das Telegramm lag offen auf dem Tisch.
»Mutter, wenn du mir zuhören würdest …«
»Was gibt es da zuzuhören?« Mrs. Coopers feine Gesichtszüge wirkten verkniffen und angespannt. »Du willst alles aufgeben? Nur weil dir ein Onkel, den du nicht kennst, einen Brief geschrieben hat?«
»Den ich nicht kenne?«, wiederholte Paula ungläubig. »Ich konnte ihn ja gar nicht kennen, da du mir nie von ihm erzählt hast! Warum hast du mir verschwiegen, dass ich einen Onkel habe?«
»Dafür gab es gute Gründe. Jedenfalls kannst du nicht allein nach Deutschland reisen und einen dir völlig fremden Menschen besuchen. Das ist undenkbar.«
Paula atmete tief durch und stand auf.
»Wohin willst du?«
Sie hatte die Hand schon am Türknauf. »In mein Zimmer. Morgen früh erkundige ich mich, wie ich nach Bonn komme. Außerdem werde ich Onkel Rudy telegrafieren. Ich kann nur hoffen, dass er sich erholt hat und das Telegramm ihn noch erreicht.«
Sie wollte die Tür öffnen, als eine blasse Hand sich über ihre schob. Paula blickte auf. Ihre Mutter war neben sie getreten und hatte Tränen in den Augen.
»Bitte«, sagte sie, und zum ersten Mal, seit Paula angekommen war, klang ihre Stimme nicht zornig. »Bitte bleib.«
Paula setzte sich in einen Sessel.
»Meine Mieter kommen bald nach Hause, dann muss ich nach dem Essen sehen. Aber ich möchte nicht, dass wir so auseinandergehen.« Mrs. Cooper setzte sich aufs Sofa und strich ihr Kleid glatt. »Es tut mir leid, dass du von dem Brief erfahren hast. Ich wünschte, es wäre nicht dazu gekommen. Harriet sollte ihn vernichten, darum hatte ich sie ausdrücklich gebeten.«
Paula lachte bitter auf. »Es tut dir leid, dass ich von ihm erfahren habe, aber nicht, dass du ihn mir vorenthalten wolltest?«
»Uns lag nur dein Wohl am Herzen«, beteuerte ihre Mutter.
Paula schaute sie argwöhnisch an. »Was kann so schlimm daran sein, wenn mein Onkel mir einen Brief schreibt?«
Mrs. Cooper faltete die Hände im Schoß, ihre Finger umklammerten einander so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten. »Du hast den Brief gelesen und gibst alles auf, was du Harriet und mir verdankst.«
»Ich habe nie gesagt, dass ich alles aufgebe, ich möchte nur zu meinem Onkel reisen. Harriet hat mir allerdings zu verstehen gegeben, dass es ihr schwerfallen wird, mich nach der Reise wieder bei sich aufzunehmen.«
»Mit gutem Grund! Du willst zu einem fremden Mann fahren, zudem ins Ausland. Was soll aus Harriet werden, während du unterwegs bist? Auf solchen Reisen kann alles Mögliche geschehen, sie dauern meist länger als erwartet …« Die Mutter verstummte plötzlich, als hätte sie zu viel gesagt.
Paula spürte einen Anflug von Unsicherheit, wollte sich aber nichts anmerken lassen. Wenn sie jetzt zauderte, würde sie sich das nie verzeihen.
Doch ihre Mutter war noch nicht fertig mit ihr. »Du bist aus Kings Langley davongelaufen, hast Hals über Kopf dein Leben weggeworfen. Ein einziger Brief reichte aus, um Harriet im Stich zu lassen. Die Leute im Ort werden fragen, wo du bist, wie du eine kranke Verwandte so rücksichtslos behandeln konntest. Nein, mein Kind, so einfach kannst du nicht zurück.«