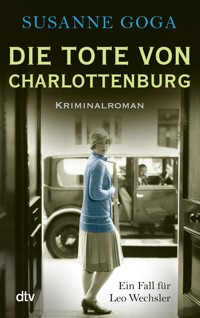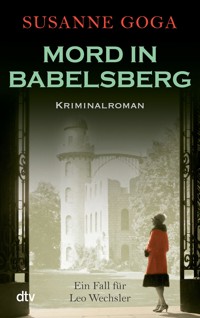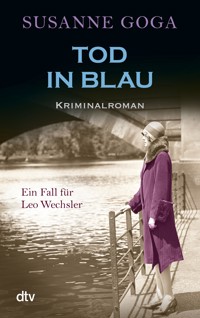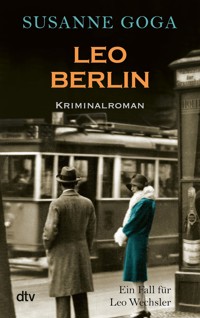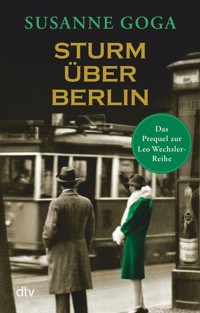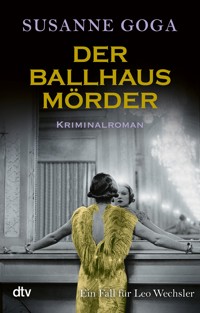9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Krimi
- Serie: Leo Wechsler
- Sprache: Deutsch
Das Cabaret des Bösen Berlin im Januar 1928: Ein Toter wird in einem Schuppen im Hinterhof des Askanischen Gymnasiums gefunden. Direkt daneben befindet sich das Varieté- und Sensationstheater »Das Cabaret des Bösen«, dessen Besitzer seine aus dem Krieg stammenden Gesichtsverletzungen offensiv zur Schau stellt. Vor dem Fund der Leiche wurde eine verstörte junge Russin am Theater gesehen, auf der Suche nach einem gewissen »Fjodor«. Liegt der Schlüssel zu den mysteriösen Vorkommnissen um das Cabaret im Scheunenviertel, wo russische Emigranten in beengten Verhältnissen leben? Einmal mehr lernt Leo Wechsler bei seinen Ermittlungen unbekannte Gesichter seiner Stadt kennen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Susanne Goga
Nachts am Askanischen Platz
Kriminalroman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Felix – den ich immer fragen kann. Und danke für Peter und Gustav.
Prolog
Die Patientin lag ausgestreckt auf dem OP-Tisch, die Hand- und Fußgelenke mit Lederriemen fixiert. Ein greller Scheinwerfer erleuchtete den Tisch, während der übrige Raum in tiefe Dunkelheit getaucht war.
Die Frau hatte die Augen weit aufgerissen, doch der Knebel in ihrem Mund erstickte ihre Schreie, als eine Krankenschwester ihren Kopf in einer Vorrichtung platzierte, die jede Bewegung unterband.
»Ganz ruhig, Sie machen es nur noch schlimmer«, sagte die Krankenschwester in einem sanften Ton, der umso bedrohlicher klang, weil er so gar nicht zu der furchteinflößenden Umgebung passte.
Die Frau zuckte mit Armen und Beinen, so weit es die Lederriemen zuließen, ihre Augen schienen vor Entsetzen aus den Höhlen zu treten. Ihr ganzer Körper bäumte sich auf, während sie ebenso verzweifelt wie vergeblich gegen die Fesseln kämpfte.
Aus dem Hintergrund trat ein hochgewachsener hagerer Mann mit stahlgrauem Haar, der eine chirurgische Säge in der Hand hielt. Er trug einen weißen, hinten geknöpften Kittel, der makellos gewaschen und gestärkt aussah.
»Fertig, Schwester?«
Sie nickte. »Ja, Herr Professor, es ist alles vorbereitet.« Die Schwester glitt in den Schatten, während der Chirurg geradeaus schaute, an der Patientin vorbei, und in sachlich-nüchternem Ton zu sprechen anhob.
»Die Operation, die ich heute durchführen werde, ist insofern von wissenschaftlichem Interesse, als sie die Reaktionen der Patientin während der chirurgischen Vorgänge deutlich erkennen lässt. Schwester Else wird sie dokumentieren, damit wir sie mit Ergebnissen vergleichen können, die wir an Patienten im bewusstlosen Zustand gesammelt haben. Am Ende dieser Versuchsreihe werden wir entscheiden, ob es ratsam ist, bei Operationen am Gehirn künftig auf eine Betäubung zu verzichten.«
Die Krankenschwester kehrte mit Stift und Notizblock an den Tisch zurück und schaute ihn erwartungsvoll an.
Der Chirurg setzte die Säge an, worauf ein knirschendes Geräusch ertönte, das von überallher zu kommen schien. Die Patientin bäumte sich auf, ihr ganzer Körper beschrieb einen Bogen. Sie erinnerte an einen Fisch, der sich am Boden eines Bootes krümmt und verzweifelt dem Wasser zustrebt.
Der Chirurg ließ sich nicht beirren. Er sägte mit knappen, präzisen Bewegungen weiter und presste konzentriert die Lippen aufeinander. »Sobald ich das Gehirn freigelegt habe, werde ich –«
Ein Schrei ertönte, ein Poltern im dunklen Raum, man hörte Schritte, die sich hastig entfernten. Eine Tür schlug zu.
Der Chirurg blickte kurz auf, zog missbilligend eine Augenbraue hoch und setzte sein blutiges Werk fort.
Bis er die Schädeldecke abnahm und der Krankenschwester reichte, hatte sich die Tür nach draußen noch zweimal geöffnet.
1
Samstag, 7. Januar 1928
Der Festsaal im Rathaus war mit Blumengestecken geschmückt, und in den Kristallen der gewaltigen Kronleuchter brach sich funkelnd das Licht. Ein Streichorchester spielte etwas von Schubert, das im Stimmengewirr fast unterging. Der Neujahrsempfang der Berliner Polizei war in vollem Gange.
Leo Wechsler zwang sich, den Blick von Clara zu lösen und sich stattdessen Polizeipräsident Karl Zörgiebel zuzuwenden, der mitten im Saal die Gäste empfing.
»Herzlich willkommen, Herr Wechsler.«
»Guten Abend, Herr Präsident. Darf ich vorstellen – meine Frau Clara.«
Zörgiebel deutete eine Verbeugung an. »Es ist mir ein Vergnügen, Frau Wechsler. Ich hoffe, Sie gestatten mir die Bemerkung, dass Ihr Mann beruflich zwar brillieren mag, Sie ihn heute Abend jedoch bei Weitem überstrahlen.«
Leo musste ein Grinsen unterdrücken. Wenn sich der gelernte Küfer und ehemalige Gauleiter der Böttchervereinigung, der es bis zum Berliner Polizeipräsidenten gebracht hatte, zu solch blumigen Bemerkungen verstieg, musste Clara tatsächlich hinreißend aussehen.
Das schilfgrüne Kleid mit der tief angesetzten Taille umfloss ihre Figur wie eine schimmernde Haut, und über den großen Rückenausschnitt spannten sich Silberschnüre, die mit winzigen Muscheln verziert waren. Dagegen wirkte Leos geliehener Frack mehr als unscheinbar.
Sie wechselten einige Belanglosigkeiten mit dem Präsidenten, dann legte Leo den Arm um Clara und steuerte einen Kellner an, der ein Tablett mit Sektgläsern balancierte. Er genoss es, dass er Claras Körper durch das zarte Kleid hindurch spüren konnte.
Ihre roten Haare waren in Wellen gelegt, und sie hatte nur Lippen und Augenbrauen nachgezogen, mehr Schminke brauchte sie nicht. Sie duftete nach dem Parfüm von Guerlain, das Leo ihr zum Geburtstag geschenkt hatte. Sie war einfach vollkommen, dachte er. Auch nach fünf Jahren konnte er manchmal nicht ganz glauben, dass Clara ihn geheiratet hatte.
Sie hatten sich gerade Gläser genommen und miteinander angestoßen, als ein Mann mit Schnurrbart und runder Brille auf sie zutrat.
»Guten Abend, Herr Dr. Weiß«, sagte Leo und deutete eine Verbeugung an. Er schätzte den Vizepolizeipräsidenten ungemein – Dr. Bernhard Weiß war nicht nur fachlich ausgezeichnet, sondern stellte sich immer und überall dem Unrecht in den Weg.
»Meine Frau Clara.«
»Sie sehen ganz bezaubernd aus, Frau Wechsler, wenn Sie mir diese Bemerkung erlauben.«
»Mein Mann spricht mit der allerhöchsten Anerkennung von Ihnen, Herr Dr. Weiß.«
»Sie nehmen die Arbeit mit nach Hause, Herr Wechsler? Meine Frau mag davon nichts hören. Sie schickt mich immer in den Garten, wenn ich damit anfange.«
Leo lächelte. »Ich versuche, Clara nicht allzu sehr zu langweilen, aber es tut gelegentlich gut, sich Luft zu verschaffen.«
Weiß nickte verständnisvoll. »Natürlich. Sie sehen Dinge …« Er zögerte. »Ich weiß, es ist nicht leicht. Gennat hat mir damals von dem Fall in Breslau erzählt. Danach hätte ich wochenlang nicht geschlafen.«
»Es hat ihn hart getroffen, dass man den Kindermörder nicht gefasst hat. Einer der wenigen Fälle, die er nicht aufklären konnte, es treibt ihn noch immer um.«
Weiß hob sein Glas. »Jetzt aber Schluss mit den trüben Gedanken. Selbst Polizisten sollten an diesem Abend ihren Beruf vergessen.« Er nickte freundlich und ging weiter.
Clara schaute ihm nach. »Wie hält er das nur aus? Goebbels’ ständige Attacken im Angriff? Und dass er ihn immer nur Isidor Weiß nennt?«
Leo zuckte mit den Schultern. »Das frage ich mich auch. Dass dieses Schmierblatt überhaupt erscheinen darf, ist eine Farce. Ich leihe es mir manchmal von Joachim, damit ich es nicht auch noch finanziere.« Er hielt inne. »Weißt du noch, der Sommer, in dem Rathenau ermordet wurde? Wir haben es Weiß zu verdanken, dass die Mörder gefasst wurden. Das haben ihm die Rechten bis heute nicht verziehen.«
Clara stieß klirrend mit ihm an. »Er hat recht, lass uns heute mal nicht an die Arbeit denken. Es wäre schade um die Mühe, die Fink sich mit dem Kleid gegeben hat.« Sie wandte ihm den Rücken mit den Muschelschnüren zu und schaute kokett über die Schulter.
»In der Tat ganz bezaubernd, Frau Wechsler.«
»Du siehst auch nicht übel aus. Marie war sehr stolz auf dich.«
Leos Tochter hatte sie in Augenschein genommen, nachdem sie sich für den Abend bereit gemacht hatten.
»Ihr seid aber vornehm«, hatte sie gesagt. »Vati im Frack und Clara als Prinzessin.«
Clara hatte eine Grammofonplatte aufgelegt und Leo zugezwinkert.
»Wie konnte ich das vergessen? Der erste Tanz gehört meiner Tochter. Darf ich bitten?«
Er hatte Marie den schwarz gekleideten Arm hingehalten, worauf sie knickste. Dann hatten sie sich im Walzerschritt durchs Wohnzimmer bewegt, und Clara war leise hinausgegangen. Sie betrachtete Marie und Georg als ihre Kinder, doch es gab Momente, die nur Leo und den beiden gehörten.
Nach dem Bankett wurde getanzt. Als sie eine Pause einlegten, bat Clara Leo, ihr an der Bar ein Glas Saft zu holen. Der Sekt war ihr zu Kopf gestiegen.
»Du kannst mich ruhig allein lassen«, sagte sie lächelnd. »Ich genieße es, mir die Leute anzusehen, und kann mich durchaus eine Weile ohne dich amüsieren. Also los.« Mit einer spielerischen Handbewegung scheuchte sie ihn davon.
Leo wusste, dass sie ihm Gelegenheit geben wollte, mit Bekannten und Kollegen zu sprechen, ohne auf sie Rücksicht zu nehmen. Clara war so ziemlich die selbstständigste Frau, die er kannte.
Er bestellte gerade den Saft und ein Glas Wein für sich, als ihm ein unerwarteter Kommentar ans Ohr drang.
»Wunderbare Nase, ganz klassisch.«
Leo schaute nach rechts und bemerkte einen rundlichen Herrn mit Schnurrbart und Halbglatze, der den Kellner hinter der Theke eingehend musterte.
»Verzeihung?«
»Na, die Nase. Schauen Sie nur. Vollkommen gerader Rücken, kein Höcker. Das ist ein Nasengerüst wie aus dem Lehrbuch.«
Leo sah den Mann belustigt an. »Sie studieren menschliche Nasen?«
Sein Nachbar nickte mit ernster Miene. »Berufskrankheit. Sind Sie Polizist? Reden Sie nicht auch gelegentlich über Einbrüche und Morde?«
»Ja, ich bin Polizist. Soll ich jetzt herausfinden, was Ihr Beruf ist?«
»Ich bitte darum«, sagte der Mann und wandte sich ihm zu, den rechten Arm auf die Theke gestützt.
»Hals-, Nasen- und Ohrenarzt, würde ich sagen. Wobei Sie die Nase eben eher ästhetisch als medizinisch zu betrachten schienen.«
»Sie sind auf der richtigen Spur.«
Die Bedienung stellte Saft und Bier auf die Theke. Leo warf einen Blick zu Clara, die mit einer Dame ins Gespräch gekommen war. Also hob er das Glas und prostete seinem neuen Bekannten zu.
»Dann sollte ich dieser Spur folgen. Nase, Medizin, Ästhetik – natürlich, Sie sind der Nasenjoseph. Verzeihen Sie den Spitznamen. Und vor allem, dass ich Sie nicht sofort erkannt habe.«
Prof. Dr. Jacques Joseph verbeugte sich grinsend. »Nun wüsste ich aber auch gern, mit wem ich das Vergnügen habe.«
»Leo Wechsler, Kriminalpolizei.«
»Ah, Gennats berühmte Truppe.«
»Er ist ein Genie, wir haben ihm viel zu verdanken. Sie operieren aber nicht nur Nasen, Herr Professor, nicht wahr? Ich erinnere mich an Berichte über Kriegsversehrte, denen Sie auf geradezu wunderbare Weise geholfen haben.«
»Lassen Sie mal den Professor weg«, sagte Joseph und bestellte noch ein Glas Wein. »Heutzutage mache ich meist Schönheitsoperationen, aber ich habe manchem Soldaten wieder ein Gesicht gegeben. Nicht unbedingt das alte, dazu waren die Verwüstungen oft zu groß, aber ein Gesicht. Das kann schon helfen.«
Leo erinnerte sich an Fotografien, die er nach dem Krieg gesehen hatte, und begriff, dass Joseph seine Verdienste bewusst herunterspielte.
»Diese Menschen haben Ihnen viel zu verdanken.«
»Auch ich habe dabei gewonnen. Der Krieg hat mich vor Aufgaben gestellt, die mir im zivilen Leben nie begegnet wären.« Er beschrieb eine Geste, die den ganzen Saal umfasste. »Eigentlich bin ich nur meiner Frau zuliebe hier. Solche Festlichkeiten liegen mir nicht, aber Leonore wollte so gerne kommen, weil sie sich spannende Kriminalgeschichten aus erster Hand erhoffte.« Er reckte den Hals. »Wo steckt sie denn? Sie könnten ihr vielleicht den Gefallen tun und einen Ihrer Fälle schildern, damit sie nicht enttäuscht nach Hause geht.«
Leonore Joseph gesellte sich bald zu ihnen, und Leo fasste kurz den Fall der beiden Schwestern Henriette Strauss und Rosa Lehnhardt zusammen, der vor einigen Jahren großes Aufsehen erregt hatte. Mitten in der anschließenden Plauderei warf er einen Blick zu Clara hinüber.
Er stellte hastig sein Glas weg, nahm den Saft und verabschiedete sich eilig vom Ehepaar Joseph.
Clara war blass, sie hatte die Lippen aufeinandergepresst. Leo trat neben sie, reichte ihr das Glas und schaute den Mann im Frack an – maßgeschneidert, nicht aus dem Verleih wie seiner –, der vor ihr stand.
»Guten Abend, Herr von Malchow. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Drei Jahre?«
»Herr von Malchow hat mein Kleid bewundert«, sagte Clara.
»Ich wusste gar nicht, dass Sie ein Auge für Damenmode haben«, sagte Leo.
»Ihr Fall im letzten Jahr war spektakulär genug, um meinen Blick dafür zu schärfen, Herr Wechsler.«
»Mein Fall?«
Von Malchow legte den Kopf schräg und sah ihn verschwörerisch an. »Sogar ich erkenne einen Fink-Rücken, wenn er eine so bezaubernde Form annimmt.«
»In der Tat, mein Kleid ist von Morgenstern & Fink«, sagte Clara.
»Wie praktisch, dass Ihre Gattin sich bei der Firma einkleiden konnte, die von Ihren Ermittlungen profitiert hat.«
Leo wollte antworten, spürte aber, wie sich Claras Finger um seinen Arm schlossen.
»Ich kenne Sie nicht, Herr von Malchow, und weiß nicht, was mein Mann oder ich Ihnen getan haben, dass Sie uns etwas Derartiges unterstellen. Nicht dass ich mich rechtfertigen müsste, aber das Kleid habe ich von meinem Geld bezahlt, nicht von dem meines Mannes, und der Kriminalfall hatte nichts damit zu tun. Es ist Verleumdung, einem Beamten grundlos Bestechlichkeit vorzuwerfen.« Sie hielt inne. »Eigentlich tun Sie mir leid. Können Sie sich selbst so wenig leiden, dass Sie anderen Menschen so begegnen müssen?«
Herbert von Malchow war in der Menge untergetaucht, noch bevor Clara den Satz beendet hatte.
Leo nahm ihr das Glas ab und stellte es einem vorbeigehenden Kellner aufs Tablett. Dann ergriff er ihre Hände. Er hätte sie lieber umarmt, aber der Raum war voller Menschen, und das war etwas, das er nicht mit ihnen teilen wollte.
»Lass uns nach draußen gehen.«
Sie fanden einen Flur, in den nur leise Fetzen von Musik und Stimmen drangen. Dort zog er Clara an sich und spürte, wie sie zitterte.
»Ich bin stolz auf dich. Deine Antwort war beherrscht und würdevoll. Ich hingegen wäre beinahe aus der Rolle gefallen.«
»Es war demütigend«, sagte sie leise an seiner Schulter. »Er kam und sprach mich an. Ich wusste zuerst gar nicht, wer er war. Er hat mich von oben herab taxiert, als stünde ich zum Verkauf, und sagte dann, das sei aber kein Kleid von der Stange. Er war so unhöflich, dass mir die Worte fehlten.« Sie löste sich von Leo und wischte sich über die Augen. »Er hat mir die Freude daran verdorben.«
»Liebes, das ist er nicht wert. Er ist ein Versager, der bei der Polizei nicht die erhoffte Karriere gemacht hat und jetzt beim Schwiegervater den Geschäftsmann spielt.«
Sie rührte sich nicht.
Leo hob sanft ihr Kinn an. »Da ist noch etwas anderes, oder? Sag es mir.«
Sie zuckte mit den Schultern. »Ach, es ist dumm. Aber … er hat mich an früher erinnert. An Ulrichs Freunde. Die sind mir ähnlich herablassend begegnet. Als wäre ich nur das wert, was mein Mann in mich investiert hat. Als würden sie mich ansehen und schätzen, wie viel ich ihn gekostet habe.«
Sie hatten lange nicht über Ulrich von Mühl, Claras ersten Mann, gesprochen, und Leo hasste von Malchow dafür, dass er sie an ihn erinnert hatte. Doch sein Zorn half niemandem weiter.
Er legte behutsam die Hände um ihr Gesicht. »Wir gehen jetzt zurück in den Saal, und alle werden denken, wie wunderbar du in diesem Kleid aussiehst. Ich werde stolz auf dich sein, aber nicht wegen eines Stücks Stoff, sondern weil du diesem Kerl so tapfer entgegengetreten bist. Dann holen wir uns etwas zu trinken, und ich stelle dich einem netten Ehepaar vor, das ich vorhin kennengelernt und einfach stehen gelassen habe, als ich dich mit von Malchow sah. Einverstanden?«
Clara zögerte einen Moment und nickte dann. Sie trat vor den nächsten Spiegel, warf einen flüchtigen Blick hinein und kehrte mit Leo in den Saal zurück.
Auf dem Heimweg nahmen sie ein Taxi. Clara lehnte sich ein wenig beschwipst an Leo.
»Weißt du, was Frau Joseph mir erzählt hat? Seine Patienten zahlen das, was sie sich leisten können. Die Reichen viel, die Armen wenig und manchmal sogar nichts. Ist das nicht großartig? Und er hat ein Album mit Hunderten von Bildern, die seine Patienten vor und nach der Operation zeigen. Aus dem kann man sich die Nase aussuchen, die man gerne hätte.«
»Hat er dir etwa vorgeschlagen, mal vorbeizukommen, um deine Adlernase zu bearbeiten?«, fragte Leo lachend, worauf Clara ihn mit dem Fuß anstieß.
»An meiner Nase hatte er überhaupt nichts auszusetzen.«
Leo zog sie an sich. »Du hast recht, sie ist perfekt.«
»Es war genau richtig, dass wir geblieben sind und du mich den Josephs vorgestellt hast«, sagte sie. »Nach der Begegnung mit diesem widerlichen Mann hätte ich mich am liebsten zu Hause verkrochen, aber es wäre falsch gewesen. Und die Josephs sind sehr sympathisch. Er wirkt ein wenig zurückhaltend. Vielleicht gehört er zu den Menschen, die erst nach und nach ihre Scheu ablegen.«
»Er hat gesagt, er begebe sich nur seiner Frau zuliebe in Gesellschaft. Er ist kein Salonlöwe wie ich.«
Clara sah ihn mit gespielter Verwunderung an. »Oh, gehen wir jetzt öfter in Frack und großer Robe aus? Dann muss wohl eine Erbtante sterben, damit ich nicht zweimal im selben Kleid erscheine.«
Sie lachten noch, als sie die Wohnung betraten.
Clara schaute zu den Kindern hinein. Beide schliefen, neben Maries Bett stand der Chemiebaukasten, mit dem sie noch experimentiert hatte. Clara lächelte.
Im Bett sagte Leo, als hätten sie das Gespräch nie unterbrochen: »Er muss viel Elend gesehen haben, während des Krieges und danach. Er hat Menschen ebenso gerettet wie die Chirurgen in den Lazaretten, die Arme und Beine amputiert haben.«
Clara drehte sich zu ihm und stützte den Kopf in die Hand. »Ganz sicher. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sein muss, ein entstelltes Gesicht zu haben, sich nicht mehr unter Menschen zu wagen, Schmerzen zu leiden und angegafft zu werden.«
Leo räusperte sich. »Ich erinnere mich an einen Selbstmord, es muss 1919 gewesen sein. Ein Mann hatte sich in einem Hinterhof an der Teppichstange erhängt. Irgendwann in der Nacht. Eine Nachbarin fand ihn am nächsten Morgen. Als ich hinkam, sagte sie nur: ›Ick weeß nich, wie der hieß. Mit dem wollte keener reden. Die Kinner ham immer Dreck jeworfen und ›Atze-Fratze‹ jerufen.‹ Der Fall war schnell geklärt.«
Clara schmiegte sich an ihn und legte den Kopf auf seine Brust. »Wie klein so ein von Malchow dagegen wirkt.«
»Er ist klein und jämmerlich. Das sollten wir nie vergessen.«
Sie schliefen eng umschlungen ein. Irgendwann nachts meinte Leo die Wohnungstür zu hören, doch richtig wach wurde er nicht. Seufzend drehte er sich zu Clara um und schlief weiter.
2
Montag, 9. Januar 1928
Der verschlissene Mantel schützte kaum vor der eisigen Luft, die sich unter den Stoff stahl und seinen Körper umhüllte. Er war mit Kälte überzogen wie eine Mandel mit Schokolade oder ein Kuchen mit Glasur oder ein Bratfisch mit Panade … unsinnige Gedanken, die bewiesen, dass man das, was einen quälte, nicht verdrängen konnte, es brach sich immer wieder Bahn. Denn unter der Kälte lauerte der Hunger, zwei Empfindungen, die eine unselige Verbindung eingegangen waren. Wer hungerte, fror. Wer fror, hatte oftmals nichts zu essen.
Aus einem Lokal wehte Bratengeruch herüber, und er musste sich zwingen, nicht hineinzustürzen. Er wäre fähig, sich mit Ellbogen durchzukämpfen, hin zu dem Tisch, an dem jemand den Braten auf dem Teller hatte, den Gast beiseitezustoßen und das Fleisch mitsamt der Soße aufzuklauben und sich in den Mund zu stopfen … Aber er hatte fast kein Geld, und dort drinnen waren Menschen.
Die Welt war ihm fremd geworden.
Er stolperte mehrmals, weil er seine Füße nicht mehr spürte, nachdem er den ganzen Weg gelaufen war, in der Tasche den Zeitungsartikel, so oft gelesen und wieder zusammengefaltet, dass die Kanten brüchig und abgegriffen waren.
Er wählte die Kälte. Sie war weniger schlimm als das Fremde, weniger schlimm als der Hunger, der seinen Kopf ganz leer machte.
Er erreichte einen weiten Platz mit einer Säule in der Mitte und schaute auf das Straßenschild. Belle-Alliance-Platz. Er erinnerte sich an den Zeitungsverkäufer und seinen Stadtplan, rief sich die Namen ins Gedächtnis. Ja, die Richtung stimmte. Hier zweigten mehrere Straßen ab, die hell und lebhaft wirkten. Sie waren voller Menschen. Menschen wollte er aus dem Weg gehen.
Also hielt er sich am Ufer des Kanals, wo die Hochbahn am Wasser entlangratterte, hinter den erleuchteten Fenstern verwischte Schemen von Gesichtern.
Hallesches Ufer. Das war gut. Es klang, als wäre es nicht mehr weit. Sein Bein schmerzte, und er spürte, wie er zu hinken begann.
Als er den Platz hinter sich gelassen hatte, wurde die Gegend verlassener. Hier ging nur vor die Tür, wer wirklich musste. Alle anderen saßen am Ofen, Brot und Wurst auf dem Tisch, vielleicht eine Suppe mit Speck und Markknochen, warm und herzhaft und …
Schluss damit, schalt er seine Gedanken, als wären sie ungezogene Kinder. Fast hätte er gelacht, konnte sein Gesicht aber nicht bewegen. Ach ja, die Kälte.
Als er die Eisenbahnbrücke bemerkte, hielt er inne. Das tat er immer, wenn er Züge und Schienen sah. Nicht die Hochbahn, die war harmlos, aber die großen Züge, die weite Strecken fuhren, durch fremdes, ödes Land, vor denen fürchtete er sich.
Aber er brauchte nicht bis zu den Zügen zu gehen, er konnte vorher rechts abbiegen. Wo war er hier? Möckernstraße? Ja, da war das Schild.
Die Straße, die sich vor ihm auftat, war breiter und belebter, links gesäumt von Gleisen, die zu einem großen Bahnhof strebten wie Adern zu einem Herzen. Nein, das war kein guter Vergleich, denn das Herz war nicht das Ende, der Bahnhof aber schon.
Manchmal wollte er seine verrückten Gedanken aufschreiben, um sie Jelena mitzuteilen. Doch er vergaß sie, noch bevor der Stift das Blatt berührte. Seltsam, wie einem die Wörter entflohen, sobald man sie ergreifen wollte.
Er schrak zusammen, als links von ihm ein Zug pfiff. Er hielt sich die Ohren zu, und ein Mann, der ihm entgegenkam, tippte sich im Vorbeigehen an die Schläfe. Eine Geste, die ihn hätte kränken können, doch die Furcht vor den Zügen war größer.
Er wusste kaum noch, wie er es nach Berlin geschafft hatte. Vage erinnerte er sich, dass er in einer Ecke in der dritten Klasse gekauert hatte, die Hände auf den Ohren, die Augen geschlossen, während Jelena den Mitreisenden mit Gesten zu verstehen gab, er sei nicht krank, er fürchte sich nur.
Er stolperte weiter, die Hände über den Ohren, bis er auf einem Platz stand, der so hell und laut und voller Menschen und Autos und Omnibusse war, dass er sich an eine Hauswand drücken und tief atmen musste. Dort war der Bahnhof, gewaltig, mit Säulen vor dem Eingang, darum herum große Häuser, viele vornehm, alle strahlend erleuchtet in der Nacht.
Er sah sich hilflos um. Dies war nicht seine Stadt, und dieser geschäftige Ort am allerwenigsten. Er machte ihm Angst.
Da war ein Straßenschild: Askanischer Platz. Er war zu weit gelaufen und machte erleichtert kehrt.
Er ging ein Stück zurück und fand die Nebenstraße, die er vorhin übersehen hatte.
Hallesche Straße.
Er war am Ziel.
»Das ist nicht dein Ernst!«, rief Robert Walther und stieß beinahe sein Glas um. »Er hat Clara unterstellt, sie würde sich ihre Kleider von Morgenstern & Fink bezahlen lassen? Der Kerl ist ein noch größeres Schwein, als ich dachte.«
Leo trank aus und stellte sein Glas ab. »Gibt es irgendetwas auf dieser Welt, das du von Malchow nicht zutraust?«
Walther grinste. »Eigentlich nicht. Aber jetzt, wo er nicht mehr bei der Polizei ist, könnte er dich in Ruhe lassen.«
»Womöglich sehnt er sich nach den aufregenden Tagen in der Abteilung A zurück. Beim Schwiegervater im Büro sitzen und Papierwaren verkaufen ist sicher nicht so spektakulär wie die Arbeit bei der Kripo.«
Walther gab dem Wirt ein Zeichen, er solle noch zwei Weiße bringen. »Das siehst du falsch, Leo. Er ist ein wichtiger Mann. Verkaufsdirektor Inland, wie man mir sagte, zuständig für das gesamte Deutsche Reich. Das macht sich gut auf der Visitenkarte. Und politischen Ehrgeiz sagt man ihm auch nach. Wart’s ab, der landet noch im Kabinett.«
Sie saßen in der Kneipe Ecke Emdener und Turmstraße, gegenüber von Leos Wohnung. Clara hielt an diesem Abend einen ihrer Literaturvorträge.
»Ist schon angenehm, abends einfach mal rauszugehen, was? Wenn ich daran denke, wie schwierig es früher war mit dir und Ilse, als Georg und Marie noch klein waren.«
Leo sah ihn nachdenklich an. »Hast du eigentlich mal an Kinder gedacht? Du bist doch schon eine Weile mit Jenny zusammen.«
Sein Freund zuckte mit den Schultern. »Sie hat andere Pläne. Nächste Woche Vorsingen in einer Revue in der Friedrichstraße. Das könnte der Durchbruch sein. Keine verrauchten Bühnen und engen Hinterzimmer-Garderoben mehr.«
»Als wir bei Sonnenschein zu Hause waren, hast du den kleinen Samuel eine halbe Stunde rumgetragen.«
Ihr Kollege Jakob Sonnenschein war im Juli Vater geworden.
Walther lachte. »Ja, er hat mir mit großen Augen zugehört, während du und Jenny mir ständig ins Wort gefallen seid. Endlich mal jemand, der mich ansieht, als hätte ich das Rad erfunden. Und das Auto noch dazu. Aber ich war auch ganz froh, als ich ihn wieder zurückgeben konnte. Nein, so bald wirst du mich nicht vor dem Altar erleben. Oder am Taufbecken.«
Leo lehnte sich zurück. »Es hat schon etwas für sich, wenn sie aus dem Gröbsten raus sind.«
Die Tür ging auf und ließ einen Schwall eisiger Luft herein, als Leos Nachbar Joachim Kern die Kneipe betrat. Er kam an ihren Tisch und blies sich in die Hände. »Verdammt, ist das kalt.«
Er stellte seine Sammelbüchse ab und setzte sich, nachdem Leo ihm einen Stuhl hingeschoben hatte. Dann winkte er dem Wirt. »Bier und Korn.« Er nickte zu der Büchse. »Kommt nicht viel rum bei dem Wetter, obwohl es gerade jetzt nötig wäre. Wir sammeln für Familien, die kein Geld zum Heizen haben. Selbst während der Inflation waren die Leute spendabler.«
»Eben drum«, meinte Walther. »Meist sind die Leute großzügiger, wenn alle wenig haben. Sobald es ihnen besser geht, wollen sie bewahren, was sie haben.«
»Übrigens, Leo, ich habe vorhin deinen Jungen gesehen.«
»So spät noch?«
»An der Markthalle, mit dem Jungen von Müllers aus der Bremer Straße.«
»Wolfgang.«
Kern nickte. »Nicht dass sie Unsinn gemacht hätten. Standen nur da und redeten eifrig mit einem älteren Burschen, den ich nicht kannte.«
Leo nahm sich vor, Georg darauf anzusprechen. Er ließ ihn an der langen Leine und war bisher nicht enttäuscht worden, doch für einen Vierzehnjährigen war sein Sohn sehr häufig unterwegs.
Es konnte nicht mehr weit sein. Er blieb vor einem stattlichen Gebäude stehen, an der Fassade rankte Efeu empor und neben der Tür war eine Messingtafel mit der Aufschrift »Askanisches Gymnasium Berlin-Kreuzberg« angebracht. Als er das Wort Gymnasium las, war ihm, als ertönte von fern das Hämmerchen eines Glockenspiels und ließe tief in seinem Inneren etwas erklingen. Er sah an dem Gebäude hoch, dessen dunkle Fenster wie wachsame Augen auf ihn herabschauten. Er schüttelte sich und ging ein paar Schritte weiter zum nächsten Haus. Sah auf die Hausnummer.
Ein eleganter weißer Bau mit Erkern und einer prachtvollen Tür, über der eine große Laterne hing. Wo sollte denn hier … hatte er sich doch geirrt? Suchend schaute er an der Hauswand empor und wünschte sich einen Moment, er wäre bei Tageslicht hergekommen, aber nein, der helle Tag machte ihm Angst, abends war besser. Die Nacht war sein Freund. Dann bemerkte er den Torbogen weiter links. Und daneben ein Schild, klein und diskret, als kündigte es etwas an, das Eingeweihten vorbehalten war.
Im Innenhof war es etwas heller. Er fand sich vor einem Gebäude aus rotem Backstein wieder, durch dessen Fenster, die an eine Kirche erinnerten, schwacher Lichtschein fiel.
Da verließ ihn der Mut. Wenn man ihn nun hinauswarf, ihn trat und schlug und anschrie, so wie sie es … Nein. Er machte sich ganz steif, als könnte ihm das Kraft verleihen. Er war von weither gekommen. Und es waren nur noch wenige Meter.
Er näherte sich der Tür. Ein altmodischer Messingklopfer, ein Ring in einem Drachenmaul. Der Drache hatte spitze Zähne, das Maul schien höhnisch zu grinsen.
Er streckte die Hand danach aus, zaghaft, als könnte es gleich zuschnappen.
Da wurde die Tür von innen aufgestoßen. Eine Frau stürzte heraus, die Hand vor den Mund gepresst, und prallte fast gegen ihn. Er konnte gerade noch ausweichen und hinter der offenen Tür Schutz suchen.
Die Frau lief ein paar Schritte und erbrach sich auf den Boden.
Er drückte sich an die kalte Hauswand, erschrocken und ratlos. Sollte er hinlaufen und ihr helfen oder die Gelegenheit nutzen und sich ins Gebäude stehlen … Während er noch zögerte, hörte er, wie jemand aus der Tür kam.
Ein Mann eilte mit einem Mantel über dem Arm zu der Frau und sprach auf sie ein. Worte waren nicht zu verstehen, aber er konnte sehen, wie der Mann ihr den Mantel um die Schultern legte und ein Taschentuch reichte, ihr die Haare aus dem Gesicht strich. Dann legte er ihr den Arm um die Schultern und führte sie behutsam aus dem Innenhof.
Gleich darauf wurde die Tür von innen zugezogen.
Er hatte Zeit. Auf ein paar Stunden kam es nicht mehr an. Zeit wollte man nur dann nicht verschwenden, wenn man sie mit Schönem füllen konnte, und für ihn gab es schon seit Langem wenig Schönes.
Er lehnte an der Mauer, taub vor Kälte. Nun, da er ganz still stand, konnte er Geräusche von drinnen vernehmen. Dann und wann einen Aufschrei. Einen Knall, als würde ein schwerer Schrank umkippen. Einmal meinte er, irres Gelächter zu hören.
Ein Fenster im Vorderhaus ging auf, eine wütende Männerstimme verlangte Ruhe und drohte mit der Polizei.
Er wartete weiter.
3
Freitag, 13. Januar 1928/ Samstag, 14. Januar 1928
Albrecht Rüster fegte den Vorraum des Theaters und brummte dabei ungehalten vor sich hin. Erstaunlich, wie viel Dreck sich hier sammelte. Warum konnten die feinen Herrschaften die Papiertüten, in denen Nüsse und Konfekt verkauft wurden, nicht in die Abfalleimer werfen statt einfach auf den Boden?
Und das war nicht das Schlimmste. Erst vor ein paar Tagen hatte er wieder eine Bescherung im Hof beseitigen müssen, nachdem sich die Nachbarn beim Chef beschwert hatten. Wieso erledigten die Leute das nicht auf der Toilette?
Der Chef war ein anständiger Kerl, hatte Rüster aber ziemlich barsch zum Saubermachen aufgefordert.
»Wie sieht das denn aus, wenn tagsüber jemand Karten kaufen will? Und wir müssen auf die Nachbarn Rücksicht nehmen. Die dürfen nicht in solche Pfützen treten, wenn sie morgens zur Arbeit gehen.«
Sie hätten es ja auch gleich am Abend beseitigen können. Er war nur von acht bis sechs Uhr da, das reichte für einen Mann von dreiundsechzig. Aber er hatte pflichtschuldig den Eimer mit Seifenwasser gefüllt und war in den Hof geschlurft. Fünf Eimer hatte er auskippen müssen, bevor der Dreck verschwunden war, und die üppige Frau Moltke aus dem zweiten Stock hatte im Fenster gelegen und grinsend auf ihn herabgeschaut.
»Dit muss ja wieder ’n Meisterwerk jewesen sein, wa? Jöthe oder Schiller? Oder die jroße Schlachtplatte?«
Rüster fegte vor dem Eingang weiter. Er wusste, was der Chef wollte – schwache Beleuchtung am Abend, um das Gefühl des Unheimlichen zu verstärken, aber keinen Schmutz. Schmutz war ordinär, und genau das durfte sein Haus nicht sein. Immerhin hatte der Chef die Idee aus Paris mitgebracht.
Beim Fegen konnte man gut nachdenken. Er überlegte, was Luise wohl für ihn kochen würde, wenn er vom Dienst nach Hause kam. Er lebte bei seiner verwitweten Tochter und den beiden Enkelinnen. Luise kochte und wusch für ihn, er zahlte die Miete. Wenn sie tanzen ging, kümmerte er sich um die Kinder. Er hatte ihr nie gesagt, wo er arbeitete, nur dass er Hausmeister im Theater war. Es war nicht so, als hätte er eine Stelle im Bordell. Der Chef verdiente ehrliches Geld und somit auch Albrecht Rüster, doch es wäre ihm nicht recht gewesen, wenn Luise hier eine Vorstellung besucht hätte.
Sein Leibgericht vielleicht? Hackbraten mit einem hart gekochten Ei darin, dazu Feldsalat und Bratkartoffeln. Ihm lief das Wasser im Mund zusammen. Kürzlich hatte der Chef ihm ein paar Mark extra zugesteckt, und die hatte er Luise gegeben, damit sie bei Gelegenheit etwas Besonderes kochte.
Er fegte ganz automatisch, freute sich aufs Abendessen und bemerkte die junge Frau erst, als sie unmittelbar vor ihm stand.
Das Erste, was ihm auffiel, waren ihre Augen. Riesengroß und braun, mit goldenen Flecken darin, sie schienen ihr mageres Gesicht zu verschlingen. Eine braune Strickmütze, unter der die Haare verborgen waren, ein alter Mantel, zusammengehalten von einem rissigen Ledergürtel.
Rüster stützte sich auf den Besen und sah sie streng an. »Betteln und Hausieren verboten, junge Frau.«
Sie schüttelte den Kopf, deutete auf ihr Ohr. Konnte sie ihn nicht hören? Eine taube Bettlerin?
Sie schluckte. Ihr Schal war verrutscht, und er konnte sehen, wie sich ihr Kehlkopf bewegte. Dann holte sie Luft. »Ich … suche …«
»Sie suchen wen?«
Sie nickte, schien um Worte zu ringen. »Fjodor Mush. Mann … hier.« Eine Russin. Davon gab es viele in Berlin, er erkannte den Akzent.
»Ihr Mann ist hier gewesen? Wie sieht er denn aus? Wie heißt er?«
Die Frau schüttelte verzweifelt den Kopf. »Nicht … verstehen. Fjodor.« Sie sah ihn bittend an.
»Fjodor? Ist das der Mann, den Sie suchen?« Er deutete auf die Gebäude um sie herum.
Sie nickte eifrig und breitete die Arme aus, als wollte sie die ganze Wohnanlage umfassen. »Fjodor?«
Rüster schüttelte energisch den Kopf. »Den Mann kenn ich nicht. Der ist nicht hier.« Er sprach laut, ließ Pausen zwischen den Wörtern, als könnte sie ihn so besser verstehen.
Ihre Augen füllten sich mit Tränen, dann sprudelte ein Schwall russischer Wörter aus ihr hervor. Sie wollte an Rüster vorbei zur Eingangstür, doch er trat ihr in den Weg und schob sie sanft an den Schultern zum Torbogen.
»Wir haben hier keinen Fjodor. Ich muss jetzt meine Arbeit machen. Tut mir leid.« Dann fiel ihm ein, dass er eine Stulle von Luise in der Kitteltasche hatte. Er drückte der jungen Frau das Päckchen in die Hand.
Sie sah ihn an – verwirrt, beschämt – und ging mit gesenktem Kopf davon, das Butterbrot in der Hand.
»Herr Wechsler, gut, dass Sie da sind. Hier ist ein dringender Anruf.« Fräulein Meinelt hielt Leo schon den Hörer hin, als er am Samstagmorgen ins Vorzimmer trat. Er gab ihr ein Zeichen, das Gespräch durchzustellen, noch bevor er Hut, Mantel und Schal abgelegt hatte.
»Inspektion A, Oberkommissar Wechsler am Apparat.«
Zuerst hörte er nur schweres Atmen und warf Fräulein Meinelt, die mit einer Kaffeetasse in der Tür stand, einen fragenden Blick zu.
»Oberkommissar Wechsler«, wiederholte er. »Mit wem spreche ich? Worum geht es?«
»Hier spricht Otto Schmidt, Hausmeister am Askanischen Gymnasium.« Der Mann atmete immer noch schwer, beinahe asthmatisch. »Im Schuppen liegt einer.«
Leo trank einen Schluck Kaffee. »Könnten Sie das näher erklären? Ein Mann? Verletzt, betrunken, tot?«
»Tot. Darum ruf ich ja an.«
»Sie haben nicht die Schutzpolizei verständigt?«
Nun kam Leben in den Mann. »Damit es hier auf einmal vor Schupos wimmelt? Der Direktor hat gesagt, keine Unruhe unter den Schülern, besser sofort die Kripo anrufen. Das hab ich gemacht.«
Leo griff nach einem Notizblock. »Ganz ruhig, Herr Schmidt. Die Adresse, bitte.«
»Hallesche Straße 24–26.«
»Sind Sie sicher, dass der Mann tot ist? Sonst schicke ich einen Krankenwagen.«
Ein Schnauben am anderen Ende der Leitung. »Der ist tot wie nur was, Herr Oberkommissar, das sagt auch der Direktor.«
Der muss es ja wissen, dachte Leo sarkastisch. »Sie sorgen dafür, dass niemand den Schuppen betritt oder etwas anfasst, verstanden? Wir machen uns sofort auf den Weg.«
Er steckte den Kopf ins Nebenzimmer. »Jakob, kommst du? Und ruf Robert an, wir treffen uns in der Halleschen Straße 24–26, Askanisches Gymnasium. Ein Toter in einem Schuppen.«
Als Leo und Sonnenschein in der Halleschen Straße vorfuhren, waren keine Schüler zu sehen. Vermutlich saßen alle im Unterricht, wofür er dankbar war – ein Tatort, an dem sich Hunderte Jungen aufhielten, war ein Albtraum. Sie mussten die Schüler so weit wie möglich von den Ermittlungen fernhalten, um Panik und Unruhe zu vermeiden. Sollte eine Vernehmung der Schülerschaft erforderlich werden, würden sie weitere Kollegen anfordern müssen, um die Aufgabe zu bewältigen.
Er blieb vor dem Eingangsportal stehen und blickte am Haus empor – gelbe Schmuckfassade, Efeu, der daran emporrankte, eine ehrwürdige Schule, deren Frieden gestört worden war.
Ein älterer Mann mit dichtem Schnauzbart und Prinz-Heinrich-Mütze, der einen dicken Pullover unter dem grauen Kittel trug, öffnete ihnen die Tür.
»Sind Sie von der Polizei?«
»Herr Schmidt? Ich bin Oberkommissar Wechsler, das ist Kriminalassistent Sonnenschein. Gleich kommt noch ein weiterer Beamter dazu.«
Schmidt ging voran in die Eingangshalle, die, wie es sich für ein altsprachliches Gymnasium gehörte, mit Büsten bedeutender antiker Dichter und Philosophen dekoriert war. An einer Wand bemerkte Leo zwei große Bronzetafeln, auf denen die Namen der im Weltkrieg gefallenen ehemaligen Schüler verzeichnet waren.
»Hier entlang, meine Herren.«
Sie begaben sich zu einer Tür im hinteren Bereich der Halle. Der Hausmeister wollte sie öffnen, doch Leo sagte: »Einen Augenblick. Wir möchten Ihnen zunächst einige Fragen stellen.« Das konnten sie ebenso gut im Gebäude erledigen, das angenehm geheizt war.
Sonnenschein holte Stift und Notizbuch heraus.
»Sie sagten, der Tote liege in einem Schuppen. Um was für einen Schuppen handelt es sich?«
»Der steht auf dem Schulhof, an der Mauer zum Nachbargrundstück. Da sind Turngeräte für den Sommer drin: Holzreifen, Bälle, Kegel, Markierungen für Laufspiele und so weiter.«
»Mit anderen Worten, er wird um diese Jahreszeit nicht genutzt?«
Schmidt nickte.
»Wie kommt es dann, dass Sie den Toten gefunden haben?«
»Ich sollte für den Turnunterricht heute ein paar Springseile holen, in der Turnhalle waren nicht genug davon.«
»Ist Ihnen etwas am Schuppen aufgefallen? Hatte man die Tür aufgebrochen?«
»Nein, das Vorhängeschloss ist noch ganz. Ich hab aufgeschlossen, die Tür aufgemacht und ihn sofort da liegen sehen.«
»Ist Ihnen sonst etwas in der Umgebung des Schuppens aufgefallen?«
»Nein.«
Leo nickte Sonnenschein zu, der das Notizbuch einsteckte. »Gut, dann zeigen Sie uns den Fundort.«
Der Hausmeister führte sie auf den Schulhof, der rechts und links von Mauern begrenzt wurde. Unter den Bäumen standen Bänke, auf denen die Schüler ihre Pausenbrote essen konnten. Am Ende des Schulhofs befand sich ein weiteres Gebäude, das an die parallel verlaufende Kleinbeerenstraße grenzte.
»Was ist das dort?«, erkundigte sich Leo.
»Die Turnhalle und daneben die Wohnung vom Direktor«, antwortete der Hausmeister. Dann zeigte er auf den Schuppen an der linken Mauer auf halber Höhe des Schulhofs. Er maß etwa zwanzig Quadratmeter und bestand aus solidem grau gestrichenem Holz.
Leo drehte sich um und schaute am Schulgebäude hinauf. Im ersten Stock bemerkte er eine Gestalt am Fenster, die rasch beiseitetrat, als hätte sie seinen Blick bemerkt. Dann ging er vor der Tür des Schuppens in die Hocke und betrachtete das Vorhängeschloss, das der Hausmeister wieder vorgelegt hatte. Keine Anzeichen von Gewaltanwendung, weder am Schloss noch an der Tür.
»Wie viele Schlüssel gibt es?«
»Zwei. Einen an meinem Bund und einen Ersatzschlüssel. Der hängt im Hausmeisterraum im Keller.«
»Ist er noch da?«
»Ja. Hab sofort nachgesehen, Herr Oberkommissar.«
»Gut. Geben Sie mir bitte Ihren Schlüssel. Haben Sie Handschuhe getragen, als Sie Schloss und Tür angefasst haben?«
Schmidt schüttelte den Kopf.
»Dann brauchen wir Ihre Fingerabdrücke zum Abgleich. Notiere das bitte, Jakob.«
Leo, der selbst Handschuhe trug, öffnete das Schloss, gab Schmidt den Schlüsselbund zurück und öffnete die Tür. Kein elektrisches Licht. Er holte eine Taschenlampe aus dem Ausrüstungskoffer.
Der Mann lag auf dem Rücken. Er trug einen schäbigen, mehrfach geflickten Mantel, um den Hals einen handgestrickten Wollschal. Wollmütze mit Ohrenklappen. Die Sohlen seiner Stiefel waren fast durchgelaufen. Leo leuchtete den Holzboden ab.
»Ich nehme an, hier wird nur im Sommer gefegt, wenn der Schuppen benutzt wird?«
Schmidt zuckte mit den Schultern. »Ja, der Herr Direktor hat –«
Leo unterbrach ihn. »Das war keine Kritik an Ihrer Arbeit. Im Gegenteil, ich bin dankbar dafür. Jakob, schau mal her.« Er leuchtete den Bereich zwischen der Tür und den Füßen des Mannes aus, wo breite Streifen auf dem staubigen Boden zu erkennen waren.
»Ist er gekrochen?«
»Möglicherweise. Oder er wurde gezogen oder geschoben. Ich tippe auf Letzteres, weil keine Fußabdrücke zu sehen sind.« Leo betrat vorsichtig den Raum, bückte sich und schob die Finger unter den Schal des Mannes. Die Haut war eiskalt. Kein Puls. Er leuchtete sorgfältig Hals und Gesicht ab. Dann drehte er sich zu Sonnenschein und Schmidt um.
»Jakob, du rufst die Kollegen von der Schutzpolizei, der Schuppen wird abgesperrt, alle Lehrer, Mitarbeiter und Schüler werden befragt. Wir brauchen –« Er hielt inne, als Walther in den Hof geeilt kam.
»Gut, dass du da bist, Robert.« Leo sah den Hausmeister an. »Sie gehen zum Direktor und sagen Bescheid, dass wir gleich zu ihm kommen.«
»War es Mord?«, fragte Schmidt aufgeregt und wippte auf den Zehen.
»Sie haben mich gehört, Herr Schmidt.«
Leo wartete, bis der Mann außer Hörweite war, und deutete über die Schulter ins Innere des Schuppens. »Tod durch Erwürgen. Das Gesicht ist geschwollen, die Male am Hals sind eindeutig. Vermutlich wurde er nicht hier getötet. Keine Kampfspuren, nicht mal Fußabdrücke. Ich würde sagen, die Tür wurde geöffnet, die Leiche auf den Boden gelegt und hineingeschoben.« Er zögerte. »Und vermutlich liegt er schon länger dort. Mindestens einige Tage. Die Starre ist noch nicht ganz abgeklungen, aber das kann auch an der Kälte liegen.«
Walther deutete zum Schulgebäude hinüber. »Mensch, Leo, das kann aufwendig werden.«
Leo nickte. »Sämtliche Schüler, Lehrer und Angestellten sowie die Nachbarn der angrenzenden Häuser sind zu befragen. Bei den Schülern müssen wir behutsam vorgehen, denen können wir nicht die Leiche eines Erwürgten zeigen. Wir brauchen auf jeden Fall Verstärkung.«
4
Samstag, 14. Januar 1928
Nachdem ein Mannschaftswagen eingetroffen war und die Schupos begannen, Schulgebäude und Schuppen abzusperren, machten sich Leo und Walther auf den Weg zum Direktor. Sonnenschein saß im Vorzimmer bei der Sekretärin, die ziemlich blass aussah und ein Glas Wasser umklammert hielt. Als seine Kollegen hereinkamen, zog er eine Augenbraue hoch und machte eine kaum merkliche Kopfbewegung.
Leo folgte der Bewegung und bemerkte den Direktor, der auf der Schwelle seines Büros stand und die Kriminalbeamten indigniert anschaute, so als hätten sie persönlich den Toten im Schuppen deponiert.
Leo stellte sich und Walther vor.
»Professor Dr. Suhle, Schulleiter«, sagte der Mann knapp. Er trug eine runde Brille, ein Hemd mit Stehkragen und eine Uhrkette quer über der Weste. Der weiße Vollbart war sorgfältig gestutzt, seine ganze Erscheinung hätte auch aus der Kaiserzeit stammen können. »Dies ist eine Bildungsstätte, meine Herren. Ich kann nicht dulden, dass der Unterricht gestört wird, weil sich irgendein Landstreicher unseren Schuppen ausgesucht hat, um darin die Nacht zu verbringen, und anscheinend die Kälte unterschätzt hat.«
Leo hob die Hand. »Herr Direktor, meine Kollegen