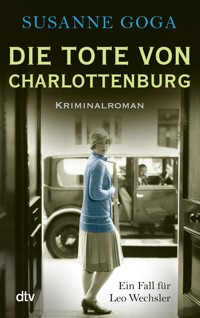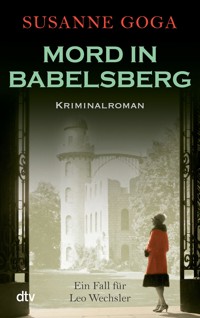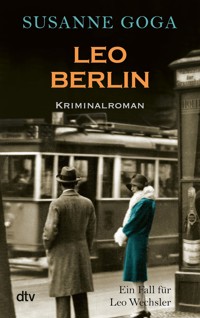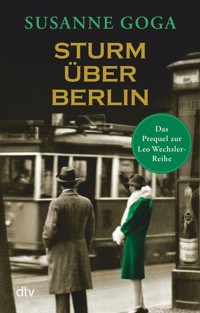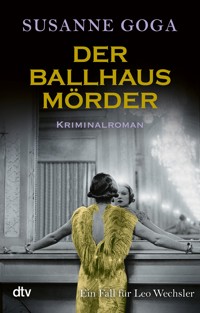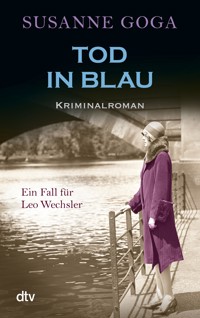
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Krimi
- Serie: Leo Wechsler
- Sprache: Deutsch
Mord im Berlin der zwanziger Jahre 1922. Arnold Wegner malt seine Zeit in starken Kontrasten – Armut und Luxus, Krieg und Vergnügungssucht, Krankheit und Irrsinn. Seine radikalen Bilder, in denen er sich provokant mit der Gesellschaft und der jüngsten Vergangenheit, dem Ersten Weltkrieg, auseinandersetzt, erregen Bewunderung und Abscheu, lassen aber niemanden kalt. Als der Maler tot in seinem Atelier gefunden wird, führt eine erste Spur Kommissar Leo Wechsler zur rechtsextremen Asgard-Gesellschaft, in der viele ehemalige Offiziere verkehren. Gibt es möglicherweise auch eine Verbindung zu dem Toten im Landwehrkanal, bei dem ein Schriftwechsel mit der Asgard-Gesellschaft gefunden wurde? Die Ermittlungen kommen nicht recht voran, bis Leo Wechsler einen Hinweis von der avantgardistischen Tänzerin Thea Pabst erhält. Und es stellt sich heraus, dass es einen Zeugen gibt – der jedoch entzieht sich allen Befragungen durch die Polizei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
Susanne Goga
Tod in Blau
Kriminalroman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Ungekürzte Ausgabe 2014
© 2007 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
eBook ISBN 978-3-423-41190-5 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-21487-2
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Websitewww.dtv.de/ebooks
Für meine Familie
1
September 1922
»Zwei Anzüge, vier Hemden, mehrere Kragen, drei Krawatten, dazu Wäsche, Socken und ein Sommermantel.« Kriminalkommissar Leo Wechsler durchsuchte die Taschen von Mantel und Jacketts. »Zwei saubere Taschentücher, ein Zelluloidkamm, eine Dose Hustenpastillen. Das ist alles. Wie sieht es bei dir aus?«
Sein Kollege Kriminalsekretär Robert Walther reagierte nicht sofort. Er kniete vor dem Bücherregal und zog ein schmales Heft heraus. Dann drehte er sich um. »Schau dir bloß dieses Zeug an.« Er blätterte in einer Broschüre und hielt sie Wechsler hin. »Hast du so was schon mal gesehen?«
Leo nahm das Heft, das aus billigem Papier mit Fadenheftung bestand. Auf dem Umschlag reichte eine blonde, blauäugige Frau mit langen Zöpfen einem Mann mit Wikingerhelm ein blitzendes Schwert. An der Hand führte sie ein kleines Mädchen, das ebenso blond und blauäugig wie seine Eltern war. Aus dem Himmel über ihnen schleuderte eine mächtige Faust Blitze nieder. Der Weg zur Reinheit von Dr. Franz Kesselmann, Untertitel: Eine Einführung in die ariogermanische Lebensphilosophie.
Als Nächstes zog Walther ein gebundenes Buch hervor. »Oder das hier: Was uns die Götter sagen wollen – germanische Mythen neu gedeutet.« Walther schüttelte den Kopf. »Wer liest nur solch abstrusen Kram?«
Leo ging in die Hocke und zog einen Stapel Zeitungen unter einem Regal hervor. »Derselbe, der die hier gelesen hat.«
Walther warf einen Blick auf die Titelseite. »Völkischer Beobachter? Nie gehört.«
Leo deutete auf die Zeile darunter. »Nennt sich auch Kampfblatt der nationalsozialistischen Bewegung Deutschlands und wird von irgendeinem rechten Verein aus Bayern herausgegeben. Ich glaube, er heißt NSDAP oder so ähnlich.«
»Wer soll bei diesen ganzen Parteien noch den Überblick behalten? Lauter Abkürzungen, die kann sich doch kein Mensch merken.«
Leo stand achselzuckend auf. »Mir scheint, der junge Mann hegte ziemlich eindeutige politische Vorlieben. Fragt sich nur, ob er deswegen im Landwehrkanal gelandet ist. Wir nehmen die Zeitungen mit, ebenso diese Germanenbücher. Gut möglich, dass er Mitglied in einer Vereinigung oder Partei war, in der so etwas gelesen wird. Viele sind Spinner, aber es gibt auch gefährliche Leute unter ihnen, ehemalige Offiziere und Freikorpskämpfer. Mal sehen, ob wir damit weiterkommen. Ach ja, da wäre noch der Schreibtisch.«
Vermutlich ein Erbstück, dachte Leo, denn der Tote, ein gewisser Carl Bremer, war Verkäufer in einer Konfektionshandlung gewesen und hätte sich von seinem schmalen Gehalt wohl kaum einen so schönen antiken Schreibtisch leisten können. Auf der Platte lag eine lederne Schreibunterlage, die Beine waren aufwendig gedrechselt, die Schubladen mit Zierbeschlägen versehen.
Die Leiche des jungen Mannes war vor vier Tagen im Landwehrkanal gefunden worden. Als Todesursache wurde zwar Ertrinken festgestellt, doch ließ der rechtsmedizinische Befund, der eine Kopfwunde erwähnte, die Ermittler aufhorchen. Entweder hatte sich der Mann beim Sprung in den Kanal am Kopf verletzt oder aber er war überfallen und niedergeschlagen worden. Da man ihn zunächst nicht identifizieren konnte, hatte man den Toten wie üblich im Leichenschauhaus in der Hannoverschen Straße ausgestellt.
Zwei Tage später hatte sich die Dienststelle A 3, die für die Ermittlung in Fällen vermisster Personen und unbekannter Toter zuständig war, bei Leo gemeldet. Ein gewisser Emil Hancke, Besitzer eines alteingesessenen Konfektionsgeschäfts in Westend, habe eine Vermisstenanzeige erstattet, da ein Angestellter seit mehreren Tagen unentschuldigt der Arbeit ferngeblieben und auch nicht zu Hause anzutreffen sei. Man hatte ihn ins Leichenschauhaus bestellt, wo er den Toten tatsächlich als seinen Verkäufer Carl Bremer identifizierte.
Leo setzte sich auf den Schreibtischstuhl und öffnete nacheinander die Schubladen. Er fand Schreibzeug, Werbeprospekte für Haarwuchsmittel und neuartige Hemdkragen, die haltbar und hautfreundlich zugleich sein sollten, dazu Briefmarken und eine Dose mit billigen Manschettenknöpfen, die vorgaben, aus Perlmutt, Onyx und Gold zu sein. Gewiss war es nicht einfach für Bremer gewesen, in einem Konfektionsgeschäft elegante Herrenmode zu verkaufen und sich dabei angemessen zu kleiden. In der untersten Schublade entdeckte Leo eine Korrespondenzmappe.
»Robert, die nehmen wir auch mit, dafür brauchen wir Zeit. Anscheinend hat er wahllos alle Briefe hineingestopft.«
Im Wagen schlug Leo sein Notizbuch auf. »Also, was sagt uns die Wohnung? Bremer war ordnungsliebend, wenn es nicht gerade um die Aufbewahrung seiner Korrespondenz ging. Politisch eher rechts stehend, mit einem Hang zum Germanentum.«
»Und das ist noch vorsichtig ausgedrückt.«
»Wir wissen nicht, ob er tatsächlich Verbindungen in solche Kreise unterhielt oder das Zeug einfach nur aus Neugier gelesen hat.«
Walther sah ihn zweifelnd an. »Normalerweise bist du nicht so zaghaft.«
»Und verbrenne mir jedes Mal den Mund«, meinte Leo. »Warten wir ab, was wir in den Briefen finden.«
Emil Hancke war ein distinguierter älterer Herr, dem man den täglichen Umgang mit seiner eleganten Kundschaft deutlich anmerkte. Er war reichlich blass, obwohl der Besuch im Leichenschauhaus bereits einen Tag zurücklag, und betupfte sich den Schnurrbart mit einem blütenweißen Taschentuch. Leo bot ihm einen Platz und ein Glas Wasser an.
»Ich weiß, Wasserleichen sind kein schöner Anblick. Daher danke ich Ihnen, dass Sie sich die Mühe gemacht und den Toten identifiziert haben. Wir haben bereits seine Wohnung durchsucht, möchten von Ihnen aber möglichst viel Persönliches über Herrn Bremer erfahren.«
»Er arbeitete seit drei Jahren in meinem Haus. Untadeliges Verhalten, beliebt bei unseren anspruchsvollen Kunden. Daher war ich auch sehr verwundert, als er mehrere Tage lang nicht zur Arbeit erschien. Es kann sich nur um einen Unfall handeln, das sehen Sie gewiss genauso.«
Leo ließ sich nicht gern von Zeugen vorschreiben, was er zu denken hatte, und sagte ungerührt: »Immer langsam, Herr Hancke. Ein Unfall ist mehr als unwahrscheinlich. Es kommt ausgesprochen selten vor, dass jemand versehentlich in den Kanal fällt, es sei denn, er wäre sturzbetrunken. Wahrscheinlicher ist ein Selbstmord oder Mord.«
Hancke blickte entsetzt hoch und betupfte sich erneut den Mund. »Selbstmord? Völlig ausgeschlossen. Ein aufrechter Mann von anständiger Gesinnung wie Herr Bremer würde doch nie …«
Leo horchte auf, da er sich an die zweifelhafte Literatur erinnerte, und hob die Hand. »Wie genau meinen Sie das mit der Gesinnung, Herr Hancke?«
Der Geschäftsmann hüstelte verlegen und rückte etwas näher an den Tisch heran. »Herr Kommissar, Sie können sich nicht vorstellen, welche Propaganda heutzutage unter den Angestellten kursiert. Roter Schund, kommunistische Pamphlete, Aufrufe zum Umsturz. Das kann ich mir bei meinen Kunden nicht leisten. Erst letzten Monat musste ich einen Schneidergesellen entlassen, der solche Machwerke im Atelier verbreitet hat. So etwas hätte der Bremer nie getan. Genau das meine ich mit anständiger Gesinnung.«
»Danke für die Erläuterung«, sagte Leo trocken. Er öffnete eine Schreibtischschublade und breitete die fragwürdige Lektüre des Toten auf dem Tisch aus. »Deckt sich das vielleicht mit seiner Gesinnung?«
Hancke schaute von einem Titelblatt zum nächsten und schüttelte dann verwundert den Kopf. »So etwas habe ich nie bei ihm gesehen, Herr Kommissar. Ich wusste nicht, dass er solches … solches Geschreibsel las.«
Hier war offensichtlich nichts weiter über die politischen Aktivitäten Bremers zu erfahren. »Fällt Ihnen vielleicht dennoch ein möglicher Grund für einen Selbstmord ein? Geldsorgen? Oder enttäuschte Liebe?«
Hancke überlegte. »Nun ja, da war eine junge Frau, die hat Bremer ab und zu von der Arbeit abgeholt. Sie wartete immer an der Haltestelle gegenüber, damit es nicht so auffiel. Ich habe es natürlich bemerkt, doch da Herrn Bremers Verhalten stets untadelig war, bin ich nicht eingeschritten.«
»Wissen Sie, wie sie heißt?«
»Zufällig ja. Bremer hat sie mir vor einigen Wochen vorgestellt. Er führte sie an der Hand ins Geschäft herein, ein wenig verlegen, aber strahlend, es war geradezu rührend. Fräulein Maria Hagen, so lautete der Name.«
»Können Sie die Dame beschreiben?«
»Sicher, so alt sind meine Augen nun auch wieder nicht«, meinte er lächelnd. »Etwa eins sechzig groß, schlank, braunes Haar, das sie ziemlich kurz trägt, geschminkt, aber nicht ordinär. Er erwähnte noch, sie sei Platzanweiserin in einem Lichtspielhaus.«
»Haben Sie die beiden danach noch einmal zusammen gesehen?«, fragte Leo.
»Nein, das habe ich nicht. Ob es zu einem Zerwürfnis gekommen ist, kann ich nicht sagen, da ich mich nicht in die persönlichen Angelegenheiten meines Personals zu mischen pflege.« Er klang plötzlich distanziert. »Ich möchte Sie bitten, die ganze Sache diskret zu behandeln, Herr Kommissar. Mein guter Ruf ist mein größtes Kapital, und wenn bekannt würde, dass einer meiner Angestellten auf anrüchige Weise ums Leben gekommen ist …«
»Wir gehen so diskret wie möglich vor, Herr Hancke, aber wenn es sich um eine Gewalttat handelt, hat die Aufklärung Vorrang.« Dann fiel Leo noch etwas ein. »Wissen Sie, ob Herr Bremer etwas besaß, das von Wert war? Schmuck, eine teure Uhr oder dergleichen?« Bei der Leiche waren keinerlei persönliche Wertgegenstände gefunden worden.
Hancke nickte beflissen. »Er trug immer eine goldene Taschenuhr an einer Kette. Ich glaube, er erwähnte einmal, sie sei ein Konfirmationsgeschenk. Von wem, weiß ich allerdings nicht.«
»Gut. Sie haben sicher nichts dagegen, wenn wir uns in den nächsten Tagen auch mit Ihren Angestellten unterhalten.«
Nüchtern betrachtete Arnold Wegner die nackten Frauenkörper. Wie schnell man sich an derartige Auftritte gewöhnte. Noch vor wenigen Jahren wären solche Darbietungen in guter Gesellschaft undenkbar gewesen; heutzutage galt es als schick, zu einem schlüpfrigen Tanzabend zu bitten. Im Rhythmus der Musik entblößten die Tänzerinnen ihre Oberkörper, bevor sie sich wieder in die transparenten Schleier hüllten. Ihre Scham war notdürftig hinter Blumengestecken verborgen.
Er registrierte alles mit kühlem Blick, konstatierte, machte sich im Geist Notizen. Sein Besuch war eher beruflicher Natur. Hier sammelte er Eindrücke, legte sie in der Erinnerung ab, um sie wieder hervorzuholen, wenn er im Atelier vor der kahlen Leinwand stand, vor einem Blatt Papier saß, den Bleistift in der Hand hielt oder, was seltener vorkam, sich an einem Aquarell oder einer Tuschezeichnung versuchte. Manchmal fragte er sich, ob Leonardo oder Michelangelo mit ähnlich nüchterner Distanz ans Werk gegangen waren wie er. Andererseits hatten sie nicht Menschen in Tanzdielen und Likörstuben, in Stehbierhallen und billigen Bordellen porträtiert, sondern mythische Figuren, griechische Götter, Gott selbst. Oder müsste er mehr Mitgefühl empfinden? Nein, sagte er sich, das war etwas für Vater Zille und die Kollwitz. Er hingegen suchte und malte die Nachtgestalten, die Ausgehungerten, die jene Nahrung suchten, die keine Lebensmittelkarte bieten konnte. Die Getriebenen, deren gehetzte Blicke er erbarmungslos einfing. Die ausländischen Prasser, die mit Geld nur so um sich warfen, die genau wussten, wo man in Berlin für ein paar Dollar alles kaufen konnte.
Er sah sich im Salon um. Bemerkte die begehrlichen Blicke der anderen Männer. Ein älterer Herr sog versonnen an der Zigarre, die in seinem Mundwinkel hing. Arnold unterdrückte ein Grinsen und nahm ein Glas Champagner von einem Silbertablett. Wenn die Kreislers darauf bestanden, ihn als Vertreter der Boheme einzuladen, konnte er nicht gänzlich abstinent bleiben. Immerhin galt er als skandalöser Künstler und genoss diesen Ruf, der ihm ungeahnte Möglichkeiten eröffnete. Frauen, die unerreichbar schienen, wollten plötzlich von ihm gemalt werden, obgleich sie nicht wissen konnten, wie schmeichelhaft das Porträt ausfallen würde. Er war dafür bekannt, dass er in seinen Bildern nicht das Äußere, sondern das Innenleben seiner Modelle zu spiegeln suchte. Und manchmal war das Innere sehr viel hässlicher als die schöne Hülle.
Er sah sich im Raum um, immer auf der Suche nach einem anregenden Motiv. Es waren nicht viele Damen anwesend, doch er malte auch gern Männer, vor allem ältere Herren, die er meist verzerrt und karikierend darstellte, als Opfer ihrer Leidenschaften, der Angst vor dem Alter. Niemand entging seinem kritischen Blick – nicht der Offizier, der Uniform trug, obwohl die Zeiten vorbei waren, in denen man damit gesellschaftlich glänzen konnte; nicht der Fabrikant mit dem gezwirbelten Kaiser-Wilhelm-Bart, der sich das Monokel ins Auge klemmte, um die losen Damen besser zu erkennen. Als der Auftritt vorbei war, erklang begeisterter Applaus, und die Tänzerinnen mussten dreimal herauskommen und sich verbeugen.
Wegner sah auf die Uhr. Er könnte noch in die »Weiße Maus« gehen oder in die »Palette«, um Freunde zu treffen. Als er gerade mit dem Gedanken spielte, sich den Mantel geben zu lassen, trat die Gastgeberin Charlotte Kreisler in die Mitte des Raums und klatschte in die Hände.
»Meine lieben Freunde, dürfte ich einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Nachdem uns die Damen vom Ballett Celly de Rheydt mit ihrer Darbietung erfreut haben, möchte ich Ihnen jetzt etwas ganz Besonderes präsentieren: eine junge Tänzerin, die erst am Anfang ihrer Karriere steht. Sie wird uns heute Abend eine Darbietung zeigen, die, wie sie sagt, aus dem Geist der Zeit geboren ist. Begrüßen Sie mit mir Thea Pabst und ihren Partner Stephan Castorff, die das Programm ›Inflation‹ für uns tanzen werden.«
Die Kronleuchter erloschen, ein gedämpfter Trommelwirbel erklang. Ein Scheinwerfer tauchte die improvisierte Bühne in goldenes Licht. Das Murmeln im Salon erstarb, alle Augen richteten sich auf den Vorhang, in dessen Spalt nun eine Hand erschien. Eine zarte Hand, ohne Schmuck, mit langen, schön geformten Fingern, die einen Geldschein hielten. Die Hand zuckte lässig, der Schein flatterte zu Boden. Die Spannung im Raum war beinahe greifbar.
Dann trat die Tänzerin ins Licht. Zart, fast knabenhaft, mit lockigem, honigblondem Haar, das sich eng an den Kopf schmiegte. Doch nicht ihr Kopf war es, der die Zuschauer in Bann schlug, sondern das Nichts von einem Kostüm. Kein Tüll, kein Gazeschleier, wie sonst bei derartigen Darbietungen üblich, sondern Geldscheine, die unmittelbar auf die Haut geklebt waren. Der Kontrast zwischen ihrer makellosen Gestalt und den Geldscheinen war so frappierend, dass selbst Wegner der Atem stockte. Er hatte Anita Berber mehr als einmal auf der Bühne erlebt, und Thea Pabst schien ihr mehr als ebenbürtig.
Es gab keine Musik außer der gedämpften Trommel. Die Tänzerin bewegte sich rhythmisch über das Parkett und strich sich über den beklebten Körper. Dann kam ein männlicher Tänzer hinzu, der eine Maske trug und dessen Körper ganz mit goldener Farbe bemalt war. Er umschlang die Tänzerin, zupfte bei jedem Schritt einen Geldschein ab. Manche fielen einfach zu Boden, andere warf er ins Publikum oder zerknüllte sie achtlos, einen entzündete er an der Zigarre eines überraschten Herrn im Publikum. Ihr nackter Körper war atemberaubend, sie verhüllte nicht einmal die Scham mit einem dekorativen Nichts. Der Schlag der Trommel wurde immer schneller, der Tanz immer wilder, bis die Tänzerin schließlich mit einem Aufschrei zu Boden sank, die Arme um den Kopf geschlungen. Der goldene Mann kniete sich hinter sie und streckte sich auf ihrem gekrümmten Rücken aus, bis er sie ganz bedeckte. Plötzlich löste sich ein Mechanismus an der hohen Salondecke und ließ einen ganzen Schauer aus Banknoten auf sie hinabregnen.
Die Einladung, die auch den soeben dargebotenen Tanz ankündigte, war auf handgeschöpftem Bütten mit zartem Wellenrand gedruckt. Arnold hatte bezweifelt, dass man die allgegenwärtige, überaus prosaische Geldentwertung in einen Tanz verwandeln konnte, und fand sich nun eines Besseren belehrt. Die Frau hatte ihm gefallen, außerordentlich gefallen. Er würde sie gern malen.
Als Thea Pabst in einem roten Kleid, zu dem sie eine lange, auffällige Kette aus schwarzem Bakelit trug, im Salon erschien, applaudierten die Gäste erneut. Sie dankte mit einer angedeuteten Verbeugung und nahm das Glas Champagner, das die Gastgeberin ihr anbot.
»Wo ist Ihr Tanzpartner, Fräulein Pabst?«, erkundigte sich Charlotte Kreisler.
»Herr Castorff lässt sich entschuldigen, aber er hat heute Abend noch einen weiteren Auftritt«, entgegnete sie mit einer überraschend tiefen Stimme, die gar nicht zu ihrer zarten Erscheinung passte. »Er wäre gern geblieben. So müssen Sie leider mit mir vorliebnehmen.«
Arnold trat wie beiläufig hinzu, da er hoffte, der Tänzerin vorgestellt zu werden. Was auch geschah.
»Fräulein Pabst, Sie gestatten – Arnold Wegner, der bekannte Maler.«
Thea Pabst streckte ihm die Hand hin. »Sehr erfreut. Ich habe einige Bilder von Ihnen gesehen. Sie haben mir Angst gemacht.«
»Warum?«, fragte Arnold überrascht.
»Mir scheint, Sie blicken durch die Menschen hindurch. Sie sehen, was die Leute denken. Und das spiegelt sich dann in ihren Gesichtern.« Sie schaute ihn an, als hätte sie etwas Dummes gesagt. »Leider verstehe ich nicht viel von Malerei.«
»Wer tut das schon? Am wenigsten die Leute, die von sich behaupten, große Kunstkenner zu sein.«
»Das ist beim Tanzen ganz ähnlich«, sagte sie mit wiedergewonnener Selbstsicherheit. »Wirklich verstehen kann man es nur, wenn man es selbst versucht hat.«
»Ihr Inflationstanz hat mich sehr beeindruckt, Fräulein Pabst«, erklärte der Maler mit einer leichten Verbeugung. »Ganz und gar ungewöhnlich, etwas so Profanes wie Geldentwertung im Tanz auszudrücken.«
»Es ist eben eine neue Richtung«, erklärte die Tänzerin. »Anita Berber hat ›Rauschgift‹ getanzt, das war ein großer Erfolg. Sie konnte ja auch aus Erfahrung schöpfen«, fügte sie ein wenig boshaft hinzu.
»Sind Sie dem Laster des weißen Pulvers noch nicht verfallen?«, fragte Wegner, zündete sich eine Zigarette an und hielt ihr das Etui hin.
»Nein, ich hab es mal probiert, aber es hat mir gar nichts gegeben. Ich behalte lieber einen klaren Kopf. Ich kenne genügend Leute, die völlig vor die Hunde gegangen sind. Betteln nachts in den übelsten Kaschemmen um ein bisschen Koks. Das ist nichts für mich.«
Ein Mädchen mit klarem Verstand, dachte der Maler. Ein netter Kontrast zu ihrem verruchten Auftritt. Er gab ihr Feuer und wollte die Streichholzdose einstecken, als sie seine Hand ergriff. »Darf ich mal sehen?«
Bereitwillig reichte er ihr die Dose.
»Die ist aber hübsch.« Ein flaches Döschen aus mattem Silber, in das genau eine Schachtel Streichhölzer passte. Die angerauten Seiten dienten als Reißfläche. Schlicht, aber wunderbar zweckmäßig.
»Eine Erinnerung«, sagte Wegner.
»Verraten Sie mir auch, woran?«
»An Paris. Noch vor dem Krieg. Ich würde gern mal wieder hinfahren.«
»Warum tun Sie es nicht?«
Wegner lächelte. »Ich kann zwar vom Verkauf meiner Bilder leben, obwohl es mich manchmal wundert, dass sich die Leute Bilder in den Salon hängen, die ihnen so wenig schmeicheln. Reich bin ich dabei allerdings nicht geworden. Und Paris ist teuer.«
»Passen Sie gut auf die Dose auf.«
»Das werd ich.« Er steckte sie wieder ein. »Ich würde Sie gern malen.«
Sie sah ihn überrascht an. »Sie haben mich doch gerade erst kennen gelernt.«
»Es war ja auch kein Heiratsantrag«, meinte er lachend, was Thea Pabst keineswegs aus der Fassung brachte. Gut so, dachte er, eine Frau, mit der man vernünftig reden kann. »Ich würde Sie gern so malen, wie Sie eben getanzt haben.«
Sie lächelte spöttisch. »Mit oder ohne Geldscheine?«
»Das überlege ich mir, wenn es so weit ist. Meist kommen mir solche Ideen ganz spontan.« Er zog eine Karte aus der Tasche. »Ich habe ein Atelier in den Rehbergen. Wie wäre es mit übernächstem Sonntag? Nachmittags bin ich immer dort anzutreffen.«
»Sie warten nicht gern, was?«
»Wenn ich mich zu etwas entschließe, schiebe ich es nicht vor mir her«, sagte er und hielt ihr die Karte abwartend hin. Sie überlegte kurz und griff danach. Er bemerkte ihre Hand, ohne Ringe, ohne den blutroten Nagellack, den viele Frauen heutzutage bevorzugten, mit gepflegten, kurzen Nägeln. Sicher, ein Heiratsantrag war es nicht gewesen. Aber es würde ein Genuss sein, sie zu malen.
2
Es war ein schöner Abend, noch mild, doch lag schon ein Hauch von Herbst in der Luft. Leo Wechsler machte einen Umweg über die Arminius-Markthalle, um zu sehen, was er dort für sein Geld bekommen konnte.
In dem schönen gelb-rot gemauerten Bau drängten sich die Menschen an den Marktständen. Durch den breiten Mittelgang fuhren die Lieferanten mit Pferdewagen, Handkarren und sogar Hundegespannen, um die Händler mit Waren zu versorgen. Heutzutage bekamen viele Arbeiter den Lohn mehrmals im Monat ausgezahlt, weil das Geld immer schneller an Wert verlor. Wer keine Lebensmittelmarken mehr besaß, musste ordentlich draufzahlen, frei verkäufliches Brot kostete dreimal so viel wie Markenbrot. Leo schüttelte den Kopf, als er die Schilder sah, auf denen immer wieder neue Beträge durchgestrichen waren. Manche Händler hatten lieber Kreidetafeln aufgestellt, die sie nur abwischen mussten, wenn die Preise wieder stiegen.
An einem Gemüsestand blieb Leo stehen und schaute sich die Auslage an. Die Marktfrau, die aus einem dampfenden Emaillebecher trank, begrüßte ihn herzlich. »Sie hab ick ja lang nich jesehn. Was darf’s denn sein? Ick hab schönen Wirsing und Weißkohl, janz frisch vom Feld. Süße Äpfel, die kann ick nur empfehlen. Für die Dame des Hauses vielleicht, zum Backen?«
Leo lächelte. Ilse backte gerne Apfelkuchen, er würde ihr zwei Pfund mitnehmen. Die Marktfrau packte die Äpfel in eine Papiertüte. »Den Wirsing müssen Se sich wohl untern Arm klemmen. Ick hoffe, der schöne Mantel wird nich dreckich.«
»Danke, es geht schon.« Leo bezahlte und wandte sich zum Eingangsportal mit dem Spitzbogen. Er brachte seiner Schwester gelegentlich persönliche Kleinigkeiten oder Dinge für den Haushalt mit, um das empfindliche Gleichgewicht, in dem sie lebten und das mühsam erkämpft war, zu wahren.
An diesem Abend begrüßte sie ihn allerdings mit einer Bitte, die ihn seine Mitbringsel sehr schnell vergessen ließ.
»Ich möchte, dass du jemanden kennen lernst, Leo«, sagte Ilse Wechsler, als sie ihrem Bruder das Abendessen hinstellte. Leo schaute sie überrascht an.
»Natürlich, wen denn?«
»Er heißt Bruno Schneider. Wir haben uns schon öfter getroffen, aber ich wollte ihn dir erst vorstellen, wenn wir uns besser kennen.«
Leo wusste, dass sich seine Schwester seit dem Sommer ein paarmal in einem Café oder zum Spazierengehen verabredet hatte. »Lade ihn doch für nächsten Sonntag zum Kaffee ein«, sagte er spontan und tauchte eine Pellkartoffel in den Schnittlauchquark auf seinem Teller.
»Hast du einen Freund, Tante Ilse?«, fragte Marie neugierig. »Ist das der, den wir mal im Park getroffen haben?«
Ilse errötete ein wenig und machte sich am Schrank zu schaffen. »Ja, Liebes, der ist es.«
»Der mit dem schicken Auto?«, fragte Georg und grinste seinen Vater an.
»Kinder, es reicht, ihr macht eure Tante ganz verlegen«, tadelte Leo die beiden, konnte sich aber ein Lächeln nicht verkneifen.
Marie rutschte von ihrem Stuhl, lief ins Kinderzimmer und kam mit einem Briefumschlag zurück, den sie ihrem Vater stolz hinhielt. »Guck mal, ich hab Post bekommen. Von der Inge, vom Bauernhof.«
Inge Matusseks Vater, ein Schuster aus der Nachbarschaft, hatte vor einigen Monaten seine Frau getötet und wartete seitdem in Tegel auf seine Hinrichtung. Die kleine Tochter der beiden war bei Verwandten untergekommen, die einen Bauernhof nördlich von Berlin besaßen. Ab und zu schickte sie Marie Wechsler selbstgemalte Bilder und kleine Nachrichten, die ihre Tante für sie geschrieben hatte. »Eine Kuh, ein Schaf, ein Hund«, riet Leo, als er die Buntstiftzeichnung betrachtete.
»Nein«, lachte Marie und deutete auf das schwarz-weiße gehörnte Tier links im Bild. »Das ist eine Ziege. Sieht man doch.«
»Ich finde, es sieht aus wie eine Kuh, aber wenn du meinst …«
Als sie fertig gegessen hatten, schickte Leo die Kinder aus der Küche, zog Weste und Kragen aus und half seiner Schwester beim Abräumen. Obwohl er dem Besuch von Bruno Schneider so bereitwillig zugestimmt hatte, fühlte er sich nicht ganz wohl in seiner Haut, denn er hatte den Gedanken, Ilse könne einen Mann kennen lernen und heiraten wollen, lange verdrängt.
»Gut, ich halte mir den Sonntag auf jeden Fall frei«, sagte er beiläufig. »Sollen wir Kuchen aus der Konditorei holen?«
Ilse schüttelte den Kopf. »Ich backe lieber selbst. Du hast doch die schönen Äpfel mitgebracht, die sind genau richtig.«
Später, als Ilse zu Bett gegangen war, stand Leo nachdenklich am Wohnzimmerfenster und sah auf die stille, dunkle Straße hinunter.
Manchmal hatte er sich vorgestellt, wie es wäre, wieder zu heiraten. Eine Frau, die auch mit den Kindern auskam. Doch dazu musste er sich erst verlieben; nur um der Kinder willen zu heiraten kam für ihn nicht in Frage. Dann allerdings, und hier schloss sich der Kreis, wäre Ilse allein. Sie war nach Dorotheas Tod zu Leo gezogen, um dessen mutterlose Kinder zu betreuen, undenkbar, dass sie mit einer neuen Schwägerin die Wohnung teilen würde.
Im Hinausgehen bemerkte Leo ein Buch auf dem Tisch. Märchen von Hans Christian Andersen. Er schlug es auf. Innen ein Stempel mit der Aufschrift LEIHBÜCHEREI CLARA BLEIBTREU. Er klappte es zu und strich flüchtig mit der Hand über den Einband.
Zuerst hatte es Arnold Wegner gestört, als der Junge vor dem Fenster auftauchte, die Hände in den Taschen der zerschlissenen Hose, den Mund offen und ein wenig verwundert. Im Mai war er zum ersten Mal vor dem Atelier erschienen und hatte unverwandt hineingestarrt. Er unternahm keinen Versuch, hereinzukommen oder Arnold anzusprechen, sondern betrachtete durch die Scheibe das geordnete Chaos, das im Atelier herrschte, Staffelei, Einmachgläser mit Pinseln, ein Sammelsurium verschiedener Spachtel, buntfleckige Tücher und Kittel, die an einer einfachen Holzleiste hingen. Den rohen Holztisch mit den beiden Stühlen; die Chaiselongue, die mit einem bunten orientalischen Tuch bedeckt war; den hohen dreiteiligen Spiegel.
Nach einer Woche trat der Junge zum ersten Mal in die Tür. Die Maitage waren schon warm, und es wehte ein angenehmer Duft von grünem Gras und jungem Laub herein. Wegner hatte gerade seinen Pinsel in ein kräftiges Ultramarinblau getaucht, als ihn eine leise, ein wenig raue Stimme von hinten ansprach.
»Was malst du da?«
Arnold Wegner drehte sich um, die Palette in der Hand. »Einen See.«
»Und wo ist der?«
Wegner zeigte auf seine Stirn. »Hier drin.«
Der Junge sah ihn verwirrt an. »Du musst doch sehen, was du malst.«
»Nicht unbedingt. Ich kann auch aus der Erinnerung malen, zum Beispiel einen See, den ich irgendwann einmal gesehen habe. Schau her.« Er deutete auf eine Leinwand, die in der äußersten Ecke des Raums hing und ein graues Haus in einem großen Garten mit blühenden Bäumen zeigte. »Das Haus meiner Eltern. Es wurde abgerissen, aber ich habe immer noch im Kopf, wie es vor dreißig Jahren ausgesehen hat. Und so habe ich es auch gemalt.«
Der Junge trat interessiert näher. »Aber das sieht alles so schief und durcheinander aus.« Er blickte Wegner besorgt an, als hätte er etwas Falsches gesagt, doch der Maler lächelte nur.
»Es ist auch kein genaues Abbild des Hauses. Ich malte es so, wie ich das Haus empfunden habe, als ich ein Kind war.« Er legte die Palette weg und wischte sich die Hände an einem Lappen ab. »Na komm, ich erklär’s dir.«
Er zeigte auf die Fenster. »Die Fenster auf meinem Bild sind sehr klein, kleiner als in Wirklichkeit. Weil ich immer das Gefühl hatte, nicht genug von der Welt draußen zu sehen. Das Haus ist grau, wirkt aber düsterer, als es tatsächlich war. Nur ich selbst habe es als düster und beengend empfunden und deshalb so gemalt. Der Garten hingegen ist bunt und schön, weil ich mich gern an ihn erinnere. Oft habe ich mich in einem Baum verkrochen, hoch oben in einer Astgabel, und mir vorgestellt, in einem fernen Land zu sein. Während meine Mutter mich vergeblich zum Abendessen rief und immer wütender wurde.«
»Meine Mutter ist manchmal auch wütend«, sagte der Junge unvermittelt und schaute ihn aus großen Augen an.
Wegner las in ihnen eine Kindlichkeit, die nicht zu dem Körper des etwa zwölfjährigen Jungen passte.
»Manche Leute auf deinen Bildern sehen ganz hässlich aus«, meinte der Junge und schaute Wegner von der Seite fast ein wenig herausfordernd an.
»Viele Leute sind hässlich.«
»Aber nicht so hässlich.« Er zeigte auf ein halbfertiges Porträt, das einen ungeheuer fetten Mann mit Zwicker darstellte. Seine Hängebacken waren blaurot, die Nase knollig, die Ohren ausladend wie die Henkel einer Suppenterrine. Er trug einen Straßenanzug, dazu aber eine Reihe Orden auf der Brust. Die Haut an Stirn und bartlosem Kinn glänzte speckig.
»Oh doch«, meinte Wegner, »von innen schon. Menschen können innen oder außen hässlich sein. Manche auch beides. Das Gute an denen ist, dass man sie sofort erkennen kann.«
»Ist der Mann nicht böse, wenn du ihn so malst?«, fragte der Junge.
»Er weiß nicht, dass ich ihn gemalt habe. Manchmal male ich Leute, die ich in der Straßenbahn gesehen habe. Oder auf dem Rummelplatz. Wenn mir jemand auffällt, merke ich mir das Gesicht, die Gestalt, auffällige Dinge wie fehlende Körperteile, ein Hinken, schlechte Zähne.«
»Ich dachte, Bilder müssen schön sein.«
»Das denken viele Leute. Aber ich kann nur so malen und nicht anders.«
Der Junge sah zu Boden.
»Was ist denn los?«
»Ich … wie bin ich denn? Innen hässlich oder außen?«
Einen Moment lang wusste Wegner keine Antwort, fühlte sich seltsam angerührt von der Frage. »Ich glaube, du bist gar nicht hässlich. Jetzt muss ich aber weitermachen.«
»Darf ich mal wiederkommen?«
»Natürlich.«
Als der Junge langsam, beinahe widerwillig, zur Tür schlenderte, rief Wegner ihm noch nach: »Wie heißt du eigentlich?«
»Paul, Paul Görlich.«
Seither war er öfter gekommen und hatte meist schweigend zugesehen, wie Wegner malte. Der Maler hatte sich an seine Gesellschaft gewöhnt und blickte bisweilen beim Arbeiten über die Schulter, als erwarte er, Paul in der Tür zu sehen.
Wegner trat vor die Staffelei und betrachtete die angedeuteten Linien, die er mit Bleistift vorgezeichnet hatte. Dann schaute er zu der blau grundierten Skizze, die auf dem Tisch lag, und schüttelte den Kopf. Er griff zum Radiergummi und entfernte säuberlich den begonnenen Entwurf. Die Skizze kam seiner Vorstellung schon sehr nahe, nun musste er den Ausdruck der Gesichter, Qual und brutale Ekstase, auf die größere Leinwand übertragen. Und würde sich alle Zeit der Welt dafür nehmen.
Denn bei diesem Bild würde er ganz frei sein. Diesmal würde er nicht malen, was er auf den Straßen und in den Salons sah, sondern eine Erinnerung, die seit kurzem wieder an die Oberfläche drängte und ihm keine Ruhe ließ. Eine Erinnerung voller Gewalt, intim und roh, die nicht das Gemetzel auf dem Schlachtfeld zeigen würde und dennoch ungeheuren Sprengstoff barg.
3
Oktober 1922
Beim Sonntagskaffee herrschte unbehagliches Schweigen, das Leo durchbrach, indem er sich nach Bruno Schneiders Automobil erkundigte. Ein Leuchten ging über dessen Gesicht.
»Ein toller Wagen, Herr Wechsler, da kann ich einfach nicht bescheiden sein.« Er strahlte übers ganze Gesicht, und Leo musste zugeben, dass Schneiders unverhohlener Besitzerstolz nicht unsympathisch war. »Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit Fräulein Ilse eine Spritztour darin zu unternehmen.«
Du lieber Himmel, dachte Leo, sollte Ilse diesmal das große Los gezogen haben? Der Mann hatte ein frisches, offenes Gesicht und war gut gekleidet, der perfekte Kavalier bis hin zur Nelke im Knopfloch.
»Und wie schnell fährt er? Ich habe wenig Erfahrung mit Automobilen, da ich selbst keins besitze«, sagte Leo und warf seiner Schwester einen ermutigenden Blick zu.
»Er macht so seine siebzig Sachen«, erwiderte Bruno Schneider mit einem bescheidenen Lächeln.
»Verraten Sie mir, wie man es in diesen Zeiten zu solchem Wohlstand bringt«, meinte Leo und fügte hinzu: »Nehmen Sie noch von dem Apfelkuchen, den bäckt niemand besser als meine Schwester.«
Ilse sah ihn beschwörend an, als wollte sie sagen, übertreib es nicht, doch ihr Gast lehnte sich behaglich zurück. »Geschäftsgeheimnis, Herr Wechsler. Nein, im Ernst, ich bin Kaufmann und nutze meine Verbindungen. Geschäftsauflösungen, Nachlässe, dabei konzentriere ich mich auf Schmuck, Bilder, Antiquitäten. Hauptsache, es ist nicht aus Papier und mit Zahlen bedruckt.«
»Das ist klug«, meinte Leo. »Uns Beamten bleiben solche Möglichkeiten leider versagt.«
Bruno Schneider nahm sich noch ein Stück Kuchen. »Kompliment, Fräulein Ilse, eine echte Delikatesse.« Dann wandte er sich wieder an Leo. »Dafür dürfte Ihre Arbeit aber sehr viel spannender sein als meine. Verbrecherjagd und so weiter. Haben Sie nicht vor kurzem einen Doppelmörder gefasst? Irgendetwas mit einem Wunderheiler und einem Straßenmädchen?«
»Ja, das ist richtig, es war einer der Fälle, die Schlagzeilen machen, vor allem, weil es ein illustres Mordopfer gab, aber das sind eher Ausnahmen. Ich fürchte, viele Leute haben eine falsche Vorstellung von unserer Arbeit. Meist sitzen wir im Büro über Akten oder klingeln an Haustüren, um Menschen zu befragen, die uns belügen oder sich mit Märchen wichtigtun«, meinte Leo lächelnd.
»Ach, Herr Wechsler, das kann ich nicht glauben.«
»Doch, doch, geniale Verbrecher wie dieser Dr. Mabuse sind nur Phantasiegestalten. Die meisten Kriminellen sind ganz gewöhnliche Menschen, vulgär, von Leidenschaften getrieben oder einfach nur verzweifelt.« Und genau das war es, was ihn an seinem Beruf faszinierte: die vielen unterschiedlichen Menschen, die Charaktere, denen er im Laufe der Jahre begegnet war. Die Gesichter, hinter denen so viele verborgene Gefühle lagen und die oft nur Masken waren für Schmerz, Hass oder dunkle Triebe.
Schneider beugte sich eifrig vor. »Ich habe ein interessantes Buch gelesen, in dem ein Arzt beschreibt, wie man das Verbrechen in der Welt ausmerzen kann.«
»Und welche Methode schlägt er vor? Vielleicht kann ich ja noch etwas von ihm lernen.«
»Nun, es war recht kompliziert«, plauderte Schneider unbekümmert drauflos, »und ziemlich wissenschaftlich. Aber es hatte mit einer neuartigen Operation zu tun, bei der man im Gehirn des Verbrechers die Stelle, die ihn zum Verbrechen treibt, praktisch ausschaltet.«
»Gut und schön, aber wie soll man verhindern, dass jemand überhaupt erst ein Verbrechen begeht? Das sieht man den Leuten vorher doch nicht an«, wandte Leo ein.
»Oh doch. Man kann an der Kopfform und den Gesichtszügen erkennen, ob jemand irgendwann gefährlich wird.«
»Diese Theorien sind Schnee von gestern«, erklärte Leo unwirsch, worauf Ilse ihm unter dem Tisch einen Tritt versetzte. »Verzeihung, aber es sind wirklich Methoden aus dem letzten Jahrhundert. Und jemanden gegen seinen Willen zu operieren dürfte mehr als schwierig sein. Außerdem ist es verboten.«
»Schade«, sagte Bruno Schneider und trank einen Schluck Kaffee. »Aber so ist das mit den Büchern, man weiß nie, ob man alles glauben kann, was darin steht. Ich für meinen Teil habe schon immer gern Kriminalgeschichten gelesen. Aber ein Fachmann wie Sie lacht sicher nur darüber, oder?«
Leo schob seinen Teller beiseite. »Nicht unbedingt. Zur Entspannung lese ich dann und wann auch Kriminalromane. Sherlock Holmes bereitet mir Vergnügen, auch wenn er sich ständig über die brave Polizei mokiert. Aber seine Methoden sind faszinierend.«
»Ja, das finde ich auch«, pflichtete Schneider ihm bei und blickte von Bruder zu Schwester. »Ich möchte mich noch einmal für diese Einladung bedanken. Und nicht nur wegen des hervorragenden Kuchens«, sagte er.
»Es wird sicher nicht das letzte Mal sein, wenn ich meine Schwester so ansehe«, meinte Leo. Ilse errötete und begann schnell, den Tisch abzuräumen. Am nächsten Morgen war Leo früh im Büro und sah gemeinsam mit Robert Walther die Korrespondenz Carl Bremers durch. Auffallend war, dass er von seinen eigenen Briefen Durchschriften aufbewahrt hatte, was von einer gewissen Pedanterie zeugte. Es fanden sich ein paar kurze, belanglose Schreiben an seine Eltern, die in einem kleinen Ort bei Cottbus lebten, sowie deren besorgte und wohlmeinende Antworten. Anscheinend war ihr Sohn in die große Stadt gezogen, um sein Glück zu machen, die klassische Geschichte. Er hatte dort zwar kein Vermögen verdient, aber immerhin eine Anstellung in dem Konfektionsgeschäft gefunden, wo er wohlhabenden Kunden Kleidung verkaufte, die er sich selbst nicht leisten konnte. Nicht gerade befriedigend, doch er konnte froh sein, in dieser Zeit überhaupt eine Arbeit gefunden zu haben. Er hatte sich offenbar an diversen Preisausschreiben beteiligt und vor einigen Wochen schriftlich um eine Gehaltserhöhung ersucht, was abschlägig beschieden und mit der schlechten Wirtschaftslage erklärt worden war. Davon hatte der werte Herr Hancke allerdings nichts erwähnt.
»Hier, Leo, sieh mal.« Robert förderte eine abgerissene Eintrittskarte zutage. »Filmtheater Marmorhaus, Kurfürstendamm 236. Sagte Hancke nicht, die Freundin sei Platzanweiserin? Warum sonst sollte Bremer die Karte aufbewahren?«
Noch aufschlussreicher waren die Briefe, die Bremer an die Autoren seiner bevorzugten Lektüre gerichtet hatte – Leute wie ebenjener Franz Kesselmann, der forderte, die germanische Mythologie müsse das tägliche Leben durchdringen und formen.
Leo deutete auf ein Antwortschreiben. »Dem sollten wir vielleicht nachgehen.« Es stammte von einem gewissen Eduard von Bauditz, laut Briefkopf Gründer und Vorsitzender einer wissenschaftlichen Vereinigung mit Namen »Asgard-Gesellschaft«, und kam aus Leipzig.
Sehr geehrter Herr Bremer!
Verbindlichen Dank für das von Ihnen geäußerte Interesse an unserer wissenschaftlichen Gesellschaft. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass unser Mitgliederkreis eingeschränkt ist und nur Personen offensteht, die eine einschlägige wissenschaftliche oder journalistische Tätigkeit nachweisen können. Auch gebe ich zu bedenken, dass wir unsere Arbeit ausschließlich aus den Spenden unserer Mitglieder und Förderer finanzieren und daher strenge Richtlinien bei der Aufnahme zugrunde legen müssen.
Doch verweise ich Sie gern an Herrn Ulrich von Mühl, der mich während meiner Vortragstätigkeit hier in Leipzig vertritt und Ihnen für weiterführende Fragen gewiss zur Verfügung steht. Untenstehend finden Sie seine Anschrift und Rufnummer.
Hochachtungsvoll
E. v. Bauditz
»Was für eine Gesellschaft mag das sein?«, fragte Walther. »Der Name sagt mir gar nichts.«
»Ich vermute, sie beschäftigt sich ebenfalls mit germanischer Mythologie«, sagte Leo und warf einen Blick auf von Mühls Privatadresse. »Falkenried in Dahlem, das erklärt auch, warum die keinen Ladenburschen in ihrem Verein wollten.«
Der grüne, im Süden Berlins gelegene Vorort, der sich nach Westen bis zum Grunewald erstreckte, war für seine ruhigen, von eleganten Villen gesäumten Straßen bekannt.
»Wir sollten dem Herrn einen Besuch abstatten«, schlug Walther vor. »Auf nach Walhalla!«
»Ja, aber vorher gehe ich noch ins Kino«, erklärte Leo und griff nach seinem Hut.
Leo legte den Weg vom Alexanderplatz zum Kurfürstendamm mit einem Dienstwagen zurück, den er jetzt in einer Seitenstraße abstellte. Manchmal musste man nur ein Stück mit dem Auto fahren und gelangte so in eine andere Welt, ohne dass man sich aus Berlin hinausbewegt hätte. Er betrachtete das hektische Treiben auf dem Boulevard. Die Berliner schienen von einem Fieber angetrieben, das sie ruhelos vorwärtsdrängte, vom Taxi ins Geschäft, vom Büro ins Café, von der Praxis ins Restaurant. Das Filmtheater mit seiner eleganten Marmorfassade lag schräg gegenüber der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Bewundernd blieb Leo vor einem Plakat stehen, das den Film Der brennende Acker von Murnau ankündigte. Kein greller Aufmacher, sondern geradezu ein Kunstwerk, dunkler Hintergrund, als helle Flecken waren nur das Gesicht eines Mannes, eine Laterne und das blassweiße Gesicht und die Schulter einer jungen Frau im schwarzen Kleid zu erkennen.
Er betrat das großzügige Foyer, in dem sich um diese Tageszeit nur wenige Besucher aufhielten, und erkundigte sich an der Kasse nach Fräulein Hagen. Die Kassiererin blickte ihn streng an. »So etwas wird hier während der Dienstzeit nicht geduldet, mein Herr. Da ist der Direktor sehr streng.«
Leo grinste und nahm den Hut ab. »Es handelt sich nicht um einen privaten Besuch.« Er zeigte Marke und Ausweis vor. »Und keine Sorge, Fräulein Hagen hat sich nichts zuschulden kommen lassen.«
Die Kassiererin zog skeptisch die Augenbrauen hoch und deutete auf eine Verkaufstheke, hinter der eine junge Frau Süßigkeiten in einem Gestell anordnete. Leo bedankte sich und ging hinüber.
»Wer sind Sie?« Sie klang ein wenig verunsichert, als er sie mit Namen ansprach. »Ich … ich räume das hier auf, weil ich im Saal jetzt nicht gebraucht werde.«
»Ich komme nicht vom Direktor«, sagte er und stellte sich vor. »Es geht um Herrn Carl Bremer.«
Sie löste den Blick von den Erdnusstütchen, die sie gerade einsortierte, und schaute ihn erschrocken an. »Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen, Herr Kommissar. Ich habe Herrn Bremer seit einigen Wochen nicht gesehen.« Ihre grauen Augen sind bemerkenswert schön, dachte Leo beiläufig. Sollten die Herrn Hanckes Kennerblick tatsächlich entgangen sein?
»Warum nicht, wenn ich fragen darf?«
»Weil … muss ich wirklich darüber sprechen? Eigentlich geht es doch nur uns beide etwas an.«
Manchmal war der kürzeste Weg der beste. »Dann wissen Sie vermutlich noch nicht, dass man Herrn Bremer tot aus dem Landwehrkanal geborgen hat.«
Ihre Hand tastete nach dem Regal, das hinter ihr stand, griff aber ins Leere. Leo beugte sich über die Theke und stützte sie am Arm, zog einen Hocker heran und half ihr, sich zu setzen. »Es tut mir leid, Fräulein Hagen, aber es wäre besser, Sie erzählten mir alles.«
Sie griff sich an den Hals, als hätte sie Mühe zu schlucken. »Aber wie … War es ein Unfall?«
Es war wohl ein weit verbreiteter Irrglaube, dass ständig Menschen versehentlich in den Kanal fielen. Dabei waren Liebknecht und Luxemburg nicht die einzigen Mordopfer, die man dort herausgefischt hatte. »Wir gehen von einem Mord oder Selbstmord aus.«
»Das hat Carl nicht selbst getan.« Sie klang ähnlich überzeugt wie der alte Hancke. »Das passt nicht zu ihm.«
»Vielleicht hatte er Liebeskummer.«
Sie schüttelte den Kopf und wischte sich flüchtig über die Augen. »Ach was. Wir haben uns nicht im Streit getrennt. Wir hatten uns … ich meine, wir verstanden uns nicht mehr richtig.«
»Warum? War eine andere Frau im Spiel? Oder ein anderer Mann?«
Sie wurde ein bisschen rot und schüttelte den Kopf. »Nein. Aber Carl fing plötzlich an, solche eigenartigen Bücher und Zeitungen zu lesen, irgendwelches unsinnige Zeug über Germanen und Herrenmenschen und so weiter. Er hielt sich plötzlich für was Besseres. Ich habe das nicht richtig verstanden.« Sie dachte nach. »Einmal sind wir spazieren gegangen, da kam uns eine Familie mit einem schwachsinnigen Kind entgegen. Und Carl hat gesagt … wie war das noch … so was gehört ausgemerzt und was von schlechtem Blut. Er schien sich richtig zu ekeln.«
»Und darum haben Sie sich von ihm getrennt?«
»Ja, auch. Er hat nämlich nur noch dagesessen und gelesen, ist nicht mehr mit mir ausgegangen, hat mir nicht zugehört, keine Blumen mehr mitgebracht.« Sie wirkte aufrichtig enttäuscht. »Ich bin ja noch jung. Dafür war ich mir zu schade.« Sie besaß eine schlichte Würde, die Leo ziemlich überzeugend erschien.
»Wissen Sie, ob er zu einer Vereinigung oder Partei gehörte, zu Versammlungen ging? Kannten Sie seine Freunde? Bislang spricht nichts für einen Selbstmord, daher richten wir unsere Ermittlungen auf mögliche Feinde.«
Sie hob die Schultern. »Er hat nie etwas darüber erzählt. Wir kannten uns noch nicht so lange, ein halbes Jahr. Ach ja, da war so ein Kerl namens Egon, den hat er in letzter Zeit öfter erwähnt. Sie sind zusammen trinken gegangen und haben politisch geredet.«
»Wissen Sie seinen Familiennamen?«, fragte Leo und holte sein Notizbuch hervor.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, aber er wohnt bei Carl nebenan. Wenn Sie die Nachbarn fragen, finden Sie ihn sicher.«
Leo bedankte sich. Die junge Frau blickte besorgt zu der Kassiererin, die unverhohlen herüberstarrte.
»Fräulein Hagen, falls es Missverständnisse geben sollte, rufen Sie mich an.« Er legte seine Visitenkarte auf die Theke. »Ich verbürge mich für Sie.«
Sie steckte die Karte ein und machte sich daran, in Goldfolie verpackte Schokoladentafeln zu symmetrischen Stapeln aufzuschichten.
Die elegante cremeweiße Villa in Dahlem war von hohen alten Bäumen umgeben, deren Laub sich rotgolden gefärbt hatte.
Der würdevolle Diener, der Leo und Walther an der Tür empfing, war wie aus dem Ei gepellt. Frack, schwarz-gelb gestreifte Weste, blütenweißes Hemd. Er meldete sie an, und kurz danach trat Oberstleutnant Ulrich von Mühl durch eine hohe Flügeltür ins Empfangszimmer. Seine kerzengerade Haltung verriet den ehemaligen Offizier, sein Gesichtsausdruck, dass ihm Kriminalbeamte alles andere als willkommen waren. »Ja, bitte?«, fragte er kühl.
»Ich bin Kommissar Wechsler, das ist Kriminalsekretär Walther. Wir ermitteln im Todesfall Carl Bremer.«
»Der Name sagt mir nichts. Sollte ich den Herrn etwa kennen?« Von Mühl lehnte lässig im Türrahmen.
Leo ließ sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. »Wir fanden in seinen Unterlagen ein Schreiben von Herrn Eduard von Bauditz, in dem er den Verstorbenen an Sie verweist. Und zwar in Ihrer Eigenschaft als sein Stellvertreter bei der ›Asgard-Gesellschaft‹.«
»Es ist korrekt, dass ich in seiner Abwesenheit diese Vereinigung leite, aber der Herr, von dem Sie sprechen, ist mir gänzlich unbekannt«, erwiderte von Mühl und betrachtete gelangweilt seine rechte Hand, an der er einen goldenen Siegelring trug.
»Dürfte ich fragen, um was für eine Gesellschaft es sich handelt?«, fragte Leo weiter. Er war an den herablassenden Tonfall von Menschen, die sich aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung überlegen fühlten, gewöhnt und tat sein Bestes, ihm gelassen zu begegnen.
»Wir beschäftigen uns mit der Erforschung des germanischen Erbes in heutiger Zeit. Es handelt sich um streng wissenschaftliche Studien.«
»Wie kommt es dann, dass sich ein Ladenangestellter wie Herr Bremer für Ihre Vereinigung interessiert und sogar um Aufnahme ersucht hat?«
Von Mühl zuckte verächtlich mit den Schultern. »Vielleicht hat er die Volksausgabe des Nibelungenliedes gelesen. Oder die Nordland-Sagen, so etwas gefällt einfachen Gemütern.«
»Ich weiß nicht, wie einfach sein Gemüt war«, warf Walther ein, »aber wir wissen, dass er mit einer Kopfwunde tot aus dem Landwehrkanal gezogen wurde. Wir müssen allen Spuren nachgehen und hatten daher gehofft, Sie könnten uns ein wenig Aufschluss über den Mann geben.«
Von Mühl schüttelte den Kopf. »Ich wiederhole, er war mir nicht bekannt. Vielleicht ist er nicht mehr dazu gekommen, mit mir in Verbindung zu treten, was ich nicht allzu sehr bedauern kann. Und ich werde Herrn von Bauditz bitten, mich nicht weiter zu kompromittieren, indem er solchen Leuten meinen Namen nennt. Guten Tag.« Mit diesen Worten verschwand er durch die Flügeltür.
Leo und Walther verließen schweigend das Haus. »Mann, was für ein arrogantes Schwein«, stieß Walther hervor, als sie außer Hörweite waren. Leo sah ihn überrascht an, da sich sein Kollege sonst mit Kraftausdrücken eher zurückhielt. Insgeheim stimmte er ihm allerdings zu.
Im Wagen sagte Walther: »Tja, ob wir dem was nachweisen können. Wir sollten uns noch mal nach der Uhr umsehen, von der Bremers Chef gesprochen hat. Die ist bis jetzt nirgendwo aufgetaucht. Konfirmationsgeschenk, vermutlich mit Gravur, so was geht doch nicht einfach verloren. Er hat sie kurz vor seinem Tod noch gehabt.« Leo nickte und ließ den Wagen an.
Während der Fahrt war er so schweigsam, dass Walther ihn schließlich prüfend ansah. »Mir dir stimmt doch was nicht. Heraus damit, was ist los?«
Leo schüttelte den Kopf. »Ich musste nur an etwas denken.«
»Ilse?«, fragte Walther vorsichtig. Er war über Leos häusliche Situation im Bilde, wobei ihm meist die Rolle des mitfühlenden Zuhörers zufiel, da er an der schwierigen Lage, in der sich sein Freund befand, nichts ändern konnte.
Leo nickte. »Ich habe dir doch von ihrem neuen Freund erzählt, diesem Bruno Schneider.«
»Und?«
Leo klopfte geistesabwesend mit den Fingern aufs Lenkrad. »Als ich gestern nach Hause kam, rannte mir Georg begeistert entgegen und erzählte, Herr Schneider habe ihn von der Schule abgeholt und in seinem schönen Wagen mitgenommen. Sie haben eine Rundfahrt durch halb Berlin veranstaltet. Georg war völlig hingerissen.«
Walther musste sich ein Grinsen verkneifen. »Von einem Wagen, den sich sein Vater mit seinem schmalen Beamtengehalt nicht leisten kann.«