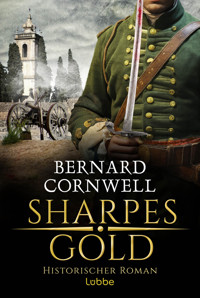Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Uhtred-Saga
- Sprache: Deutsch
Mit den Drachenbooten kommt der Tod - Band 1 der Uhtred-Romane «Und dann sah ich sie. Prächtige Langschiffe. Schwerelos schienen sie auf dem Wasser zu schweben, ihre Ruder teilten die Wellen. Die geschwungenen, hoch aufragenden Vorder- und Hintersteven waren mit vergoldeten Schlangen und Drachen geschmückt, und mir kam es an diesem fernen Sommertag so vor, als tanzten die drei Schiffe im Takt der auf- und niederschwingenden Ruder übers Meer.» Nordengland, im Jahre 866: Mit zehn Jahren erlebt der Fürstensohn Uhtred den Einfall der Wikinger. Sein ungestümer Mut in der Schlacht beeindruckt den Anführer der Dänen so sehr, dass er Uhtred verschont und als Ziehkind aufnimmt. Mit den Jahren wird der Junge fast einer von ihnen. Nach Raub- und Eroberungszügen voller Blut und Gewalt droht auch Wessex, das letzte der fünf angelsächsischen Königreiche, an die Eroberer zu fallen. Doch da wechselt Uhtred wieder die Seiten … «Vielleicht der größte Autor historischer Abenteuergeschichten, den die Gegenwart kennt.» (Washington Post) «Das England des neunten Jahrhunderts und der Meister zupackenden Geschichtenerzählens – diese Kombination ist einfach himmlisch!» (Telegraph)
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernard Cornwell
Das letzte Königreich
Historischer Roman
Über dieses Buch
Mit den Drachenbooten kommt der Tod.
«Und dann sah ich sie. Prächtige Langschiffe. Schwerelos schienen sie auf dem Wasser zu schweben, ihre Ruder teilten die Wellen. Die geschwungenen, hoch aufragenden Vorder- und Hintersteven waren mit vergoldeten Schlangen und Drachen geschmückt, und mir kam es an diesem fernen Sommertag so vor, als tanzten die drei Schiffe im Takt der auf- und niederschwingenden Ruder übers Meer.»
Nordengland, im Jahre 866: Mit zehn Jahren erlebt der Fürstensohn Uhtred den Einfall der Wikinger. Sein ungestümer Mut in der Schlacht beeindruckt den Anführer der Dänen so sehr, dass er Uhtred verschont und als Ziehkind aufnimmt. Mit den Jahren wird der Junge fast einer von ihnen. Nach Raub- und Eroberungszügen voller Blut und Gewalt droht auch Wessex, das letzte der fünf angelsächsischen Königreiche, an die Eroberer zu fallen. Doch da wechselt Uhtred wieder die Seiten …
«Vielleicht der größte Autor historischer Abenteuergeschichten, den die Gegenwart kennt.» (Washington Post)
«Das England des neunten Jahrhunderts und der Meister zupackenden Geschichtenerzählens – diese Kombination ist einfach himmlisch!» (Telegraph)
Vita
Bernard Cornwell, geboren 1944, machte nach dem Studium Karriere bei der BBC, doch nach Übersiedlung in die USA – seine Frau ist Amerikanerin – war ihm die Arbeit im Journalismus mangels Green Card verwehrt. Und so entschloss er sich, einem langgehegten Wunsch nachzugehen, dem Schreiben. Im englischen Sprachraum gilt er seit langem als unangefochtener König des historischen Romans. Seine Werke wurden in über 20 Sprachen übersetzt – Gesamtauflage: mehr als 20 Millionen. Auch sein neuer Zyklus historischer Romane aus der Zeit Alfreds des Großen eroberte in Großbritannien und den USA die Bestsellerlisten im Sturm.
Weitere Veröffentlichungen:
Die Uhtred-Saga:
1. Das letzte Königreich
2. Der weiße Reiter
3. Die Herren des Nordens
4. Schwertgesang
Weitere Bände werden folgen.
Die Artus-Chroniken:
1. Der Winterkönig
2. Der Schattenfürst
3. Arthurs letzter Schwur
Weitere:
Das Zeichen des Sieges
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel «The Last Kingdom» bei HarperCollins Publishers, London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2009
Copyright © 2007 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg «The Last Kingdom» Copyright © 2004 by Bernard Cornwell
Redaktion Karolina Fell
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt, nach der Originalausgabe von HarperCollins Publishers Ltd 2010
Coverabbildung Umschlagabbildungen: Keevil Photography; shutterstock.com
ISBN 978-3-644-40771-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Das letzte Königreich
für Judy, in Liebe
Wyrd bið ful āræd.
Ortsnamen
Die Schreibung der Ortsnamen im angelsächsischen England war eine unsichere und regellose Angelegenheit, in der nicht einmal über die Namen selbst Übereinstimmung herrschte. London etwa wurde abwechselnd als Lundonia, Lundenberg, Lundenne, Lundene, Lundenwic, Lundenceaster und Lunden bezeichnet. Zweifellos hätten manche Leser andere Varianten der Namen, die unten aufgelistet sind, vorgezogen, doch ich habe mich in den meisten Fällen nach der Schreibung gerichtet, die im Oxford Dictionary of English Place-Names für die Jahre um die Herrschaft Alfreds von 871 bis 899 zu finden ist. Aber selbst diese Lösung ist nicht narrensicher. So wird die Insel Hayling dort für das Jahr 956 sowohl Heilincigae als auch Hæglingaiggæ geschrieben. Auch bin ich selbst nicht immer konsequent geblieben; habe die moderne Bezeichnung England dem älteren Englaland vorgezogen und, statt Norðhymbraland, Northumbrien geschrieben, dennoch sind die Grenzen des alten Königreiches nicht mit denjenigen des modernen Staates identisch. Aus all diesen Gründen folgt die unten stehende Liste ebenso unberechenbaren Regeln wie die Schreibung der Ortsnamen selbst.
Abbendum: Abingdon, Berkshire
Æsc’s Hill: Ashdown, Berkshire
Baðum (Bathum ausgesprochen): Bath, Avon
Basengas: Basing, Hampshire
Beamfleot: Benfleet, Essex
Beardastopol: Barnstaple, Devon
Bebbanburg: Bamburgh Castle, Northumberland
Berewic: Berwick-upon-Tweed, Northumberland
Berrocscire: Berkshire
Blaland: Nordafrika
Cantucton: Cannington, Somerset
Cetreht: Catterick, Yorkshire
Cippanhamm: Chippenham, Wiltshire
Cirrenceastre: Cirencester, Gloucestershire
Contwaraburg: Canterbury, Kent
Cornwalum: Cornwall
Cridianton: Crediton, Devon
Cynuit: Cynuit Hillfort, nahe Cannington, Somerset
Dalriada: Westliches Schottland
Defnascir: Devonshire
Dic: Diss, Norfolk
Dunholm: Durham, Grafschaft Durham
Eoferwic: York (dänisch: Jorvic, Yorvik ausgesprochen)
Exanceaster: Exeter, Devon
Fromtun: Frampton on Severn, Gloucestershire
Gegnesburh: Gainsborough, Lincolnshire
Gewæsc: Wash
Gleawecestre: Gloucester, Gloucestershire
Grantaceaster: Cambridge, Cambridgeshire
Gyruum: Jarrow, Grafschaft Durham
Haithabu: Hedeby, Händlerstadt im südlichen Dänemark
Hamanfunta: Havant, Hampshire
Hamptonscir: Hampshire
Hamtun: Southampton, Hampshire
Heilincigae: Insel Hayling, Hampshire
Hreapandune: Repton, Derbyshire
Kenet: Fluss Kennet
Ledecestre: Leicester, Leicestershire
Lindisfarena: Lindisfarne (Heilige Insel), Northumberland
Lundene: London
Mereton: Marten, Wiltshire
Meslach: Matlock, Derbyshire
Pedredan: Fluss Parrett
Pictland: Östliches Schottland
Poole: Hafen Poole, Dorset
Readingum: Reading, Berkshire
Sæfern: Fluss Severn
Scireburnan: Sherborne, Dorset
Snotengaham: Nottingham, Nottinghamshire
Solente: Solent
Streonshall: Strensall, Yorkshire
Sumorsæte: Somerset
Suth Seaxa: Sussex (Südsachsen)
Synningthwait: Swinithwaite, Yorkshire
Temes: Fluss Thames
Thornsæta: Dorset
Tine: Fluss Tyne
Trente: Fluss Trent
Tuede: Fluss Tweed
Twyfyrde: Tiverton, Devon
Uisc: Fluss Exe
Werham: Wareham, Dorset
Wiht: Isle of Wight
Wiire: Fluss Wear
Wiltun: Wilton, Wiltshire
Wiltunscir: Wiltshire
Winburnan: Wimborne Minster, Dorset
Wintanceaster: Winchester, Hampshire
PrologNorthumbrien, 866–867 A.D.
Mein Name ist Uhtred. Ich bin der Sohn Uhtreds, der wiederum Sohn Uhtreds war, dessen Vater ebenfalls Uhtred genannt wurde. Der Schreiber meines Vaters, ein Priester namens Beocca, buchstabierte den Namen Utred. Ich weiß nicht, wie ihn mein Vater geschrieben hätte – er konnte weder lesen noch schreiben; ich aber kann beides, und wenn ich manchmal die alten Schriftrollen aus der Holztruhe hole, sehe ich den Namen mal Uhtred oder Utred, mal Ughtred oder auch Ootred geschrieben. Diese Schriften beurkunden, dass Uhtred, der Sohn Uhtreds, alleiniger Besitzer jener Länder ist, deren Grenzen gewissenhaft markiert sind von Steinen und Deichen, Eichen und Eschen, von Sümpfen und vom Meer, und ich träume von diesen wilden Ländern unter dem windzerwühlten Himmel. Ich träume von ihnen und weiß, dass ich sie mir eines Tages von denen, die sie raubten, wieder zurückholen werde.
Ich bin ein Aldermann, nenne mich aber Graf Uhtred, was dasselbe ist, und die verblichenen Pergamente beweisen, welcher Besitz mir zusteht. Dem Recht nach bin ich der Besitzer dieser Länder, und das Recht, so heißt es, macht uns – anders als die Tiere – vor Gott zu Menschen. Doch das Recht hilft mir nicht, mein Land zurückzugewinnen. Das Recht strebt nach Ausgleich. Das Recht will mit Geld für Verluste entschädigen. Das Recht fürchtet nichts mehr als die blutige Fehde. Ich aber bin Uhtred, der Sohn Uhtreds, und dies ist die Geschichte einer Blutfehde. Sie erzählt, wie ich das Land, das nach dem Recht meines ist, von meinem Feind zurückerobere. Und sie erzählt von einer Frau und ihrem Vater, einem König.
Er war mein König, dem ich alles verdanke. Die Speisen, die ich esse, das Haus, in dem ich wohne, die Schwerter meiner Mannen – all das kam von Alfred, meinem König, der mich hasste.
Die Geschichte beginnt lange vor meiner ersten Begegnung mit Alfred. Sie beginnt, da ich zehn Jahre alt war und zum ersten Mal die Dänen sah. Das war im Jahr 866. Damals hieß ich noch nicht Uhtred, sondern Osbert, denn ich war der zweite Sohn meines Vaters, und nur der Erstgeborene hatte Anspruch auf den Namen Uhtred. Mein Bruder war sieben Jahre älter und von großer, kräftiger Gestalt. Er hatte das blonde Haar unserer Familie und den mürrischen Gesichtsausdruck meines Vaters.
An dem Tag, da ich zum ersten Mal die Dänen sah, ritten wir mit Falken auf den Fäusten an der Küste entlang: mein Vater, meines Vaters Bruder, mein Bruder, ich selbst und ein Dutzend Gefolgsleute. Es war Herbst. Letztes Sommergrün überzog die Klippen, auf den Felsen lagerten Seehunde, und über uns schwirrten und kreischten so viele Seevögel, dass wir die Falken nicht von den Fesseln lassen konnten. Wir ritten, bis wir an die Untiefen gelangten, die sich zwischen unserem Land und Lindisfarena, der heiligen Insel, erstrecken, und ich erinnere mich, über das Wasser auf die eingestürzten Mauern der Abtei geschaut zu haben. Die Dänen hatten sie geplündert, doch das war viele Jahre vor meiner Geburt gewesen, und obwohl die Mönche in ihr Kloster zurückgekehrt waren, hatte es nie wieder zu seiner alten Größe zurückgefunden.
Dieser Tag ist mir als besonders schön in Erinnerung, und vielleicht war er das auch. Vielleicht hat es geregnet, aber das glaube ich nicht. Die Sonne schien, das Meer war ruhig, es wogte sanft, und alles strahlte. Ich spürte die Krallen meines Falkenweibchens durch den Lederärmel. Sein Kopf unter der Haube zuckte hin und her, weil es die Schreie der weißen Vögel hörte. Wir hatten die Festung am Vormittag Richtung Norden verlassen, und obwohl wir die Falken bei uns hatten, ritten wir nicht, um zu jagen, sondern damit mein Vater eine Entscheidung treffen konnte.
Wir herrschten über dieses Land. Mein Vater, Aldermann Uhtred, war Herr über alles südlich der Tuede und nördlich der Tine. Gleichwohl hatten wir einen König in Northumbrien; sein Name war, ebenso wie meiner, Osbert. Er lebte südlich von uns, kam nur selten nach Norden und ließ uns freie Hand. Jetzt aber trachtete ein Mann namens Ælla nach dem Thron, und Ælla, ein Aldermann aus den Bergen westlich von Eoferwic, hatte sich mit einem Heer gerüstet, um Osbert zu stürzen, und meinem Vater Geschenke zukommen lassen, damit er ihn unterstütze. Wie ich heute weiß, hing der Ausgang der Rebellion von der Entscheidung meines Vaters ab. Ich wollte, dass er Osbert die Treue hielt, weil er der rechtmäßige König war und meinen Namen trug, denn töricht, wie ich mit meinen zehn Jahren war, glaubte ich, dass ein Mann namens Osbert nobel, gut und tapfer sein musste. In Wahrheit war Osbert ein alter Narr, dennoch aber der König, und mein Vater hatte Skrupel, ihm in den Rücken zu fallen. Doch im Unterschied zu Ælla hatte Osbert meinem Vater keine Geschenke zukommen lassen und ihm auch keinen Respekt erwiesen, was meinen Vater beunruhigte. Wir konnten jederzeit rund hundertfünfzig gut gerüstete Männer in den Krieg führen und binnen eines Monats über vierhundert Mitstreiter zu den Waffen rufen. Darum würde derjenige, den wir unterstützten, die Macht gewinnen und uns dankbar sein.
So glaubten wir jedenfalls.
Und dann sah ich sie.
Drei Schiffe.
In meiner Erinnerung gleiten sie aus einer Nebelbank hervor, was vielleicht auch so war, doch Erinnerungen sind trügerisch, und meine anderen Bilder jenes Tages zeigen einen klaren und wolkenlosen Himmel. Es gab also vielleicht gar keinen Nebel, doch mir ist so, als seien die drei Schiffe plötzlich wie aus dem Nichts von Süden her aufgetaucht.
Prächtige Langschiffe. Schwerelos schienen sie auf dem Wasser zu schweben, und ihre Ruder teilten die Wellen. Die geschwungenen, hoch aufragenden Vorder- und Hintersteven waren mit vergoldeten Schlangen und Drachen geschmückt, und mir kam es an diesem fernen Sommertag so vor, als tanzten die drei Schiffe im Takt der auf- und niederschwingenden Ruder übers Meer. Die Sonne glitzerte auf den feuchten Ruderblättern, die, wenn sie durchs Wasser gezogen wurden, die Schiffe nach vorn schnellen ließen. Ich war gebannt von ihrem Anblick.
«Teufelsdreck», knurrte mein Vater. Er war kein besonders guter Christ, in diesem Moment aber beängstigt genug, um sich zu bekreuzigen.
«Zur Hölle damit», sagte mein Onkel Ælfric. Er war ein schlanker Mann, gerissen, undurchschaubar und verschwiegen.
Die drei Schiffe fuhren mit gewölbten Segeln vor dem Wind nach Norden. Doch als wir kehrtmachten und über den Strand nach Hause galoppierten, dem Wind entgegen, sodass die Pferdemähnen flogen und die Falken unter ihren Hauben schrille Warnrufe ertönen ließen, drehten die Schiffe bei und folgten uns. An der Stelle, wo die Klippen eingebrochen waren, ritten wir über den Geröllhang landeinwärts, trieben unsere Pferde die steile Böschung hinauf und galoppierten von dort aus auf dem Küstenpfad unserer Festung entgegen.
Zur Bebbanburg. Bebba hatte vor langer Zeit als Königin über unser Land geherrscht, und ihren Namen trägt mein Zuhause: Es ist der schönste Ort auf der ganzen Welt. Die Festung steht auf einem Felsvorsprung hoch über dem Meer. Die Wellen branden gegen die Ostseite, brechen sich weiß schäumend vor der nördlichen Spitze des Felsens und verlaufen im Westen zwischen der Festung und dem Land zu einem kleinen, flachen See. Den Zugang zur Bebbanburg bildet ein Damm aus Steinen und Sand, vor dem sich zum Schutz das untere Torhaus erhebt, ein großer, auf einem Erdwall errichteter Holzturm. Auf unseren schweißnassen Pferden donnerten wir durch den Torbogen, am Getreidespeicher, der Hufschmiede und den Stallungen vorbei, die allesamt aus Holz gebaut und mit Roggenstroh gedeckt waren, und schließlich hinauf zum Bergfried auf der Spitze des Felsens, der von Palisaden umgeben war, die den Palas meines Vaters einschlossen. Dort stiegen wir ab, überließen unsere Pferde und Falken den Knechten und rannten zum Wehrgang auf der Ostseite, um aufs Meer hinauszublicken.
Die drei Schiffe waren jetzt nahe bei den Inseln, auf denen die Papageientaucher nisten und im Winter das Seehundevolk tanzt. Alarmiert vom Geklapper der Hufe eilte meine Stiefmutter aus dem Palas. «Die hat der Teufel ausgeschissen», begrüßte sie mein Vater.
«Bewahre uns Gott mit seinen Heiligen», sagte Gytha und bekreuzigte sich. Meine leibliche Mutter hatte ich nie gekannt; sie war die zweite Frau meines Vaters gewesen und wie ihre Vorgängerin im Kindbett gestorben. Wir, mein Bruder – genauer gesagt: mein Halbbruder – und ich, hatten also keine Mutter, doch ich sah Gytha als meine Mutter an, und meistens war sie freundlich zu mir, freundlicher jedenfalls als mein Vater, der für Kinder nicht viel übrig hatte. Gytha wollte, dass ich Priester werde, denn mein älterer Bruder würde das Land erben und als Ritter beschützen, sodass ich einen anderen Lebensweg einschlagen müsse. Sie hatte meinem Vater zwei Söhne und eine Tochter geschenkt, die aber alle nicht älter als ein Jahr geworden waren.
Die drei Schiffe kamen immer näher, offenbar angelockt von der Bebbanburg, was uns jedoch nicht weiter beunruhigte, da die Festung als uneinnehmbar galt, da mochten die Dänen so lange Ausschau halten, wie sie wollten. Das Schiff an der Spitze hatte auf beiden Seiten zwölf Ruder. Es war noch gut zehn Längen von der Küste entfernt, als ein Mann an der Seite herabkletterte und wie ein Tänzer von einem Ruderschaft auf den nächsten sprang, wobei er auch noch ein schweres Kettenhemd und ein gezücktes Schwert trug. Wir beteten darum, dass er ins Wasser stürzte, was natürlich nicht geschah. Er hatte helle, sehr lange Haare, und als er die gesamte Länge der Ruderbank abgeschritten hatte, machte er kehrt und lief über die Schäfte zurück.
«Die waren vor einer Woche in der Tinemündung», sagte Ælfric, meines Vaters Bruder. «Um Waren zu tauschen.»
«Woher weißt du das?»
«Ich habe dieses Schiff gesehen», antwortete Ælfric, «und ich erkenne es wieder. Siehst du den hellen Balken da vorn am Bug?» Er spuckte aus. «Aber diesen Drachenkopf hatte es noch nicht.»
«Wenn sie Handel treiben, nehmen sie die Köpfe ab», sagte mein Vater. «Was haben sie getauscht?»
«Salz und getrockneten Fisch gegen Felle. Haben sich als Händler von Haithabu ausgegeben.»
«Und jetzt sind diese Händler auf Streit aus», sagte mein Vater, und tatsächlich forderten uns die Dänen auf den drei Schiffen heraus, indem sie mit Speeren und Schwertern auf ihre bemalten Schilde schlugen. Doch sie konnten gegen Bebbanburg nichts ausrichten, und auch wir konnten ihnen nichts anhaben, obwohl mein Vater anordnete, sein Wolfsbanner zu hissen. Die Kriegsstandarte meines Vaters zeigte den Kopf eines zähnefletschenden Wolfs, doch es wehte kein Wind, und so hing die Fahne schlaff herab, ohne die Heiden beeindrucken zu können, die es nach einer Weile leid waren, uns zu reizen, sich wieder in die Riemen legten und nach Süden davonruderten.
«Wir sollten beten», sagte meine Stiefmutter. Gytha war sehr viel jünger als mein Vater, eine kleine, rundliche Frau mit dichtem blondem Haar, die den heiligen Cuthbert für seine Wundertaten verehrte. In der Kapelle neben dem Palas bewahrte sie einen elfenbeinernen Kamm auf, von dem es hieß, Cuthbert habe sich damit den Bart gekämmt, und vielleicht stimmte das auch.
«Wir sollten was tun», knurrte mein Vater. Er wandte sich vom Wall ab. «Du», sagte er zu meinem älteren Bruder Uhtred, «nimm ein Dutzend Männer und reite nach Süden. Behalte diese Heiden im Auge, aber weiter nichts, verstanden? Wenn sie auf meinem Gebiet an Land gehen, will ich wissen, wo.»
«Ja, Vater.»
«Und leg dich nicht mit ihnen an», befahl mein Vater. «Du beobachtest die Schweine einfach und bist zurück, bevor es Nacht wird.»
Sechs weitere Männer wurden losgeschickt, um das Land in Alarmbereitschaft zu versetzen und alle freien Männer, die zum Waffendienst verpflichtet waren, zusammenzutrommeln. Mein Vater wollte bis zum Morgengrauen zweihundert Kämpfer um sich scharen. Manche von ihnen würden mit Äxten, Lanzen und Sicheln bewaffnet sein, seine Gefolgsleute hingegen, diejenigen, die mit uns auf der Burg lebten, mit geschmiedeten Schwertern und festen Schilden. «Wenn wir den Dänen zahlenmäßig überlegen sind, werden sie nicht kämpfen», erklärte mir mein Vater an diesem Abend. «Sie sind wie Hunde, diese Dänen. Im Herzen feige und nur mutig in ihrer Meute.» Es war schon dunkel geworden und mein Bruder noch nicht zurück, doch darüber machte sich niemand Sorgen. Uhtred war manchmal leichtsinnig, aber durchaus in der Lage, auf sich aufzupassen, und er würde zweifellos irgendwann in der Nacht zurückkommen. Um ihm den Weg zu weisen, hatte mein Vater ein Leuchtfeuer in der Eisenpfanne auf der Spitze des Burgfrieds entzünden lassen.
Wir wähnten uns sicher auf der Bebbanburg, denn sie hatte bislang allen feindlichen Angriffen getrotzt. Dennoch waren mein Vater und mein Onkel über die Rückkehr der Dänen nach Northumbrien beunruhigt. «Sie brauchen was zu essen, diese Heiden», sagte mein Vater. «Sie gehen an Land, stehlen ein paar Rinder und segeln wieder davon.»
Ich dachte an die Worte meines Onkels, der davon gesprochen hatte, dass die Dänen mit ihren Schiffen in der Tinemündung gewesen waren und Felle gegen Trockenfisch eingetauscht hatten. Warum also sollten sie Hunger haben? Doch ich sagte nichts. Ich war zehn Jahre alt; was konnte ich schon von den Dänen wissen?
Ich wusste, dass sie wild waren, heidnisch und schrecklich. Ich wusste, dass sie mit ihren Schiffen zwei Generationen vor meiner Geburt unsere Küste überfallen hatten. Ich wusste, dass Pater Beocca, der Schreiber meines Vaters und unser Priester, jeden Sonntag zu Gott betete, er möge uns vor der Wut der Nordmänner bewahren. Doch von dieser Wut konnte ich mir keine Vorstellung machen. Seit ich auf der Welt war, hatte sich kein Däne bei uns blicken lassen. Mein Vater aber hatte schon oft genug gegen sie gekämpft, und in dieser Nacht, da wir auf meinen Bruder warteten, erzählte er von dem alten Feind. Sie kamen, so sagte er, aus den Ländern im Norden, wo Eis und Nebel herrschten; sie verehrten die gleichen alten Götter, die auch wir verehrt hatten, bevor uns das Licht Christi gebracht worden war. Und als sie das erste Mal über Northumbrien hergefallen waren, so erzählte mein Vater, rauschten feurige Drachen über den Nordhimmel, gewaltige Blitze entluden sich über den Bergen, und das Meer war aufgewühlt von tobenden Winden.
«Gott hat sie geschickt», sagte Gytha zaghaft, «um uns zu bestrafen.»
«Bestrafen? Wofür?», fragte mein Vater zornig.
«Für unsere Sünden», antwortete Gytha und bekreuzigte sich.
«Unsinn», blaffte mein Vater. «Sie kommen, weil sie was zu essen brauchen.» Die Frömmigkeit meiner Stiefmutter reizte ihn, und er weigerte sich, von seinem Wolfsbanner zu lassen, das unsere Familie als Nachkommen von Wotan, dem alten Kriegsgott der Germanen, auswies. Von Ealdwulf, dem Schmied, wusste ich, dass der Wolf, neben dem Adler und dem Raben, eines der drei Lieblingstiere Wotans war. Meine Mutter hätte lieber ein Kreuz auf unserer Fahne gesehen, doch mein Vater war stolz auf seine Vorfahren, wenngleich er nur selten von Wotan sprach. Selbst als Zehnjähriger verstand ich, dass sich ein guter Christ nicht damit brüsten sollte, von einem heidnischen Gott abzustammen. Dennoch gefiel mir die Vorstellung, von göttlicher Herkunft zu sein, und ich hörte gern zu, wenn Ealdwulf Geschichten von Wotan erzählte; wie er unser Volk belohnte, indem er uns das Land, das wir England nannten, zum Geschenk machte, wie es ihm einmal gelungen war, eine Lanze rund um den Mond zu schleudern, wie er mit seinem Schild die Mittsommernacht verdunkelte und wie er mit einem einzigen Schwertstreich das Getreide auf der ganzen Welt mähen konnte. Ich mochte diese Geschichten. Sie waren besser als die Erzählungen meiner Mutter von den Wundertaten des heiligen Cuthbert. Die Christen schienen mir allzu weinerlich, und ich war sicher, dass Wotans Anhänger nicht oft heulten.
Wir warteten im Palas. Er war – und ist immer noch – ein großer Raum aus schweren Holzbalken unter einem strohgedeckten Dach, mit einer Harfe auf einer Bühne und einem großen steinernen Herd in der Mitte. Ein Dutzend Knechte war vonnöten, um das große Feuer in Gang zu halten; sie schafften das Brennholz über den Damm und durch die Tore, und gegen Ende des Sommers wurden die Scheite als Wintervorrat zu einem Stapel aufgehäuft, der höher war als die Kapelle. Entlang der Holzwände verlief eine breite Stufe aus Brettern, über festgetretenem Lehm und mit gewebten Wollteppichen ausgelegt. Auf dieser Stufe lebten wir, geschützt vor der Zugluft. Die Hunde blieben unten auf dem mit Spreu bestreuten Boden, wo zu den vier großen Feiertagen des Jahres dem Gesinde ein Festmahl gegeben wurde.
In dieser Nacht aber wurde nicht geschmaust; es gab nur Brot, Käse und Ale, während wir auf meinen Bruder warteten und laut darüber nachdachten, ob die Dänen womöglich wieder unruhig würden. «Gewöhnlich kommen sie nur, um zu plündern», erklärte mir mein Vater, «aber an manchen Orten sind sie auch geblieben und haben Land besetzt.»
«Glaubt Ihr, sie wollen unser Land?», fragte ich.
«Sie nehmen alles, was sie kriegen», entgegnete Vater gereizt. Meine Fragen reizten ihn immer, doch in dieser Nacht machte er sich Sorgen, und deshalb sprach er weiter. «Ihr eigenes Land besteht nur aus Steinen und Eis, und es wird von Riesen bedroht.»
Von diesen Riesen wollte ich mehr hören, doch stattdessen begann er zu grübeln. «Unsere Ahnen», sagte er nach einer Weile, «haben sich dieses Land genommen. Sie haben es genommen, es bestellt und daran festgehalten. Wir werden nicht aufgeben, was uns unsere Ahnen hinterlassen haben. Sie sind übers Meer gefahren, haben hier gekämpft, ihre Hütten hier gebaut und liegen hier begraben. Dies ist unser Land, getränkt von unserem Blut und gedüngt mit unseren Knochen. Es gehört uns.» Er war wütend, aber er war oft wütend. Er musterte mich mit finsterem Blick, als fragte er sich, ob ich stark genug wäre, dieses Land Northumbrien zu bewahren und zu verteidigen, das unsere Vorfahren mit Schwert und Lanze und Blut und Gemetzel erobert hatten.
Danach schliefen wir ein wenig, oder zumindest schlief ich. Ich glaube, mein Vater schritt den Festungswall ab, doch als es hell wurde, war er wieder im Palas. Da weckte mich das Horn vom Turm, und ich stolperte von der Holzplattform hinaus ins erste Morgenlicht. Tau hing im Gras, ein Seeadler kreiste am Himmel, und die Hunde meines Vaters liefen, angelockt vom Klang des Horns, in den Hof. Ich sah meinen Vater zum Torhaus hasten und folgte ihm bis auf den Wall, wo ich mich zwischen etlichen Männern hindurchdrängte, die auf den Dammweg hinausblickten.
Reiter kamen von Süden. Ein Dutzend Männer, die Hufe ihrer Pferde glitzerten vor Tau. Das Pferd meines Bruders lief an der Spitze, ein gescheckter Hengst mit wilden Augen und auffälliger Gangart. Im Galopp warf er die Vorderläufe ungewöhnlich hoch, woran man ihn sofort erkennen konnte. Im Sattel aber saß nicht Uhtred, sondern ein Mann mit sehr langem Haar in der Farbe stumpfen Goldes, Haar, das wie der Schwanz des Pferdes wehte, während er ritt. Er trug ein Kettenhemd, ein Schwert hing an seiner Seite, eine Streitaxt über seiner Schulter, und ich war sicher, denselben Mann vor mir zu haben, der tags zuvor auf den Ruderschäften getanzt hatte. Seine Gefährten waren in Leder und Wolle gekleidet, sie blieben auf ein Zeichen des langhaarigen Mannes zurück, der nun allein weiterritt und bis auf Pfeilschussnähe herankam. Doch niemand von uns an der Brüstung spannte einen Pfeil in die Bogensehne. Der Fremde brachte Uhtreds Pferd zum Stehen, blickte mit spöttischer Miene den Männern am Torhaus entgegen, verbeugte sich dann, warf etwas auf den Weg, riss das Pferd herum, trat ihm seine Hacken in die Flanken und preschte Richtung Süden davon, begleitet von seinen zottigen Mannen.
Was er auf den Weg geworfen hatte, war der abgetrennte Kopf meines Bruders. Er wurde zu meinem Vater gebracht, der ihn lange anstarrte, seine Gefühle aber nicht verriet. Er weinte nicht, er verzog keine Miene, er sah nur den Kopf seines ältesten Sohnes an, und dann sah er mich an und sagte: «Von heute an heißt du Uhtred.»
So kam ich zu meinem Namen.
Pater Beocca bestand darauf, dass ich ein zweites Mal getauft werden müsse, weil sonst der Himmel nicht wisse, wer ich sei, wenn ich mit dem Namen Uhtred ankäme. Ich protestierte, doch auch Gytha wollte es, und weil meinem Vater ihre Zufriedenheit wichtiger war als meine, wurde ein Fass in die Kapelle getragen und zur Hälfte mit Meerwasser gefüllt. Pater Beocca ließ mich hineinsteigen, schöpfte Wasser über meinen Kopf und sprach: «Nimm deinen Diener Uhtred auf in die Gemeinschaft der Heiligen und in die Schar der höchsten Engel.» Ich hoffte, dass mir unter den Heiligen und den Engeln wärmer sein würde als an diesem Tag. Als ich getauft war, weinte Gytha um mich, was ich mir nicht erklären konnte. Sie hätte eher um meinen Bruder weinen können.
Später fanden wir heraus, was ihm widerfahren war. Die drei dänischen Schiffe waren in die Mündung der Alne vorgedrungen, wo einige Fischer mit ihren Familien siedelten. Sie waren vorsichtshalber ins Landesinnere geflüchtet, doch war eine Hand voll am Rand des höher gelegenen Waldes geblieben, um die Flussmündung im Auge zu behalten. Sie berichteten, dass mein Bruder in der Abenddämmerung gekommen sei, als die Wikinger die Hütten in Brand steckten. Wir nannten sie Wikinger, wenn sie brandschatzten, Dänen oder Heiden, wenn sie als Händler kamen. Diese Männer hatten die Siedlung geplündert und niedergebrannt, waren für uns also Wikinger. Nur ganz wenige von ihnen hatten zwischen den Hütten gewütet, die meisten waren auf den Schiffen geblieben, und deshalb hatte mein Bruder entschieden, in die Siedlung hinunterzureiten und die wenigen Männer zu töten, aber es war natürlich eine Falle. Die Dänen hatten ihn und seinen Tross kommen sehen und sich mit vierzig Mann im Norden des Dorfes auf die Lauer gelegt, sie überfallen und alle getötet. Mein Vater behauptete, sein ältester Sohn habe einen schnellen Tod erlitten, womit er sich tröstete. Doch so schnell war sein Tod gewiss nicht, denn er lebte mindestens noch lange genug, damit die Dänen feststellen konnten, wer er war. Anderenfalls wären sie wohl kaum auf die Idee gekommen, seinen Kopf zur Bebbanburg zu bringen. Die Fischer sagten, sie hätten versucht, ihn zu warnen, aber das glaube ich nicht. So etwas sagt man, um sich herauszureden. Wie dem auch sei, mein Bruder war tot, und außer seinem Leben hatten die Dänen dreizehn gute Schwerter genommen, dreizehn edle Pferde, ein Kettenhemd, einen Helm und meinen alten Namen.
Aber das war noch nicht das Ende. Drei Schiffe, die aufkreuzten und wieder verschwanden, waren kein großes Ereignis, doch eine Woche nach dem Tod meines Bruders hörten wir, dass eine große dänische Flotte auf dem Wasserweg ins Landesinnere vorgedrungen und über Eoferwic hergefallen war. Zu Allerheiligen hatten sie die Stadt eingenommen, worüber Gytha bitterlich weinte, weil sie darin ein Zeichen sah, dass sich Gott von uns abgewendet hatte. Doch es gab auch gute Nachrichten: Anscheinend hatten sich mein alter Namensvetter König Osbert und sein Rivale Ælla, der ihm den Thron streitig machte, zusammengetan und darauf verständigt, ihre Feindschaft beizulegen und Eoferwic mit vereinten Kräften zurückzuerobern. Was so einfach klang, dauerte natürlich seine Zeit. Boten ritten, Berater verwirrten, Priester beteten, und als Osbert und Ælla endlich ihren Frieden besiegelten, war es Weihnachten, und dann riefen sie die Männer meines Vaters zum Einsatz, doch im Winter konnten wir natürlich nicht in den Kampf ziehen. Die Dänen waren in Eoferwic, und dort ließen wir sie gewähren bis zum Frühlingsbeginn, als die Nachricht eintraf, dass sich das Heer von Northumbrien vor der Stadt sammelte. Zu meiner großen Freude entschied mein Vater, dass ich mit ihm Richtung Süden reiten sollte.
«Er ist noch zu jung», protestierte Gytha.
«Er ist fast elf», entgegnete mein Vater, «und er muss lernen zu kämpfen.»
«Er würde besser seinen Unterricht fortsetzen», sagte sie.
«Ein toter Gelehrter ist für die Bebbanburg wertlos», erwiderte mein Vater. «Uhtred ist jetzt der Stammhalter, und deshalb muss er kämpfen lernen.»
An diesem Abend beauftragte er Beocca, mir die Schriftrollen zu zeigen, die in der Kapelle aufbewahrt wurden, die Urkunden, die uns als rechtmäßige Besitzer des Landes auswiesen. Seit zwei Jahren lehrte mich Beocca das Lesen, aber ich war ein schlechter Schüler und konnte die Schriften nicht entziffern. Beocca seufzte verzweifelt und erklärte mir, was darin geschrieben stand. «Sie beschreiben das Land», sagte er, «das Land deines Vaters, und hier steht, dass das Land nach göttlichem Recht und unseren Gesetzen deinem Vater gehört.» Und es schien, als sollte ich dieses Land eines Tages erben, denn noch an diesem Abend diktierte mein Vater ein neues Testament, in dem er seinen Sohn Uhtred als Erben der Bebbanburg einsetzte; ich sollte der zukünftige Aldermann sein, dem das Volk zwischen den Flüssen Tuede und Tine den Treueeid leisten würde. «Wir waren hier einst Könige», sagte er mir, «und unser Land wurde Bernicia genannt.» Er presste sein Siegel ins rote Wachs und hinterließ darin den Abdruck eines Wolfskopfs.
«Wir werden wieder Könige sein», sagte Ælfric, mein Onkel.
«Als was man uns bezeichnet, ist gleichgültig», erwiderte mein Vater schroff, «Hauptsache, man gehorcht uns.» Und dann ließ er Ælfric auf den Kamm des heiligen Cuthbert schwören, dass er sein neues Testament respektierte und mich als Uhtred von Bebbanburg anerkannte. Ælfric leistete den Schwur. «Aber noch lebe ich», sagte mein Vater. «Wir werden diese Dänen wie Schafe in der Koppel abschlachten und ruhmreich, mit Beute beladen, zurückkehren.»
«Mit Gottes Hilfe», sagte Ælfric.
Ælfric blieb mit dreißig Männern in der Festung zurück, um über Bebbanburg zu wachen und die Frauen zu beschützen. Er beschenkte mich an diesem Abend mit einem Lederkleid, das mich vor Schwerthieben schützen sollte, und mit einem Helm, den Ealdwulf, der Schmied, mit einem Ringband aus vergoldeter Bronze geschmückt hatte. «Damit jeder sieht, dass du ein Prinz bist», sagte Ælfric.
«Er ist kein Prinz», widersprach mein Vater, «sondern der Erbe eines Aldermanns.» Doch auch ihn erfreuten die Gaben seines Bruders, und er fügte noch ein Kurzschwert und ein Pferd dazu. Das Schwert war eine alte, verkürzte Klinge, die in einer mit Vlies gefütterten Lederscheide steckte. Es hatte ein klobiges Heft und war nicht leicht zu führen, dennoch schlief ich in dieser Nacht mit dem Schwert unter meiner Decke.
Am nächsten Morgen, während meine Stiefmutter auf dem Festungswall weinte, ritten wir unter einem strahlend blauen Himmel in den Krieg. Zweihundertfünfzig Krieger folgten unserem Wolfskopfbanner gen Süden.
Wir schrieben das Jahr 867, und ich zog zum ersten Mal in den Krieg.
Dieser Krieg dauert bis heute.
«Du wirst nicht im Schildwall kämpfen», sagte mein Vater.
«Nein, Vater.»
«Das können nur erwachsene Männer. Aber du wirst genau aufpassen, lernen und erkennen, dass der gefährlichste Hieb mit dem Schwert oder der Axt nicht der ist, den man kommen sieht, sondern der, den man nicht sieht, der Hieb, der am untern Schildrand vorbei auf die Fußgelenke zielt.»
Unterwegs auf der langen Straße nach Süden gab er mir, wenn auch widerwillig, noch manch anderen Rat. Von den zweihundertfünfzig Männern, die mit uns von der Bebbanburg nach Eoferwic zogen, waren hundertzwanzig zu Pferde. Sie gehörten zur direkten Gefolgschaft meines Vaters oder waren wohlhabende Freisassen, die sich nicht nur ein Pferd, sondern auch Rüstung, Schild und Schwert leisten konnten. Den anderen fehlten dazu die Mittel, doch waren sie auf die Sache meines Vaters eingeschworen und marschierten mit Sicheln und Messern, Lanzen, Fischhaken, Äxten oder auch Pfeil und Bogen. Ein jeder war aufgefordert worden, eine Wochenration Nahrung mitzunehmen, die hauptsächlich aus hartem Brot, noch härterem Käse und geräuchertem Fisch bestand. Viele waren in Begleitung von Frauen. Mein Vater hatte dies zwar verboten, schickte die Frauen aber nicht zurück, weil sie dem Tross ohnehin weitergefolgt wären. Außerdem stand zu erwarten, dass die Männer unter den Augen ihrer Frauen oder Geliebten größeren Kampfesmut an den Tag legten, und er war davon überzeugt, dass diese Frauen mit ansehen würden, wie das northumbrische Heer den Dänen eine vernichtende Niederlage beibrachte. Er behauptete, dass unser Land die härtesten Männer Englands hervorbrächte, viel härter als die verweichlichten Mercien. «Deine Mutter war aus Mercien», fügte er hinzu und ließ es dabei bewenden. Er sprach nie von ihr. Ich wusste, dass die beiden nur ein knappes Jahr verheiratet gewesen waren, als sie nach meiner Geburt im Kindbett starb, dass sie die Tochter eines Aldermanns gewesen war und meinem Vater überhaupt nichts mehr bedeutete. Noch mehr als die Mercier verachtete er die verzärtelten Westsachsen. «In Wessex kennt man keine Not», sagte er. Sein strengstes Urteil aber sparte er sich für die Ostangeln auf. «Die leben im Sumpf», hatte er mir einmal gesagt, «und verhalten sich wie Frösche.» Wir, das Volk von Northumbrien, hassten die Ostangeln, seit sie uns vor langer Zeit in einer Schlacht geschlagen und Ethelfried getötet hatten, unseren König und den Gemahl von Bebba, nach der unsere Festung benannt worden war. Später erfuhr ich, dass die Ostangeln die dänischen Eroberer von Eoferwic mit Pferden und Winterquartieren versorgt hatten. Mein Vater verachtete sie also durchaus zu Recht. Sie waren verräterische Frösche.
Pater Beocca begleitete unseren Zug nach Süden. Mein Vater hatte für den Priester nicht viel übrig, mochte aber nicht ohne einen Gottesmann, der für uns betete, in den Krieg ziehen. Beocca hingegen war meinem Vater treu ergeben, der ihn aus der Leibeigenschaft befreit und studieren lassen hatte. Ich vermute, Beocca wäre ihm selbst dann treu geblieben, wenn mein Vater den Teufel angebetet hätte. Beocca war jung, glatt rasiert und außergewöhnlich hässlich. Er hatte einen fürchterlichen Silberblick, eine platte Nase, einen Wust roter Haare und eine verkrüppelte linke Hand. Allerdings war er auch sehr klug, was ich aber damals eher gering schätzte, weil es mir nicht gefiel, von ihm unterrichtet zu werden. Der arme Mann gab sich große Mühe, mir das Schreiben und Lesen beizubringen, doch ich machte mich über seine Anstrengungen lustig und ließ mich lieber von meinem Vater verprügeln, als mich auf das Alphabet zu konzentrieren.
Wir folgten der Römerstraße, die entlang der Tine bis an den großen Wall führte, der ebenfalls von den Römern gebaut worden war. Nach Ansicht meines Vaters waren die Römer Giganten gewesen, die großartige Bauwerke geschaffen hatten, dann aber nach Rom zurückgekehrt waren und, falls welche überlebt haben sollten, zu Priestern degeneriert waren. Die Straße der Giganten aber gab es noch, und während wir auf ihr nach Süden zogen, schlossen sich uns immer mehr Kämpfer an, sodass bald ein Großteil des Heers durch das sumpfige Land links und rechts der befestigten Straße marschieren musste. Nachts schliefen die meisten unter freiem Himmel; nur mein Vater und seine Gefolgsleute bezogen in Klöstern oder Bauernhöfen Quartier.
Unsere Reihen waren zuweilen ungeordnet, wie sehr, bemerkte sogar ich mit meinen zehn Jahren. Einige Männer hatten Getränke mitgebracht, andere stahlen in den Dörfern, die wir passierten, Met und Ale. Viele betranken sich und brachen einfach am Straßenrand zusammen, ohne dass sich jemand um sie gekümmert hätte. «Die holen uns schon wieder ein», sagte mein Vater.
«Das ist nicht gut», sagte Pater Beocca zu mir.
«Was ist nicht gut?»
«Wir brauchen mehr Disziplin. Ich habe von den römischen Kriegen gelesen und weiß, wie wichtig Disziplin ist.»
«Sie holen uns schon wieder ein», wiederholte ich meinen Vater sorglos.
Am Abend stießen Männer aus Cetreht zu uns, einem Ort, an dem wir vor langer Zeit die Welschen in einer großen Schlacht geschlagen hatten. Die Neuankömmlinge sangen Kampflieder, die daran erinnerten, wie wir die Raben mit dem Blut der Fremden getränkt hatten. Mein Vater war in Hochstimmung und sagte, dass Eoferwic nicht mehr weit sei; bald würden wir mit Osbert und Ælla zusammentreffen, und dann würden wir wieder Raben tränken. Im Süden, weit hinter einer flachen Ebene, erkannte ich am Himmel den Widerschein vieler Feuer und wusste, wo sich der Rest des northumbrischen Heeres sammelte.
«Der Rabe ist Wotans Geschöpf, nicht wahr?», fragte ich nervös.
Mein Vater sah mich verwundert an. «Wer hat dir das gesagt?»
Ich zuckte mit den Achseln und schwieg.
«Ealdwulf?» Er hatte unseren Schmied, der mit Ælfric in der Festung geblieben war, als heimlichen Heiden durchschaut.
«Das habe ich irgendwo gehört», antwortete ich und zog den Kopf ein aus Furcht, für diese Ausflucht geschlagen zu werden, «und ich weiß, dass wir von Wotan abstammen.»
«So ist es», bestätigte mein Vater. «Aber jetzt haben wir einen neuen Gott.» Er starrte sorgenvoll auf das Lager und die trinkenden Männer. «Weißt du, Sohn, wer in den Schlachten siegt?»
«Wir.»
«Die Seite, die weniger betrunken ist», antwortete er und fügte nach einer Weile hinzu: «Aber es hilft, zu trinken.»
«Warum?»
«Weil es schrecklich ist, in einem Schildwall zu kämpfen.» Er starrte ins Feuer. «Ich habe schon sechsmal in vorderster Reihe gestanden», fuhr er fort. «Und jedes Mal habe ich gebetet, es möge das letzte Mal sein. Dein Bruder war ein Mann, dem es im Schildwall gefallen hätte. Er war sehr mutig.» Er dachte schweigend nach, zog dann die Augenbrauen zusammen und sagte: «Der Mann, der seinen Kopf gebracht hat. Ich will seinen Kopf. Ich will in seine toten Augen spucken und seinen Schädel dann auf einen Mast am Torhaus spießen.»
«Ihr werdet ihn bekommen.»
Er lachte höhnisch und sagte: «Was weißt du schon? Ich habe dich mitgenommen, weil du lernen musst, wie es in der Schlacht zugeht. Weil unsere Männer sehen sollen, dass du dabei bist. Aber du wirst nicht kämpfen. Du bist ein Welpe, der, ohne selbst zu beißen, beobachtet, wie die alten Hunde ein Wildschwein reißen. Du wirst beobachten und lernen, beobachten und lernen. Es soll dir eines Tages nützlich sein. Doch vorerst bist du nur ein kleines Hündchen.» Mit einer Geste entließ er mich.
Am nächsten Tag marschierten wir auf der Römerstraße über flaches Land, überquerten Dämme und Gräben, bis wir schließlich an die Stelle gelangten, wo die Heere von Osbert und Ælla ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Hinter den Bäumen lag Eoferwic in Sichtweite, und dort waren die Dänen.
Eoferwic war und ist immer noch die Hauptstadt des nördlichen Englands. Sie umfasst eine große Abtei, den Bischofssitz, eine Festung, hohe Mauern und einen riesigen Markt. Am Rand der Stadt fließt die Ouse, die von einer festen Brücke überspannt wird. Auf diesem Fluss waren die Dänen mit ihren Schiffen vom Meer nach Eoferwic gelangt. Sie mussten gewusst haben, dass Northumbrien von inneren Unruhen geschwächt und Osbert, der rechtmäßige König, nach Westen gezogen war, um sich mit seinem Herausforderer Ælla zu schlagen. Seine Abwesenheit hatten sie genutzt, um die Stadt einzunehmen. Der Streit zwischen Osbert und Ælla gärte schon seit Wochen, und Eoferwic war voller Händler, von denen viele zur See fuhren und die Nachricht von der erbitterten Rivalität dieser beiden Männer verbreiteten.
Dass sich die Dänen gut darauf verstanden, andere auszuspähen, habe ich mit der Zeit gelernt. Die Mönche schreiben in ihren Chroniken zwar, dass die Nordmänner mit ihren Drachenschiffen wie aus heiterem Himmel aufkreuzten, aber so war es selten. Die Wikinger griffen wohl einmal unerwartet an, doch ihre großen Kriegsflotten nahmen immer gezielt Kurs auf solche Orte, in denen es, wie sie genau wussten, Streit und Hader gab. Sie suchten eine offene Wunde und setzten sich wie Maden darin fest.
Mein Vater führte mich und zwei Dutzend seiner Männer – allesamt beritten und mit Kettenhemden oder Leder gepanzert – nahe an die Stadt heran. Wir konnten den Feind auf dem Ringwall sehen. Einige Abschnitte der Befestigungsanlage waren aus Stein gemauert und stammten noch aus der Römerzeit, der größte Teil aber bestand aus einem Erdwall und hohen Palisaden. Im Osten der Stadt gab es allerdings eine Stelle, an der die Palisaden fehlten. Sie schienen abgebrannt zu sein, denn wir konnten verkohlte Stümpfe auf dem Erdwall erkennen, in den frische Pfähle für den Neubau der Verschanzung eingerammt waren.
Hinter diesen Pfählen waren zahllose Strohdächer zu sehen sowie die hölzernen Glockentürme dreier Kirchen und, auf dem Fluss, die Masten der dänischen Flotte. Unsere Kundschafter hatten insgesamt vierunddreißig Schiffe gezählt, was darauf schließen ließ, dass die Streitkraft der Dänen rund tausend Mann stark war. Unser Heer war größer, es bestand aus ungefähr fünfzehnhundert Kämpfern, doch eine genaue Zahl ließ sich nicht errechnen. Es schien keinen Oberbefehl zu geben. Die beiden Anführer Osbert und Ælla hatten offiziell zwar Frieden geschlossen, lehnten es jedoch ab, miteinander zu sprechen, und tauschten sich nur über Vermittler aus. Mein Vater, der drittmächtigste Mann des Heeres, stand mit beiden in Kontakt, konnte sie aber nicht von einer Zusammenkunft überzeugen, geschweige denn davon, einen gemeinsamen Kriegsplan zu entwerfen. Osbert wollte die Stadt belagern und die Dänen aushungern, während Ælla auf einen sofortigen Angriff drängte. Es sei ein Leichtes, so sagte er, durch die Lücke im Wall tief in die Stadt einzudringen und die Dänen in den engen Gassen zur Strecke zu bringen. Welchen Plan mein Vater im Sinn hatte, weiß ich nicht, denn er äußerte sich nicht, und am Ende wurde uns die Entscheidung abgenommen.
Unser Heer konnte nicht warten. Als unsere Lebensmittel aufgebraucht waren, zogen einige Männer los, um für Nachschub zu sorgen, und manche dieser Männer kehrten nicht zurück. Sie gingen einfach heimlich nach Hause. Andere sorgten sich um ihre Höfe und fürchteten eine Hungersnot, wenn sie nicht bald wieder ihre Felder bestellen könnten. Eine Versammlung der wichtigsten Männer wurde einberufen, und sie stritten einen ganzen Tag lang miteinander. Osbert nahm an diesem Treffen teil, was bedeutete, dass ihm Ælla fernblieb. Allerdings vertrat ihn einer seiner Anhänger, der andeutete, dass Osbert aus Feigheit nicht angreifen wolle. Vielleicht hatte er Recht, denn Osbert ging auf den Vorwurf nicht ein und schlug stattdessen vor, eigene Festungen vor der Stadt zu errichten. Er sagte, mit drei oder vier solcher Festungen, bemannt mit unseren besten Kämpfern, habe man die Dänen im Griff; die Übrigen könnten zurückkehren und sich um ihre Felder kümmern. Ein anderer machte den Vorschlag, eine zweite Brücke über den Fluss zu schlagen, sodass die dänische Flotte in der Falle säße. Er begründete seinen Plan weitschweifig, obwohl, wie ich glaube, jeder wusste, dass wir für den Bau einer Brücke über einen so breiten Fluss nicht genug Zeit hatten. «Außerdem», sagte König Osbert, «wollen wir doch, dass die Dänen mitsamt ihren Schiffen verschwinden. Sie sollen weg von hier und andere belästigen.» Ein Bischof plädierte für mehr Geduld und sagte, dass Aldermann Egbert, der Herr über das Land im Süden von Eoferwic, noch erwartet und mit seinen Männern das Heer verstärken werde.
«Auch Ricsig ist noch nicht hier», sagte ein Priester, auf einen anderen großen Ratsherrn verweisend.
«Der ist krank», erklärte Osbert.
«Krank an Mut», höhnte Ællas Sprecher.
«Lasst ihnen Zeit», empfahl der Bischof. «Zusammen mit Egberts und Ricsigs Männern schüchtern wir die Dänen allein durch unsere Übermacht ein.»
Mein Vater sagte in dieser Runde nichts, obwohl deutlich war, dass man seine Meinung hören wollte. Sein Schweigen erstaunte mich, wurde mir aber noch am selben Abend von Beocca erklärt. «Wenn er sich für einen Angriff ausgesprochen hätte, wären alle davon überzeugt gewesen, dass er auf Ællas Seite steht – oder eben auf Osberts Seite, wenn er eine Belagerung befürwortet hätte.»
«Macht das einen Unterschied?»
Beocca schaute mich über das Lagerfeuer hinweg an; das heißt, ein Auge war auf mich gerichtet, während das andere in den Nachthimmel hinauswanderte. «Wenn wir die Dänen schlagen», sagte er, «wird die Fehde zwischen Osbert und Ælla neu aufflammen. Und damit will dein Vater nichts zu tun haben.»
«Aber es wird doch ohnehin die Seite gewinnen, die er unterstützt», entgegnete ich.
«Angenommen, Osbert und Ælla fallen. Wer wird dann König?», fragte Beocca.
Ich sah ihn an, verstand und schwieg.
«Und wer wird der übernächste König sein?» Beocca zeigte auf mich. «Du. Und ein König sollte lesen und schreiben können.»
«Ein König», entgegnete ich verärgert, «kann sich Männer verdingen, die für ihn lesen und schreiben.»
Am nächsten Morgen wurde uns die Entscheidung über Angriff oder Belagerung abgenommen, denn es kam die Nachricht, dass in der Mündung des Flusses Humber weitere Dänenschiffe aufgetaucht seien. Der Feind konnte also bald mit Verstärkung rechnen, und mein Vater, der so lange geschwiegen hatte, richtete endlich das Wort an Osbert und Ælla. «Wir müssen angreifen, bevor die neuen Schiffe ankommen.»
Ælla stimmte natürlich begeistert zu, und selbst Osbert sah ein, dass sich mit der Ankunft der neuen Schiffe die Lage entscheidend verändert hatte. Außerdem schienen die dänischen Besatzer der Stadt Probleme mit den Ausbesserungsarbeiten an der Befestigungsanlage zu haben. Ein kräftiger Wind hatte die neu errichteten Palisaden gefällt, was in unserem Lager mit großem Gelächter quittiert wurde. Die Dänen, so hieß es, könnten nicht einmal einen Wall bauen. «Aber sie können Schiffe bauen», sagte Beocca zu mir.
«Und?»
«Wer Schiffe bauen kann, ist gewöhnlich auch imstande, einen Wall zu bauen», antwortete der junge Priester.
«Aber die Pfähle sind umgeknickt.»
«Vielleicht sollten sie das», entgegnete Beocca, und als ich ihn ungläubig anstarrte, fügte er hinzu: «Vielleicht wollen sie, dass wir angreifen.»
Ich weiß nicht, ob er seinen Verdacht meinem Vater gegenüber erwähnte, doch falls er es tat, hat ihn mein Vater zweifellos beiseite gewischt. Beoccas Ansichten in Kriegsdingen interessierten ihn nicht. Der Priester hatte die Aufgabe, himmlischen Beistand zu erflehen, und die erfüllte er gut, denn er betete ausführlich und inbrünstig zu Gott, dass er uns zum Sieg gegen die Dänen verhülfe.
Am Tag nach dem Einsturz der Palisaden gaben wir Gott die Chance, Beoccas Bitten zu erfüllen.
Wir griffen an.
Mag sein, dass nicht alle, die auf Eoferwic zustürmten, betrunken waren, aber es wäre gewiss keiner nüchtern geblieben, wenn es Met, Ale oder Birkenwein in ausreichenden Mengen gegeben hätte. Die ganze Nacht hindurch war gezecht worden, und als ich am Morgen erwachte, sah ich viele Männer in ihrem Erbrochenen liegen. Die wenigen, die wie mein Vater ein Kettenhemd besaßen, legten es an. Die meisten panzerten sich mit Leder, während einige keinen anderen Schutz als ihre Kleider am Leib hatten. Waffen wurden an Wetzsteinen geschärft. Die Priester gingen segnend durchs Lager, und die Männer gelobten einander Bruderschaft und Treue. Manche teilten schon die erwartete Beute unter sich auf. Einige waren sehr blass, und der eine oder andere stahl sich in den Gräben, die das flache, feuchte Land durchzogen, heimlich davon.
Zwanzig Männern wurde befohlen, im Lager zurückzubleiben, um Frauen und Pferde zu schützen. Für Pater Beocca und mich hieß es aufsitzen. «Du bleibst im Sattel», sagte mein Vater, und an Beocca gewandt: «Pass gut auf ihn auf.»
«Natürlich, mein Herr», versprach der junge Priester.
«Falls irgendetwas passiert», äußerte mein Vater vage, «reitet zur Bebbanburg zurück, verriegelt das Tor und wartet.»
«Gott ist auf unserer Seite», sagte Beocca.
Mein Vater sah wie der große Krieger aus, der er war, obwohl er behauptete, zum Kämpfen zu alt geworden zu sein. Sein ergrauter Bart reichte bis über das Kettenhemd, auf dem ein Kruzifix hing, geschnitzt aus Ochsenbein. Gytha hatte es ihm geschenkt. Sein ledernes Waffengehänge war mit silbernen Nieten beschlagen, und das große Schwert, Knochenbrecher genannt, steckte in einer mit bronzenen Bändern verstärkten Lederscheide. Seine Stiefel waren auf beiden Seiten mit Eisenplatten armiert, die mich daran erinnerten, was er mir über den Kampf im Schildwall gesagt hatte. Sein blank polierter Helm war zwischen den Löchern für Mund und Augen mit silbernen Auflagen verziert. Der Rundschild aus Lindenholz mit dem schweren Eisenbuckel in der Mitte hatte einen Lederbezug, der mit dem Wolfskopf bemalt war. Aldermann Uhtred zog in den Krieg.
Hörnerschall rief das Heer zusammen. In den Reihen ging es drunter und drüber. Es hatte Streit darum gegeben, welche Truppen auf welcher Seite vorrücken sollten, bis der Bischof schließlich, wie mir Beocca berichtete, die Schlachtordnung mit dem Ergebnis auswürfeln ließ, dass König Osbert die rechte Flanke stellte, Ælla die linke und die Männer meines Vaters in der Mitte Aufstellung nahmen. Unter ihren jeweiligen Bannern sammelten sich nun, da die Hörner bliesen, alle drei Verbände. Die besten Kämpfer meines Vaters bildeten die erste Reihe; hinter ihnen standen die Thegn, bedeutende Männer mit großem Landbesitz, die bei Festmahlen in unserem Burghaus am Tisch meines Vaters saßen, Männer, die man im Auge behalten musste, weil sie ehrgeizig waren und meinem Vater den Rang streitig machen konnten, sich jetzt aber loyal um ihn scharten. Hinter ihnen nahmen die Ceorl Aufstellung, freie Männer niederen Standes. Sie kämpften in Familiengruppen oder an der Seite von Freunden, darunter auch viele kaum älter als ich. Ich aber war der einzige Junge, der, mit Schwert und Helm gerüstet, auf einem Pferd saß.
Hinter den Palisaden zu beiden Seiten der aufgebrochenen Lücke im Wall hatten einige Dänen Stellung bezogen, doch die meisten Gegner füllten die Lücke aus und bildeten ein lebendes Bollwerk aus Schilden oben auf dem Erdwall, der zehn oder zwölf Fuß hoch war und so steil, dass es schwer werden würde, ihn zu erstürmen, während der Feind nur darauf wartete, zuzuschlagen. Doch ich zweifelte nicht daran, dass wir gewinnen würden. Ich war zehn Jahre alt, fast elf.
Die Dänen brüllten auf uns ein, aber wir waren noch zu weit entfernt, um ihre Beleidigungen hören zu können. Ihre Schilde, rund wie unsere, waren gelb, schwarz, braun und blau bemalt. Unsere Männer fingen an, mit ihren Waffen auf ihre Schilde zu trommeln, und ließen einen Schrecken erregenden Lärm entstehen. Zum ersten Mal hörte ich diese Kriegsmusik: das Krachen von Holzlanzen und Eisenklingen auf hölzernen Schilden.
«Entsetzlich», sagte Beocca zu mir. «Der Krieg ist ein grausames Geschäft.»
Ich sagte nichts. Ich fand alles großartig und wundervoll.
«Der Schildwall ist der Ort, an dem die Männer sterben», sagte Beocca und küsste das hölzerne Kruzifix, das um seinen Hals hing. «Bevor dieser Tag zu Ende ist, werden sich vor den Pforten des Himmels und der Hölle Scharen von Seelen drängen.»
«Werden die Toten nicht in eine Festhalle gebracht?», fragte ich.
Er sah mich zuerst seltsam und dann mit erschütterter Miene an. «Wie kommst du darauf?»
«Das habe ich gehört», antwortete ich und verzichtete wohlweislich darauf zu sagen, dass mir Ealdwulf der Schmied solche Geschichten erzählte, wenn ich ihm dabei zusah, wie er aus glühend heißen Eisenstangen Schwertklingen trieb.
«Daran glauben die Heiden», sagte Beocca streng. «Sie glauben, dass tote Kämpfer in Wotans Festhalle getragen werden, wo gefeiert wird bis ans Ende aller Tage. Ein schändlicher Irrglaube. Aber die Dänen irren ja immer. Sie beugen sich vor ihren Götzen und leugnen den wahren Gott.»
«Aber ist es nicht so, dass ein Mann, der stirbt, ein Schwert in der Hand halten sollte?»
«Ich sehe, wir werden dir, wenn das hier vorüber ist, einen anständigen Katechismus beibringen müssen», entgegnete der Priester.
Ich verkniff mir jede Bemerkung und beobachtete die Geschehnisse, entschlossen, mir jede Einzelheit genau einzuprägen. Der Himmel war sommerlich blau, nur im Westen schwebten ein paar Wolken. Die Lanzenspitzen versprühten Lichtblitze wie die Meereswogen unter der Sonne. Auf den Wiesen blühten Schlüsselblumen, und aus dem Wald, in den sich unsere Frauen zurückgezogen hatten, rief ein Kuckuck. Schwäne glitten über den Fluss, dessen Wasser kein Lüftchen rührte. In Eoferwic stieg der Rauch von Kochfeuern kerzengerade auf, und ich freute mich schon auf das Gelage am Abend, wenn wir nach gewonnener Schlacht Schweinefleisch braten und uns an allem, was in den Vorratsspeichern der Feinde zu finden wäre, gütlich tun würden. Einige unserer Männer aus den vorderen Reihen stürmten vor und forderten die Gegner brüllend auf, sich im Zweikampf zu stellen, doch kein einziger Däne verließ die Stellung. Geduldig warteten sie hinter ihren Schilden, bis unsere Hörner wieder bliesen, worauf das Geschrei und das Trommeln abnahm und unser Heer vorrückte.
Ich wurde ganz wild. Später, sehr viel später, verstand ich, warum die Männer zögerten, sich gegen den Schildwall zu werfen, zumal eine steile Böschung zu erklimmen war. Doch an jenem Tag brannte ich darauf, dass unser Heer die Dänen endlich niederrang. Wäre Beocca nicht eingeschritten, indem er mich am Zügel zurückhielt, hätte ich mich ins Getümmel gestürzt. «Wir warten, bis der Durchbruch gelungen ist», sagte er.
«Ich will einen Dänen töten», protestierte ich.
«Sei nicht töricht, Uhtred», entgegnete Beocca. «Solltest du das versuchen, wird dein Vater keinen Sohn mehr haben. Du bist jetzt sein einziges Kind, und es ist deine Pflicht, am Leben zu bleiben.»
Also beugte ich mich der Pflicht, blieb zurück und sah zu, wie unsere Kämpfer allen Mut zusammennahmen und sich langsam, ganz langsam in Bewegung setzten. Der Fluss lag zu unserer Linken, das leere Lager rechts und die Lücke im Stadtwall direkt vor uns. Dort warteten die Dänen, die vorgehaltenen Schilde dicht an dicht.
«Die Tapfersten gehen an der Spitze», sagte Beocca. «Dein Vater wird zu ihnen gehören. Sie werden einen Keil bilden, das, was die lateinischen Autoren einen porcinum capet nannten. Weißt du, was das bedeutet?»
«Nein.» Es interessierte mich auch nicht.
«Schweinekopf. Gemeint sind die Hauer eines Ebers. Die Tapfersten gehen in der ersten Reihe, und wenn sie durchbrechen, folgen die anderen.»
Beocca hatte Recht. Ganz vorn in unseren Linien bildeten sich drei Keile, bestehend aus den Festungstruppen von Osbert, Ælla und meinem Vater. Die Männer standen so dicht beieinander, dass sich die erhobenen Schilde zu einem Dach zusammenfügten. Mit lautem Brüllen rückten sie vor. Ich hatte erwartet, dass sie rennen würden. Doch dazu waren sie in dieser Formation nicht in der Lage. Der Keil zwang sie zu langsamen Bewegungen, und den darin Eingeschlossenen blieb genügend Zeit, die Stärke des Feindes zu fürchten und sich zu fragen, ob die eigenen Mitstreiter wirklich folgten. Die drei Keile waren noch keine zwanzig Schritt vorgerückt, als sich die Masse der Männer hinter ihnen in Bewegung setzte.
«Ich will weiter vor», sagte ich.
«Du wirst warten», erwiderte Beocca.
Ich hörte inzwischen lautes Geschrei, Rufe des Trotzes und Rufe, mit denen sich die Männer Mut machten. Die Bogenschützen auf dem Stadtwall ließen ihre Pfeile fliegen, und ich sah das Glitzern der Federn, als die Pfeile auf die Keilformationen zuschwirrten, wenig später gefolgt von Speeren, die auf die nach oben gerichteten Schilde zielten. Es erstaunte mich, dass keiner unserer Männer fiel, obwohl in ihren Schilden so viele Pfeile und Lanzen steckten, dass die Keile wie riesige Igel aussahen, die unbeirrt weiter vorrückten. Nun legten unsere Bogenschützen auf die Dänen an, und aus den Keilen lösten sich am hinteren Rand ein paar Männer, um ihre Speere gegen den feindlichen Schildwall zu schleudern.
«Jetzt dauert es nicht mehr lange», sagte Beocca nervös. Er schlug zitternd mit der verkrüppelten Linken ein Kreuz vor der Brust und betete unhörbar.
Ich beobachtete den Keil meines Vaters, den in der Mitte unter dem Wolfskopfbanner. Ich sah die eng aneinander gefügten Schilde im Graben verschwinden, der sich vor dem Erdwall erstreckte, ahnte, dass mein Vater dem Tod gefährlich nahe kam, und drängte ihn in Gedanken, zu siegen, zu töten und dem Namen Uhtred von Bebbanburg noch mehr Ruhm und Ehre zu bringen. Ich sah, wie der Keil einem monströsen Tier gleich wieder aus dem Graben auftauchte und die Böschung hinaufkroch.
«Sie haben einen Vorteil», sagte Beocca in dem ruhigen Tonfall, den er immer anschlug, wenn er mich unterrichtete, «nämlich, dass ihnen, wenn sie von unten kommen, die Füße des Feindes ein leichtes Ziel sind.» Vielleicht versuchte er sich nur selbst zu beruhigen, doch ich glaubte ihm und sah seine Worte bestätigt, als die Formation meines Vaters, als erste auf dem Erdwall angelangt, Kontakt mit dem Feind aufnahm und nicht zurückgeworfen wurde. Jetzt waren nur noch blitzende Schwerthiebe zu erkennen, und ich hörte den Lärm, die wahre Kriegsmusik, das Schlagen von Eisen auf Holz, Eisen auf Eisen. Wie mit den messerscharfen Hauern eines Ebers fuhr der Keil in den Schildwall der Dänen, und obwohl der Feind von allen Seiten auf sie einschlug, drängten unsere Männer weiter vor. Die Mitstreiter hinter ihnen schienen zu spüren, dass Aldermann Uhtred den Widerstand erfolgreich gebrochen hatte, denn plötzlich stürmten sie brüllend herbei, um dem umzingelten Keil beizustehen.
«Gott sei gepriesen», sagte Beocca, als die Dänen die Flucht ergriffen. Hatten sie soeben noch einen waffenstarrenden Schildwall gebildet, stoben sie nun auseinander und verschwanden in der Stadt, von unseren Männern mit Erleichterung darüber gehetzt, noch am Leben zu sein.
«Langsam jetzt», sagte Beocca. Er lenkte sein Pferd nach vorn und führte meins am Zügel.
Die Dänen waren verschwunden. Stattdessen war der Erdwall schwarz von unseren Kämpfern, die sich durch die Lücke im Bollwerk zwängten und in die Straßen und Gassen dahinter ausschwärmten. Die drei Fahnen – der Wolfskopf meines Vaters, Ællas Streitaxt und Osberts Kreuz – wehten innerhalb von Eoferwics Befestigungsanlage. Ich hörte die Männer johlen und trieb mein Pferd so heftig an, dass sich der Zügel aus Beoccas Griff löste. «Komm zurück!», rief er mir nach, doch obwohl er mir folgte, versuchte er nicht, mich zurückzuhalten. Wir hatten mit Gottes Hilfe den Sieg errungen, und ich wollte nahe genug herankommen, um den Geruch der Schlacht wahrzunehmen.
Unsere Männer verstopften die Lücke im Wall, aber ich trat meinem Pferd in die Flanken und trieb es durch die Menge. Einige Männer schimpften, doch als sie das vergoldete Bronzeband auf meinem Helm erblickten und erkannten, dass ich von hoher Geburt war, machten sie mir den Weg frei, während Beocca in der Menge stecken blieb und mir zurief, dass ich auf ihn warten solle. «Komm nach!», rief ich zurück.
Dann hörte ich ihn wieder rufen, aber dieses Mal klang aus seiner Stimme Angst und Entsetzen. Als ich mich umdrehte, sah ich die Dänen über das Feld stürmen, auf dem unsere Truppen vorgerückt waren. Die Horde war offenbar durch das Nordtor der Stadt ausgebrochen, um uns den Rückzug abzuschneiden, und dass wir dazu genötigt sein würden, schienen die Dänen zu wissen, denn es sah so aus, als könnten sie doch Wälle bauen und hätten sie innerhalb der Stadt quer über die Straßen errichtet. Die Verteidiger in der Lücke des Palisadenwalls hatten ihre Flucht nur vorgetäuscht, um unsere Männer in die Falle zu locken. Manche Dänen, die jetzt über das Feld kamen, waren beritten, die meisten jedoch zu Fuß, und Beocca geriet in Panik. Dafür habe ich Verständnis. Die Dänen finden besonderen Gefallen daran, christliche Priester zu töten, und Beocca muss seinen Tod vor Augen gehabt haben. Weil er aber nicht als Märtyrer sterben wollte, riss er sein Pferd herum und galoppierte am Ufer des Flusses davon. Die Dänen ließen ihn laufen; sie kümmerten sich nicht um das Schicksal eines einzelnen Mannes, wo doch so viele in der Falle saßen.
Es ist wohl in den meisten Heeren so, dass, während die tapferen Männer vorne marschieren, die ängstlicheren und diejenigen mit den schwächsten Waffen in den hinteren Reihen nachrücken. Wenn also der Feind einem solchen Heer in den Rücken fällt, gibt es ein Massaker.
Heute bin ich ein alter Mann, und ich habe im Laufe der Zeit häufig Truppen in Panik geraten sehen. Diese Panik ist schlimmer als der Schrecken eingepferchter Schafe, über die Wölfe herfallen, wilder als das Zappeln von Lachsen, die, im Netz gefangen, aus dem Wasser gezogen werden. Der Lärm reicht, um die Himmel aufzureißen, doch für die Dänen war es an diesem Tag der süße Klang des Sieges. Für uns war es der Untergang.