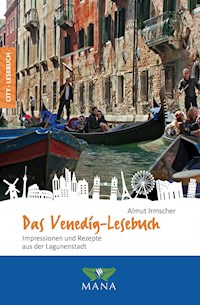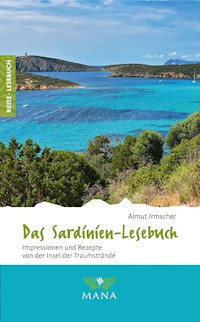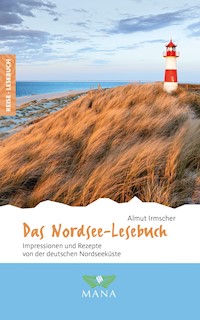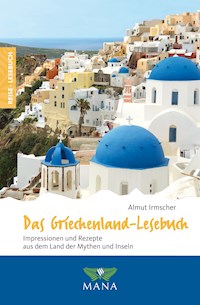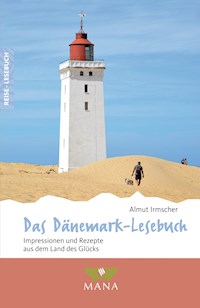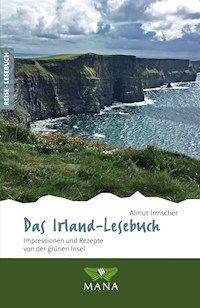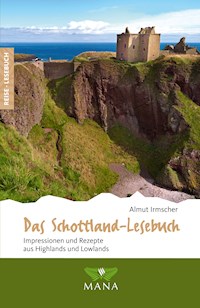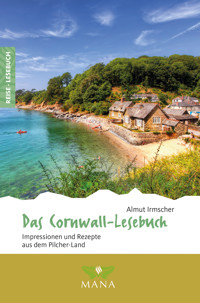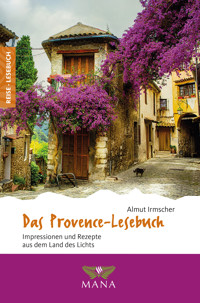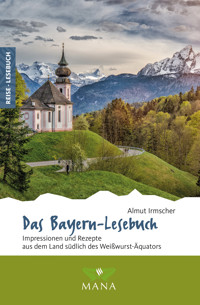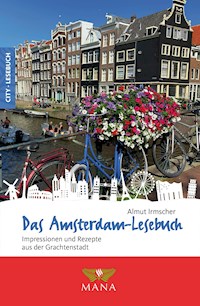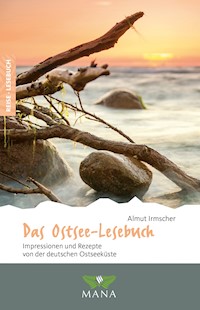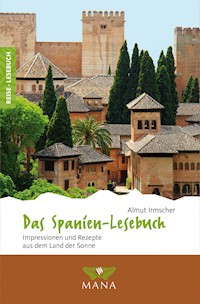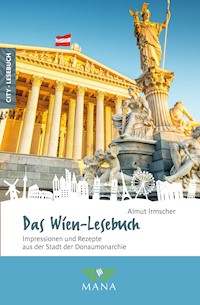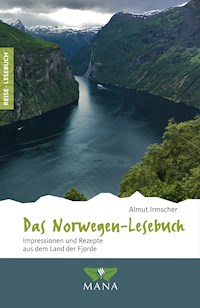
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MANA-Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Reise-Lesebuch
- Sprache: Deutsch
Norwegen – endlose Küsten, jäh aufstürmende Gebirgsgiganten, in bodenlose Tiefen abstürzende Schluchten, eine wahrhaft majestätische Natur, vor der wir Menschen so klein und unbedeutend sind. Tiefblau strahlendes Wasser, gleißender Schnee, die unermessliche Weite unberührter Wälder und windgepeitschter Ebenen – in Norwegen zeigt sich die erhabene Schönheit des Nordens. Mitternachtssonne taucht die geheimnisvolle Anderswelt in märchenhafte Farben, Polarlichter funkeln in der ewigen Nacht. Es ist ein magisches Reich, beseelt von rätselhaften Mythenwesen. Begleiten Sie Almut Irmscher auf ihrer faszinierenden Reise durch Norwegen. Jahrtausendelang haben Menschen mit dieser wilden Natur im Einklang gelebt und eine erstaunliche Kultur erschaffen. Dieses "Norwegen-Lesebuch" erzählt von nordischen Landschaften und Städten, von Künstlern, Königen und Trollen. Der fantastische Weg der Hurtigrutenschiffe rahmt den bunten Reigen, fein abgeschmeckt mit mehr als 20 Rezepten aus der eigenwilligen norwegischen Küche zum Nachkochen und verfeinert mit beeindruckenden Bildern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Almut Irmscher
Das Norwegen-Lesebuch
Impressionen und Rezepte aus dem Land der Fjorde
Einführung
Mit dem Postschiff bis ans Ende der Welt – Hurtigruten
Stekt torsk med rødbeter – gebratener Kabeljau mit roter Bete
Peer Gynt in der Halle des Bergkönigs – die Erschaffung einer Legende
Kanelboller – norwegische Zimtschnecken
Von Händlern, Sportlern und Regen – Bergen
Potetkaker – Kartoffelbratlinge nach norwegischer Art
Landschaft, Zugkraft, Superlative – zwischen Oslo und Bergen
Flatbrød – das traditionelle Brot Norwegens
Schafsköpfe und Schwabbelfisch – Norwegen kulinarisch
Tørrfiskgryte – Stockfischtopf
Mensch und Naturgewalt – vom Geirangerfjord zum Trollstigen
Fårikål – Hammeleintopf
Reise nach Utgard – die Welt der Trolle
Rømmegrøt – eine Grütze aus Sauerrahm
Glatzköpfe und Magier – auf dem Schiff zwischen Trondheim und Brønnøysund
Kvæfjordkake – eine norwegische Baisertorte
Ein Kontinent auf großer Fahrt – die Gestaltung von Norwegen
Potetlomper – dünne Kartoffelpfannkuchen
Vom Mörder zum Wikingerfürsten –Erik der Rote
Fiskepudding – Fischpudding
Der Tiger unter den Städten – Oslo
Kjøttkaker – Fleischbällchen in Sauce
Aus Larvik hinaus aufs Meer – Expeditionen ins Ungegwisse
Hjemmelaget brun lapskaus – Labskaus auf norwegische Art
Himmselsk labskaus – himmlischer Labskaus
Allein in Lofoten – Überleben unter dem Polarlicht
Potetsuppe fra Lofoten – eine Kartoffelsuppe aus Lofoten
71° 10' 21'' – im hohen Norden
Reker i dillsaus – Garnelen in Dillsauce
Landschaft, Kirchen, Nervenkitzel – ein Abstecher ins Setesdal
Elgstek – Elchbraten
Der kleine Grenzverkehr – Kirkenes zwischen den Blöcken
Stekt laks med spisskål – gebratener Lachs mit Spitzkohl
Lappland, Rentiere und Nomaden – das Volk der Samen
Kjære till Lappland – „Liebe zu Lappland“
Reinsdyrgryte – Rentiertopf
Der erste Expressionist – Edvard Munch
Sildsalat – Heringssalat
Lefser – norwegisches Fladenbrot
Vom Trümmerfeld zur Perle des Nordens – Hammerfest
Fiskegrateng – Fischauflauf
Blåbærkake – Blaubeerkuchen
Zwischen Anstand und Skrupellosigkeit – Lilyhammer
Gravlaks – eingelegter Lachs
Felssporn im Eismeer – das Paradies heißt Lofoten
Tilslørte bondepiker – „Verschleiertes Bauernmädchen“
Alkoholfri gløgg – alkoholfreier Grog
Das letzte Wort
Danksagung
Karte
Bilder
Einführung
Jählings stürzt eine Klippe hinab in bodenlose Tiefe, wo ganz unten am fernen Abgrund das Meer im gleißenden Licht der Sonne des Nordens funkelt. Dunkle und unergründliche Wälder bedecken die Hänge, die sich in immerwährenden Ketten aneinanderreihen, bis zum Horizont und darüber hinaus in die Weite einer ewig gleichen Unendlichkeit. Schneebedeckte Gipfel weisen steil empor, dorthin, wo die Götter wohnen. Zwischen ihren bizarren Felsen aber hausen schreckliche Riesen und boshafte Trolle. Hier liegt ein Reich, das keines Menschen Fuß betreten soll: Utgard, das unberührbare Land geheimnisvoller Mythenwesen.
Doch duckt sich nicht ganz unten am Ufer ein kleines rotes Holzhaus mit grasbewachsenem Dach vor den machtvoll gen Himmel stürmenden Felshang? Wie die Heimstatt flohgroßer Wichte wirkt es gegen die gewaltigen Dimensionen der umliegenden Natur. Ein Fischerboot dümpelt davor auf den plätschernden Wellen, an einem Holzgestell trocknen Fische in der rauen Luft. Eine eisige Windböe rüttelt daran, als wollte sie fragen: „Was tut ihr Menschen hier? Dies Land ist nicht für euresgleichen, trollt euch dorthin, wo es euch besser taugt!“
Nur in wenigen Gegenden Europas prallen die Gegensätze zwischen wilder, unbezwingbarer Natur und menschlicher Zivilisation so dramatisch aufeinander wie in Norwegen. Obwohl annähernd von der gleichen Flächenausdehnung wie Deutschland, leben hier nur gut fünf Millionen Einwohner. Statistisch gesehen sind das 13 pro Quadratkilometer, im Gegensatz zu den 230, die sich auf der gleichen Fläche in Deutschland zusammendrängen.
Die Weite und Einsamkeit, die sich hinter den Zahlen verbirgt, veranschaulicht eine Fahrt entlang der endlosen Fjordküsten Norwegens recht drastisch. An die wenigen menschlichen Siedlungen im Uferbereich schließen sich sturmumtoste Gebirgsketten von unvorstellbaren Ausmaßen an. Sie führen dem Betrachter sehr eindringlich vor Augen, warum die nordische Mythologie außer der Midgard genannten Menschenwelt noch zwei weitere Welten kennt: Utgard, wo Riesen und Trolle wohnen, und Asgard, das Reich der Götter.
Aber nicht nur die dünne Besiedlung unterscheidet Norwegen von Deutschland. Mit gutem Willen gemessen dehnt sich Deutschland von seinem nördlichsten Punkt auf Sylt bis zu seinem südlichsten Flecken am Königssee im Berchtesgadener Land gerade mal 900 Kilometer in geografischer Länge aus. Norwegen hingegen streckt sich vom südlichsten Punkt in Kristiansand bis zum nördlichsten am Nordkap über rund 1.600 Kilometer geografischer Länge. Betrachtet man die tatsächliche Landeslänge unabhängig von den geografischen Koordinaten, so summieren sich sogar 2.650 Kilometer, und das bei einer Landesbreite, die mitunter nur rund 50 Kilometer beträgt.
Diese Zahlen täuschen jedoch über die wirklichen Gegebenheiten noch immer hinweg. Denn Norwegens Küste ist durch zahllose Fjorde zerklüftet, und weil sie sich von der schwedischen Grenze im Südosten bis zur russischen im Nordosten um das ganze Land herumzieht, ergibt sich eine Küstenlinie von sagenhaften 25.000 Kilometern. Rechnet man die vielen Inseln hinzu, dann sind es sogar unvorstellbare 80.000 Kilometer.
Kein Wunder also, dass die Norweger ein Volk von Seefahrern sind. Und angesichts der herben Unzugänglichkeit und der bescheidenen Fruchtbarkeit ihres Landes erstaunt es auch nicht, dass sich eroberungshungrige Freibeuter von Norwegens Gestaden aus auf den Weg machten. Rücksichtslos überfielen diese Nordmänner die Küsten jener Länder, von denen sie sich reichere Ausbeute versprachen. An Bord ihrer windschnellen Schiffe gelangten sie bis nach Nordamerika, übers Mittelmeer drangen sie in den Orient vor und über Flussläufe bis tief ins europäische Festland hinein. Allerorts fürchtete man die wilden Wikinger, doch wo es sich ergab, trieb man auch gerne Handel mit ihnen. Ihre bärbeißige und raubeinige Kultur hat Norwegen geprägt und schlummert noch heute tief verborgen in der Seele des Landes, wenngleich sie längst gezähmt und überaus zivilisiert daherkommt.
Denn Norwegen gehört zu den Musterschülern unter den Staaten der Welt. Nach der Loslösung von der jahrhundertelang bestehenden Personalunion mit Dänemark und in der Folgezeit mit Schweden entschieden sich die Norweger im Jahr 1905 in einer Volksabstimmung für einen eigenen König. Es herrscht eine konstitutionelle Monarchie, das demokratisch gewählte Parlament ist Entscheidungsträger des Landes und gilt als ausgesprochen pragmatisch und konsensfähig. Dass im internationalen Vergleich überdurchschnittlich viele Frauen an der Regierung beteiligt sind, liegt auch daran, dass Norwegen neben Finnland bei der Emanzipation eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Schon 1884 trat hier die Frauenrechtsvereinigung aufs politische Parkett, zu einer Zeit, als anderenorts noch gar nicht daran zu denken war.
Norwegen ist nicht Mitglied der Europäischen Union, aber Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum und Unterzeichner des Schengener Abkommens. De facto ist das Land deshalb in vielerlei Hinsicht den Mitgliedern der Union gleichgestellt. Das gilt auf der rechtlichen Ebene, denn auf der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Seite stellt Norwegen die anderen weit in den Schatten: Beim von den Vereinten Nationen erstellten Wohlstandsindikator der Staaten unserer Welt, dem sogenannten „Index der menschlichen Entwicklung“, steht Norwegen seit 1997 an erster Stelle. Nur Island gelang es 2007 und 2008, Norwegen vorübergehend auf den zweiten Platz zu verweisen. Im „World Happiness Report“ der Vereinten Nationen streiten Norweger, Isländer und Dänen seit Jahren um den Titel des glücklichsten Volks der Erde, 2017 hatten die Norweger erstmals die Nase vorn.
Die durchschnittliche Lebenserwartung in Norwegen liegt bei knapp 83 Jahren. Das Land hat den welthöchsten Lebensstandard, eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen, ein großzügiges Wohlfahrtsstaatsmodell und ein innovationsfreudiges Bildungssystem, bei dem die staatlichen Ausgaben im internationalen Vergleich einen Spitzenplatz einnehmen. Auch Kunst und Kultur werden sehr engagiert gefördert, damit selbst die extrem dünn besiedelten Landesteile mit einem kulturellen Grundangebot versorgt sind. Die Hauptstadt Oslo gilt als eine der trendigsten Metropolen der Welt. Und die von „Reporter ohne Grenzen“ veröffentlichte Welt-Rangliste der Pressefreiheit führt Norwegen 2018 vor 180 weiteren Ländern an, in den Jahren davor belegte es nie einen schlechteren als den dritten Rang.
Auf die Unterstützung wissenschaftlicher Forschung legt die norwegische Regierung erheblichen Wert. Die Arbeitslosenquote überschreitet nur selten die Drei-Prozent-Marke. Der norwegische Pensionsfond zählt zu den größten Vermögensverwaltern der Welt, hier ist die Rente wirklich sicher. Straßen, Brücken und Tunnel verbinden auch noch die abgelegensten Landesteile und viele Inseln miteinander. Bei der durchschnittlichen Internetgeschwindigkeit liegt Norwegen zusammen mit Schweden und Südkorea an der weltweiten Spitze, Deutschland hinkt weit abgeschlagen hinterher. Und trotz aller großzügigen Investitionen weist der norwegische Staatshaushalt einen freundlichen Überschuss auf. Wie ist das möglich?
Vor noch nicht allzu langer Zeit galt Norwegen als die Bettelstube unter den europäischen Ländern. Mit Fischfang, Holzfällerei und Seefahrt ließ sich nicht allzu viel verdienen. Doch in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts änderte sich die Situation schlagartig: Vor Norwegens Küste wurden üppige Mineralöl- und Erdgasvorkommen entdeckt. Seit damals brummt Norwegens Wirtschaft. Das Land stieg zu einem der weltweit bedeutendsten Öl- und Gasexporteure auf, infolgedessen entstanden massenweise Arbeitsplätze. Doch auch andere Wirtschaftszweige profitierten vom landesweiten Boom, sodass Norwegen heute auch bei sinkenden Ölpreisen auf der Basis eines stabilen Wohlstands floriert.
Nicht zuletzt haben die Norweger trotz ihres Reichtums an fossilen Brennstoffen schon früh auf regenerative Energiequellen gesetzt und decken heute fast den gesamten Strombedarf des Landes aus Wasserkraft. Wasser gibt es im Überfluss, der Strom ist entsprechend billig. Deshalb werden norwegische Häuser ganz selbstverständlich elektrisch beheizt, und niemand legt Wert darauf, das Licht auszuschalten. Norwegens Stromverbrauch ist einer der höchsten weltweit, aber was soll’s? Schließlich ist Norwegen auch Vorreiter bei der Neuzulassung von Elektroautos, deren Fahrer können an mehreren tausend Stationen landesweit kostenlos ihre Akkus aufladen.
Das Bild des Musterlandes wird eigentlich nur vom kommerziellen Walfang getrübt. Obwohl diese Praxis allgemein geächtet ist, lassen sich die Norweger nicht davon abbringen. Sie fangen sogar mehr Wale als Japaner und Isländer zusammen. Norwegen argumentiert mit der Nachhaltigkeit seines Walfangprogramms, das ausschließlich auf die reichlich vorhandenen Zwergwale ausgerichtet ist, und außerdem damit, dass die Jagd auf Wale für das Land eine lange Tradition hat. Tatsächlich war es in erster Linie Norwegen, das im 19. Jahrhundert Europas rasant steigenden Bedarf an dem aus Walfett gewonnenen Tran deckte. Bis heute ist das Fleisch der Meeressäuger von norwegischen Speisekarten nicht wegzudenken, die Bevölkerung steht deshalb mehrheitlich hinter der Walfängerei.
Vielleicht wird das verständlich, wenn man einen Blick auf die althergebrachten Zutaten der norwegischen Küche wirft. Das skandinavische Klima mit seinen kurzen, feuchten und kühlen Sommern sowie seinen ausgeprägten, kalten Wintern lässt keinen Raum für den breitgefächerten Anbau von Getreide, Obst und Gemüse. Neben Hafer, Gerste, etwas Wurzelgemüse und Kartoffeln stehen im Wesentlichen nur Milchprodukte zur Verfügung, dazu ein wenig Fleisch und insbesondere das, was das Meer hergibt. Fisch ist deshalb die Grundlage der norwegischen Küche, Walfleisch eine willkommene Abwechslung.
Die klimatischen Besonderheiten und die Extreme der Geografie ihres Landes haben die Norweger geprägt, und beides beeinflusst auch maßgeblich ihre Musik und ihre Literatur. Das erklärt die mystischen Züge in den Werken von Schriftstellern wie Henrik Ibsen oder die düsteren Abgründe in den Geschichten moderner Krimiautoren wie Jo Nesbø. Es erklärt die Finsternis in der Musik der norwegischen Black-Metal-Bands und andererseits die sehr melancholischen Balladen der Boygroup a-ha, die in den Achtzigerjahren als Lichtgestalt aus der norwegischen Pop-Szene hervorstrahlte.
Und wer die weiten Fjorde im Norden des Landes durchreist, dem klingt ganz wie von selbst eine Melodie in den Ohren. Ihre hochromantische Melodramatik beschreibt Norwegen intensiver, als jeder Text dies könnte: Edvard Griegs berühmte Peer-Gynt Suite. Wenn Solveig ihr Lied in der Halle des Bergkönigs anstimmt, dann ist das mythenumwobene Utgard der Riesen und Trolle mit einem Mal ganz nah.
Velkommen til Norge – willkommen in Norwegen!
Mit dem Postschiff bis ans Ende der Welt – Hurtigruten
Wir haben bereits festgestellt, dass Norwegen ein ausgesprochen langes Land ist. Das zieht mehrere Konsequenzen nach sich. Zum einen bedingt es wirklich weite Wege, zum anderen bedeutet es auch, dass Norwegen sich über verschiedene Klimazonen erstreckt. Der Golfstrom sorgt zwar dafür, dass es an Norwegens Küsten durchweg relativ mild ist. Doch im Landesinneren schwindet die wärmende Wirkung des Golfstroms, sodass hier kontinentales Klima für wärmere Sommer und wirklich eisige Winter sorgt. Die Hochebenen sind deshalb entsprechend dünn besiedelt, nur in den Tälern findet man mehr Bewohner. Insgesamt bietet der Süden des Landes in den Küstenregionen das freundlichste Wetter, weshalb hier auch die meisten Leute wohnen.
Doch auch an den Küsten hoch im Norden leben Menschen. Hier, bei den Inseln von Lofoten, Vesterålen und in der Barentssee, gibt es nämlich ausgesprochen reiche Fischgründe. Bis zur Entdeckung der fossilen Rohstoffe lebten die Bewohner dieser Regionen fast ausschließlich vom Fischfang. Besonders in den Wintermonaten hat die Fischerei Hochkonjunktur, denn dann kommen die Dorsche aus dem äußersten Norden, um in den südlicher gelegenen Meeresregionen zu laichen (man nennt sie dann Kabeljau). Schon seit dem 12. Jahrhundert blühte der Handel mit diesen Fischen, die über den Winter hinweg vor Ort zu Stockfisch getrocknet wurden. Und weil es damit recht ordentlich zu verdienen gab, kamen auch viele Fischer aus anderen Landesteilen als Gastarbeiter im Winter an die nördlichen Küsten.
Doch diese Gebiete sind schwer zu erreichen. Gut befahrbare Straßen gab es bis weit ins letzte Jahrhundert hinein kaum, und selbst wenn, so waren sie im Winter meist unpassierbar. Inseln und von Gebirgen abgeschottete Küstenteile konnte man über Land gar nicht erreichen. So gab es nur die Möglichkeit, auf Schiffen zu reisen, doch auch das gestaltete sich im Winter nicht einfach. Zwar verkehrten ab und zu Segelschiffe, nahmen den Fischfang und mitunter auch Passagiere an Bord. Doch bei stürmischem Wetter und in der langen Polarnacht traute sich niemand mehr hinaus. An eine regelmäßige Schiffsverbindung war nicht zu denken. So kam es, dass Norwegens Norden in den langen Wintern von der Außenwelt abgeschnitten vor sich hinvegetierte.
Eine wirklich ungünstige Situation. Nicht nur, dass die Menschen keinerlei Möglichkeit hatten, sich mit Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs zu versorgen. Sie konnten auch den gefangenen Fisch nicht zum Verkauf abtransportieren. So blieb ihnen keine andere Möglichkeit, als ihre Beute zu trocknen, den eigenen Speiseplan auf Fische und die paar Reste, die vom kargen Sommer übriggeblieben waren, zu beschränken und ansonsten auf den Frühling zu warten. Doch dieser ziert sich in den Regionen nördlich des Polarkreises recht lange, bis er endlich sein blaues Band wieder durch die Lüfte flattern lässt.
Besser wurde es erst, als 1870 die Hamburgroute ihren Betrieb aufnahm. Ihre Dampfschiffe verkehrten auf einer dreiwöchigen Reise zwischen Hamburg und Finnmark, jenem Teil Norwegens, der im äußersten Nordosten des Landes liegt. Heute leben hier durchschnittlich nur 1,5 Bewohner pro Quadratkilometer, und damals, vor der Entdeckung von Öl und Gas, mögen es noch deutlich weniger gewesen sein. Was also veranlasste die Hamburger zu der beschwerlichen Überfahrt in diese gottverlassene Gegend?
In Finnmark lebte seit jeher das Volk der Samen. Sie trieben regen Handel mit Pelzen, in den Küstenregionen beteiligten sie sich an den Geschäften der Hanse. Das mag die Hamburger auf die Idee gebracht haben, doch kamen sie auf ihrer Hamburgroute keinesfalls, um Felle zu kaufen. Vielmehr hatten sie es auf Vogelexkremente abgesehen, besser gesagt, auf Guano. Finnmark ist eines der bedeutendsten Vogelgebiete im Norden. Heute reisen Ornithologen und Vogelfreunde auf die Varanger-Halbinsel, um Merline, Seeadler, Gerfalken, Austernfischer, Singschwäne, Eiderenten und jede Menge Möwen zu beobachten.
Doch warum nahmen die Hamburger die Mühen auf sich, nur um Vogeldreck in die Heimat zu schaffen? Das 19. Jahrhundert brachte die Industrialisierung mit sich, und damit auch ein starkes Bevölkerungswachstum. Um all die hungrigen Mäuler zu stopfen, musste die Landwirtschaft sich ins Zeug legen. Irgendwann stellten findige Landwirte fest, dass sich mit Guano die Erträge deutlich steigern ließen. So legte er eine steile Karriere als Düngemittel hin, außerdem konnte man ihn auch noch als Zutat zur Sprengstoffherstellung gebrauchen. Guano stellte also ein äußerst wertvolles Gut dar.
Doch in den harten, stürmischen und vor allem stockfinsteren Wintern wurde selbst den orkanerprobten Hamburgern die Reise nach Finnmark zu beschwerlich. Man konnte sich einfach nicht auf sie verlassen. Die Regierung in Christiania (1924 umbenannt in Oslo) war sich des Problems vollkommen bewusst. Während der Süden einigermaßen prosperierte, dümpelte der isolierte Norden in Armseligkeit vor sich hin. Ein Staat, der auf sich hielt, konnte ein derart ungerechtes Süd-Nord-Gefälle aber schwerlich hinnehmen, noch dazu in einer Zeit, in der sich die Welt mit rasanter Geschwindigkeit weiterentwickelte.
So keimte gegen Ende des 19. Jahrhunderts schließlich der Gedanke auf, eine staatlich geförderte Schifffahrtslinie ins Leben zu rufen, die die nördlichsten Orte des Landes regelmäßig mit den Küstenstädten im Süden verbinden würde. Auf diese Art sollten die Menschen im Norden – ganz im Sinne einer fortschrittlichen Kommunikation – zuverlässig mit Postlieferungen versorgt werden. Es handelte sich keineswegs um ein einfaches Unterfangen, denn die Fahrt entlang der stürmischen und felsigen Küsten gestaltete sich besonders zur düsteren Winterzeit äußerst riskant. Nur ausgefuchste Profis konnten das mit der damals verfügbaren, noch recht einfachen Technik bewerkstelligen.
Trotzdem nahm 1893 die erste fahrplanmäßige Verbindung zwischen Trondheim und Hammerfest mit insgesamt neun Zwischenstopps ihre Fahrt auf. Der Kapitän, der sich dies zutraute, hatte die Strecke zuvor elf Jahre lang penibel in Augenschein genommen und genaueste Aufzeichnungen angefertigt. Deshalb wagte er es nun auch, bei völliger Dunkelheit zu fahren. Dass die Schiffe zu allen Jahreszeiten ununterbrochen unterwegs sein würden, gewährleistete eine rasche und zuverlässige Postzustellung. Und nur, wenn diese Bedingung erfüllt wurde, gewährte der Staat die entsprechenden Subventionen. Schnell – hurtig – sollte die Post auf der Route vorankommen, mit einem Wort: Hurtigruten!
Bereits 1908 kam das Postschiff zweimal in der Woche. Von Hammerfest gab es jetzt eine weitere Verbindung bis nach Kirkenes an der russischen Grenze, und weil es nun schon in Bergen losging, war die gesamte Westküste Norwegens mit Postlieferungen versorgt. Für die rund 2.500 Kilometer von Bergen bis Kirkenes benötigten die Schiffe nur sieben Tage und machten damit dem Namen „Hurtigruten“ alle Ehre.
Doch natürlich transportierten die Schiffe nicht nur die Post, sondern auch allerhand Dinge des täglichen Bedarfs. Und mehr noch: Sie nahmen auch Passagiere an Bord.
Das Leben der Menschen im Norden änderte sich grundlegend, und es änderte sich für ganz Norwegen. Denn erstmals empfanden sich alle Norweger als Einheit miteinander verbunden. Auf einmal war es kein Problem mehr, fernab gelegene Landesteile zu besuchen und Kontakte mit den dort lebenden Landsleuten zu pflegen.
Weil die Fahrt – je nach Entfernung – eine Weile dauert, lief 1925 das erste Schiff mit komfortablen Kabinen vom Stapel. Immerhin boten diese fließendes Wasser und Frischluftversorgung. Schon zehn Jahre später reisten Jahr für Jahr knapp eine Viertelmillion Passagiere auf der Hurtigruten, die inzwischen 14 Schiffe befuhren. Für die meisten Fahrgäste gab es allerdings nur Mehrbettkabinen, genannt „Sleeperette“, mit zehn einfachen Pritschen.
Während der Besetzung des Landes durch Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg wurden die meisten Hurtigrutenschiffe beschlagnahmt oder zerstört. Doch auch in diesen harten Jahren setzten die Norweger alles daran, den Norden ihres Landes weiterhin zu versorgen, und schickten kurzerhand Fischkutter und kleinere Frachtkähne auf den Weg. Gleich nach dem Krieg rief man ein staatlich gefördertes Schiffsbauprogramm auf den Plan, und bald darauf liefen zehn nagelneue Hurtigrutenschiffe vom Stapel. Schon Anfang der Fünfzigerjahre nahmen diese und die drei älteren, die die Kriegszeit überstanden hatten, jährlich insgesamt eine halbe Million Gäste mit auf die Reise. Heute fahren elf Schiffe auf der Hurtigrutenstrecke. Das älteste davon ist die MS Lofoten, die 1964 ihren Dienst aufnahm. Alle anderen Schiffe sind jüngeren Datums. Doch längst schon dient die Hurtigruten nicht mehr schwerpunktmäßig der Versorgung der nördlichen Siedlungen. Inzwischen gibt es fast bis in den letzten Winkel Norwegens gute Straßenanbindungen, und außerdem haben alle abgelegenen Städtchen einen eigenen Flugplatz. Diese Entwicklung führte zu einem drastischen Rückgang der Passagierzahlen und der Warentransporte.
So kam es, dass die Bilanz der Hurtigrutengesellschaft in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts so trübe ausfiel, dass ernsthaft über die Einstellung des Linienverkehrs nachgedacht wurde. Doch dann hatte jemand eine zündende Idee. Warum nicht auf Touristen setzen?
Dieser Plan wurde konsequent verfolgt. Die Schiffe wurden modernisiert oder neu gebaut, dabei lag nun der Schwerpunkt auf Komfort und Reisebequemlichkeit des neuen Zielpublikums. Die Kabinen erhielten eigene WCs und Duschen. Restaurant, Cafeteria, Bar, später auch Panoramadecks, Whirlpools und organisierte Landausflüge sorgten für weitere Attraktivität.
So kommt es, dass seit den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts immer mehr Touristen aus aller Welt die Hurtigruten für sich entdecken. Die Fahrt durch die norwegischen Fjorde gilt als eine der schönsten Kreuzfahrten der Welt und ist entsprechend begehrt, auch wenn sie nicht gerade zu den Schnäppchenangeboten der Branche zählt. Rund 450.000 Fahrgäste begeben sich heutzutage alljährlich an Bord eines der Schiffe, die so schöne Namen wie „Midnatsol“, „Polarlys“ oder „Trollfjord“ tragen.
Der Traum seines Lebens sei es, einmal auf einem Hurtigrutenschiff zu reisen, sagt mein Mann schon seit Jahren. Von Bergen nach Kirkenes und wieder zurück, zwölf Tage, 34 Häfen, mehr als 100 Fjorde und insgesamt 2.795 nautische Meilen, das sind beachtliche 5.176 Kilometer.
Worauf sollen wir noch warten? Machen wir uns also auf die Reise und erkunden wir Norwegen! Doch bevor es losgeht, tasten wir uns mit einem ersten Rezept vorsichtig an die norwegische Küche heran. Danach schließen wir noch einmal die Augen und lauschen der Musik von Edvard Grieg. Könnte es eine schönere Einstimmung geben?
Stekt torsk med rødbeter – gebratener Kabeljau mit roter Bete
Zutaten für 4 Personen:
4 Kabeljaufilets à ca. 200 g
400 g Rote Bete (gegart)
20 ml Apfelessig
2 Eier
1 kl. Bund Blattpetersilie
120 g Butter
40 g Butterschmalz
1 El brauner Zucker
Salz
Pfeffer
Zubereitung:
Die Eier hart kochen, abkühlen lassen, schälen und dann fein würfeln. Die Petersilienblättchen abzupfen und fein hacken. 100 g Butter zerlassen, vom Herd nehmen, Petersilie und Eier unterheben, salzen, pfeffern und abkühlen lassen.
Die Rote Bete fein würfeln. Die restliche Butter in einem Topf zerlassen, den Zucker hinzugeben und leicht karamellisieren lassen, mit dem Apfelessig ablöschen und anschließend die rote Bete hinzugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und bei milder Hitze 10 Minuten lang ziehen lassen, gelegentlich rühren.
Die Fischfilets waschen, trocken tupfen und von beiden Seiten salzen und pfeffern. Das Butterschmalz in einer beschichteten Pfanne gut erhitzen und die Filets von jeder Seite 1 bis 2 Minuten goldbraun anbraten, dann die Hitze reduzieren und 4 Minuten lang fertig garen.
Die Rote Bete auf vier Tellern verteilen, je ein Fischfilet darauflegen und zum Schluss die Ei-Petersilienbutter dazugeben. Mit Salzkartoffeln servieren.
Am besten schmeckt dieses Gericht mit Skrei, dem Winterkabeljau, der vor Norwegens Nordküsten gefangen wird. Als Dorsch wächst dieser Fisch im Nordpolarmeer fünf bis sieben Jahre lang heran. Dann erreicht er seine Geschlechtsreife und wandert zum Laichen südwärts, bis er die etwas wärmeren Gewässer Nordnorwegens erreicht hat. Man nennt ihn dann Kabeljau.
Vor Norwegens Nordküste wird er zwischen Januar und April gefangen, traditionell mit der Handangel oder der Langleine. Sein Fleisch ist hell weiß, mager und fest. In Norwegen schätzt man auch seine Bäckchen und die Zunge als Delikatesse. Skrei, der nicht frisch verzehrt wird, trocknet über mehrere Wochen hinweg in der eisigen Luft zu Stockfisch.
Die kleineren Kabeljauarten der Ostsee heißen ebenfalls Dorsch. Der norwegische Kabeljau ist länger, von spitzer zulaufender Form und hat einen kleineren Kopf. Außerdem ist er fettärmer.
Peer Gynt in der Halle des Bergkönigs – die Erschaffung einer Legende
„Lieber Herr Grieg! Ich richte diese Zeilen an Sie, da ich einen Plan hege, den ich auszuführen gedenke, und weswegen ich Sie fragen möchte, ob Sie sich daran beteiligen.“ Der junge Edvard mit dem wallenden Haupthaar lehnte sich in seinem Schreibtischsessel zurück und strich gedankenverloren über den markanten Schnauzbart, den er sich vor kurzem zugelegt hatte. Mit ernster Miene betrachtete er das elfenbeinfarbene Briefpapier mit der schwungvollen Handschrift, das vor ihm auf dem Pult lag, und las den etwas sperrig formulierten Satz noch einmal. Fast schien es ihm, als atme dieser Brief einen heiligen Ernst, als sei er ein papierner Ritterschlag, eine ehrenvolle Anerkennung, die ihm endgültig die Weihe eines großen Künstlers zuteilwerden ließ.
Neun Jahre zuvor hatte Edvard Grieg den Verfasser dieses folgenschweren Briefes in Rom kennengelernt. Der 15 Jahre ältere Mann hatte ihn damals tief beeindruckt. Edvard selbst zählte zu jenem Zeitpunkt erst 22 Jahre, doch spürte er in sich eine große kreative Kraft, die mit Macht nach künstlerischer Entfaltung strebte. Er wollte komponieren, das wusste er bereits, seit ihm seine Mutter als Sechsjährigem das Klavierspielen beigebracht hatte. Sie, eine begnadete Musikerin, mühte sich geduldig, ihm die nötige Bedachtsamkeit und das gelassene Einfühlungsvermögen für die harmonischen Klänge mozartischer Klavierstücke zu vermitteln. Doch er wollte davon nur wenig wissen. Am liebsten dachte er sich nämlich eigene Melodien aus, und schon mit neun kritzelte er eifrig seine eigenen Klanggefüge auf Papier. Es drängte ihn, seine noch diffusen Ideen weiter zu entfalten, doch in der biederen musikalischen Gesellschaft seiner Heimatstadt Bergen traf er damit auf wenig Verständnis und fand keinerlei schöpferische Inspiration.
Nur Ole Bull, ein umjubelter Geigenspieler, der die regelmäßigen Musizierkreise in Edvards Elternhaus besuchte, machte sich für den Jungen stark. Dessen überbordendes Talent war dem Profimusiker nicht entgangen, und gemeinsam mit der Mutter überzeugte Bull Edvards Vater, dem Burschen eine geeignete Ausbildung zukommen zu lassen. An Geld mangelte es nicht, denn der Vater verdiente als gut etablierter Bergenser Fischgroßhändler und Konsul Großbritanniens ein stattliches Auskommen. So gelang es dank Bulls Fürsprache, Edvard schon im Alter von 15 Jahren einen Studienplatz am renommierten Konservatorium von Leipzig zu besorgen.
Die vier Jahre, die Edvard dort verbrachte, waren keine leichte Zeit für ihn. Er litt unter Heimweh und unter den rigiden Lehrmethoden, vor allem aber unter den unablässigen Übungsstunden, die er als stumpfsinnig empfand. Welche Erleichterung, als er 1862 endlich nach Bergen zurückkehren konnte! Nun, so glaubte er in seinem jugendlichen Enthusiasmus, stünde einer großen Karriere in seiner norwegischen Heimat nichts mehr im Wege. Aber er wurde enttäuscht. Zwar fanden seine Auftritte durchaus Anklang, doch empfand er die Enge des gestalterischen Rahmens, den das konservative Publikum ihm zubilligte, als unerträgliches Korsett.