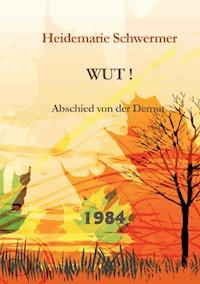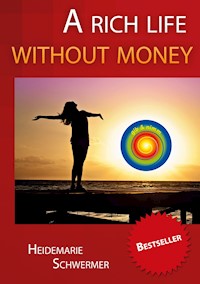Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Zwischen 1996 und 2016 lebte Heidemarie Schwermer ohne Geld. Schritt für Schritt ist die ehemalige Lehrerin und Psychotherapeutin aus den bestehenden Strukturen ausgestiegen und in eine neue Freiheit hineingewachsen. Ihr Buch ist nicht nur die Beschreibung eines intensiv und engagiert gelebten Lebens, sondern zugleich eine Ermutigung, unser Wertesystem zu überdenken und alternative Formen des Miteinanders zu wagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1 Lehr- und Wanderjahre
Das Versprechen
Das Internat – ein Schritt in die Freiheit
Studium – eine neue Welt
Theorie und Praxis
Karneval in Rio
Santiago de Chile – Tor in eine andere Welt
Erinnerung an ein Versprechen
Das Kunsthaus – eine ideale Lebensform
Eine Tür wird geöffnet
Der Weg nach innen
Ein Schritt nach vorn
Meine Kinder flippen aus
Ganz unten
Umzug in die Großstadt
Schulung in Spiritualität
2 Die »Gib-und-Nimm-Zentrale«
Eine zündende Idee
Der Beginn von »Gib-und-Nimm«
Das erste gemeinsame Treffen
Die erste Liste
»Gib-und- Nimm« und das Geld
Verrechnungen
Konflikte
Konfliktlösungen
Die »Gib-und-Nimm«-Feste
Ein Haus für »Gib-und-Nimm«
3 Das Experiment geht weiter
Mein Leben ohne Geld
Abschied vom Besitz
Ohne Krankenversicherung
Das erste »fremde« Zuhause
Mein täglich Brot
Kleidung
Wunder
Post und Telefon
Erster Aufbruch
Reisen
Probleme
Die Medien merken auf
4 Abenteuer Alltag
Menschen
Familienanschluss
Tiere
Pflanzen
Gesucht und gefunden
Einsamkeit
Vorträge
Alternative Projekte
Kultur
Putzen
Ungeduld
Einbrecher
5 Märchen werden wahr
Sterntaler
Loslassen
Neue Werte
Gottvertrauen
Vom Geben und Nehmen
Spiegelungen
Gedankenkraft
Das hässliche Entlein
Sichtweisen
Annehmen
Das Paradies
Angekommen
6 Zukunftsvisionen
Auszüge aus meiner Homepage
Die Politikerin
Der Langzeitarbeitslose
Umpolung
Dankbarkeit
Pioniere
Lebensmodelle
Lektionen
Geldsorgen
Träume
Mitteilungen
Was nun?
Weitere Pläne
Politik der kleinen Schritte
Ein paar Ratschläge für unterwegs
7 Dialoge und Diskussionen
Ein Leben ohne Geld.Von Carsten Günther
E-mail- Austausch mit Rudi Eichenlaub
8 Blick über den Tellerrand
Das neue Geld der Armen.Von Romeo Rey (Buenos Aires)
ERSTER TEIL
KAPITEL 1
Lehr- und Wanderjahre
Das Versprechen
Zu meinem zweiten Geburtstag bekam ich eine Puppenstube. Meine Freude muss groß gewesen sein, jedenfalls sehe ich mich noch heute begeistert durchs Zimmer springen und lachend in die Hände klatschen. Meine beiden älteren Brüder, meine Mutter und Ella, das Kindermädchen, freuten sich gut gelaunt mit der Kleinen. Wir lebten damals in Memel, wo mein Vater eine Kaffeerösterei hatte. Gehabt hatte. Jetzt war er schon länger fort, im Krieg, sagten die Großen.
Mir waren nur wenige glückliche Monate mit meinem kleinen Spielzeugreich vergönnt. Im Sommer 1944 spürte ich im Haushalt eine Unruhe, die mir zunächst unerklärlich blieb. Erst verschwand die heißgeliebte Puppenstube auf dem Dachboden, dann wurden alle Möbel im Haus mit Decken verhängt. Mutter und Großmutter begannen, verschiedene Sachen für eine Reise zusammenzupacken. Nur das Nötigste, versicherten sie einander, wir kommen doch bald zurück. Und dann stand wieder einmal das Pferdefuhrwerk bereit, mit dem wir schon so manchen Sonntag fröhlich aufs Land kutschiert waren. Aber die Stimmung war diesmal eine andere. Mutter weinte und meine Brüder waren ungewohnt schweigsam. Und noch etwas war anders als sonst: Die Straßen waren voller Menschen mit Pferd und Wagen. Wir reihten uns in die Kolonne ein und ab ging’s.
Ich verstand nicht, was da passierte. Aber ich hatte Angst und fing an zu weinen. Meine Mutter konnte sich nicht richtig um mich kümmern, sie hatte genug mit meiner kleinen Schwester zu tun, die damals sterbenskrank war und trotzdem aus dem Krankenhaus geholt worden war. Keiner hatte Zeit für mich. Mir war kalt. Ich hatte Hunger. Ich war nicht mal drei Jahre alt und wollte nach Hause zurück, in mein warmes Bett, zu meinen Kuscheltieren. Als meine Mutter meine Not bemerkte, versuchte sie mich zu trösten. »Pscht, meine Kleine, alles wird gut«, flüsterte sie. Aber ich spürte, dass gar nichts gut werden würde, auch nicht am nächsten Tag oder am übernächsten. Den Pferdewagen gaben wir später irgendwo ab und fuhren mit der Bahn weiter. Die Züge waren überfüllt, kalt und ungemütlich. Die Reise war beschwerlich und nicht ungefährlich. Meine Mutter schnappte sich bei jedem Halt einen großen Kochtopf und rannte zu den an der Strecke gelegenen Bauernhäusern, um etwas Essbares für ihre vier Kinder und Großmama zu erbetteln. Diese Ausflüge waren für uns jedesmal eine Tortur, wir wussten nie, ob die Mama rechtzeitig zurück sein würde. Einmal fuhr der Zug tatsächlich ohne sie los, wir schrien aus Leibeskräften, aber ob unsere lautstarke Verzweiflung oder irgendwelche anderen Gründe die Waggons wieder zum Halten brachten, weiß ich bis heute nicht.
Ein paar Mal mussten alle sehr schnell aussteigen und unter den nächststehenden Bäumen Schutz suchen. Der Himmel war dann plötzlich voller Flugzeuge, die nicht nur den Zug beschossen, sondern auch die Menschen. Nach jedem dieser Angriffe wuchs die Angst. Wir wussten: Einige Mitreisende lagen tot an der Strecke. Manchmal blieb der Zug stundenlang stehen, ganze Ewigkeiten, und keiner wusste, wann und ob es weitergehen würde.
Inzwischen hatten wir ein paar Tausend Kilometer zurückgelegt, von Ostpreußen bis nach Süddeutschland und dann wieder ein Stück Richtung Norden. In Verden an der Aller war die lange Reise vorerst zu Ende. Die örtlichen Familien hatten sich am Bahnhof versammelt, um uns in Empfang zu nehmen. Wir waren Flüchtlinge, das hatte ich endlich begriffen, und die Menschen, die hier wohnten, mussten uns aufnehmen, ob sie wollten oder nicht. Viele wollten nicht und ließen uns das deutlich spüren. Sie waren verärgert, weil sie mit den besitzlosen Fremden, die der Krieg hierher verschlagen hatte, teilen sollten. Wir allerdings hatten Glück: Der Bauer, der uns mitnahm, war ein guter Mensch; er und seine Frau verwöhnten uns Kinder nach Kräften. Zu Ostern durften wir Eier suchen und ein paar Wochen lang gab es für alle reichlich zu essen. Mutter und Großmutter halfen den Gastgebern bei der täglichen Arbeit. Es war ein Tauschen und Teilen, Geben und Nehmen in freundlicher Atmosphäre, und fast hätte ich darüber das Leid der vergangenen Monate vergessen.
Aber der Krieg war noch nicht vorbei und Mama machte sich Sorgen um die Verwandtschaft. Sie hatte erfahren, dass der Rest der Familie in Schleswig- Holstein gelandet war und wollte nun unbedingt auch dorthin. Vergeblich versuchten die netten Bauern, uns zum Bleiben zu überreden. Die Reise ging weiter. Die Verwandten fanden wir dann auch, aber mit dem Geben und Nehmen machten wir diesmal andere Erfahrungen. Nur widerwillig wurden wir von einer Bauernfamilie aufgenommen, mehr als eine kleine Kammer war nicht für uns übrig. Wir waren ihnen lästig und fühlten uns überflüssig und armselig. Wir hungerten, wieder einmal. Der Krieg ging zu Ende, die alte Heimat war endgültig verloren, ein Zurück gab es nicht. Wie viele andere Leidensgefährten mussten wir uns in der neuen Situation einrichten, irgendwie. Um unseren Hunger zu stillen, sammelten wir auf den Feldern übriggebliebene Ähren und später Kartoffeln. Oft zog die ganze Familie mit Körben und Eimern in den Wald, um Beeren zu suchen.
Die Bauern, bei denen wir wohnten, teilten nicht mit uns. Die köstlichen Düfte, die das Haus durchzogen und bis in unsere Kammer drangen, machten uns zwar den Mund wässerig, aber leider nicht satt. Schließlich nahm meine Mutter eine Stelle als Feldarbeiterin auf einem Gut an, für ein bisschen Butter und Milch. Nebenbei gab sie den Bauerntöchtern der Umgebung Klavierunterricht. Entlohnt wurde sie in kostbaren Naturalien: Kartoffeln, Brot, Eier und Mehl. Irgendwann kehrte mein Vater aus dem Krieg zurück, kam zu uns nach Norddeutschland und fing sofort mit den Planungen für eine eigene Firma an. Ganz langsam entstand wieder so etwas wie ein »normaler« Alltag. Aber die Erfahrungen der vergangenen Jahre waren nicht spurlos an mir vorübergegangen. Ich war ein stilles, nachdenkliches Mädchen mit viel Phantasie.
Als ich in die Schule kam, war ich wild entschlossen, ganz schnell Lesen zu lernen. Als ich es konnte, öffnete sich mir ein völlig neue Welt. Mein erstes eigenes Buch war ein Märchenbuch mit dicken, holzigen Seiten. Mit diesem Schatz hockte ich oft in meiner Blätterhöhle, die ich mir in einer Hecke gebaut hatte. Ein Platz für mich und für die Prinzessinnen und Prinzen aus dem Märchenbuch, mit denen ich hier Stunden und Tage verbrachte, ganz und gar versunken in eine Welt, die mir gerechter und besser erschien als die wirkliche. Hier in meiner Höhle holte ich mir Kraft und entwickelte erste eigene Vorstellungen, wie das Leben sein könnte – sein sollte, wenn es nach mir ginge. Ich war sehr davon beeindruckt, dass in fast jeder dieser Geschichten das Böse besiegt wird und die Liebe triumphiert. Ja, so eine Welt wollte ich auch.
Stattdessen hatte ich erfahren müssen, dass Menschen auf andere Menschen schießen, dass die einen den anderen alles wegnehmen und dass die, die genug haben, denen, die hungern, nichts abgeben. Warum musste ich meine Spielsachen zurücklassen und monatelang in kalten Zügen hungernd und frierend durch Gegenden fahren, in denen Tote am Wegesrand lagen? Warum wurde ich jetzt, nur weil ich ein Flüchtlingskind war, als Lumpenpack beschimpft und ausgelacht, weil ich keine richtigen Schuhe besaß, sondern nur welche aus Holz? Wer sollte das verstehen? Und vor allem: Was hatte ich in einer solchen Welt verloren? Ich glaube noch heute, dass Märchen symbolischen Charakter haben. Und ich weiß, dass jeder einzelne Mensch dazu beitragen kann, diese Erde schöner und lebenswerter zu gestalten. Geahnt haben muss ich das wohl schon damals, in meiner einsamen Märchen-Blätterhöhle. Jedenfalls sehe ich es noch genau vor mir, wie das kleine traurige Flüchtlingsmädchen sich selbst ein großes Versprechen gab: »Ich werde alles dafür tun, an einer schönen Welt mitzuwirken. In dieser Welt soll es keine Kriege mehr geben. Und jeder Mensch soll in Würde leben.«
Das Internat – ein Schritt in die Freiheit
Flucht und Nachkriegszeit forderten ihren Tribut. Aus der fröhlichen Zweijährigen von einst war eine echte Heulsuse geworden. Bei jeder Kleinigkeit brach ich in Tränen aus, sehr zum Missvergnügen meiner lieben Nächsten. Außerdem war ich ständig krank, zweimal ging es sogar um Leben und Tod. Eine eifrige Schülerin war ich trotzdem. Schon auf der Grundschule habe ich alles, was die Lehrer sagten, begierig aufgenommen.
Mein Ziel war von Anfang an klar: Ich wollte die Welt verstehen. Und dafür strengte ich mich an, so sehr ich konnte. Auf jeden Fall wollte ich Abitur machen, um später einmal selbst Lehrerin werden zu können.
Die ersten fünf Jahre musste ich ein Knabengymnasium besuchen, weil es keine andere Schule in der Nähe gab. Täglich radelte ich morgens acht Kilometer hin und nachmittags acht Kilometer zurück, bei Wind und Wetter, im Sommer und im Winter. In meiner Klasse waren fünf Mädchen und 20 Jungen. Es waren schwierige Zeiten, in jeder Hinsicht, und nachdem ich einmal sitzen geblieben war, beschlossen meine Eltern, mich nach Rendsburg in eine Art Internat zu schicken, in ein so genanntes Mädchenheim, in dem die Schülerinnen während der Woche blieben und nur am Wochenende nach Hause fuhren.
Es war die richtige Lösung für mich. Die schüchterne Heulsuse blühte endlich auf. Im Umgang mit den anderen Mädchen stellte ich rasch fest, dass ich von den Jungen aus meiner früheren Schule und vor allem von meinen Brüdern eine ganze Menge gelernt hatte. Von wegen Zimperliese! Unternehmungslustig wusste ich die Dynamik der reinen Mädchengruppe zu nutzen und probierte komplett neue Verhaltensweisen aus. Plötzlich gehörte ich, die die neunte Klasse wiederholen musste, zu den besten Schülerinnen. Das zaghafte Sensibelchen verwandelte sich wieder in ein fröhliches Geschöpf, das überall mitreden wollte und konnte.
Mehr denn je wollte ich Lehrerin werden. Mit meinen Nachhilfeschülerinnen, die ich zwecks Aufbesserung des Taschengeldes angenommen hatte, konnte ich schon mal üben. Und sehr bald hatte ich gelernt, mein Wissen auf spielerische Art weiterzugeben.
Das Leben im Heim förderte den Gemeinschaftssinn ungemein. Wir unternahmen viele Dinge zusammen und hatten viel Spaß dabei. Das galt vor allem für unsere Mädchenband, die sich »Nervensägen« nannte. Ich war die »Schlagzeugerin«, das heißt, ich hämmerte begeistert auf einen ganz normalen Kochtopf ein, um Rhythmus ins Spiel zu bringen. Einmal wurden wir ausgepfiffen, aber das störte die Künstlerinnen nicht weiter. An manchen Abenden gab’s für die rund 30 Heimmädchen Lesungen, an anderen wurde gebastelt, gesungen, getanzt oder gespielt. Oder wir feierten richtige Feste – insgesamt war es eine sehr schöne Zeit. Ich fühlte mich wohl und vor allem: Ich war so gut wie nie mehr krank.
Obwohl meine Eltern nicht besonders streng waren, ging es mir ohne sie und meine Geschwister einfach besser. Im Heim fühlte ich mich freier, glücklicher, ohne familiäre Zwänge. Hier erwartete keiner ein bestimmtes Wohlverhalten, um den Nachbarn oder sonst wem zu gefallen. Hier durfte ich einfach Mensch sein, hier durfte ich alles allein entscheiden, und das gefiel mir gut. Zwar gab es Vorschriften, aber die wurden sehr großzügig ausgelegt. Beinahe fühlte ich mich richtig erwachsen, denn beim Erwachsensein sollte es ja wohl genau darum gehen: Um Eigenverantwortung und Selbstbestimmung.
Kann es sein, dass ein Mensch sich besser entwickelt, wenn er weniger kontrolliert wird? Oder ist die berühmte Nestwärme doch wichtiger als die Freiheit? Diese Frage beschäftigt mich seit damals, und ohne wirklich zu einer letztgültigen Antwort gekommen zu sein, habe ich mir als junges Mädchen im Rendsburger Heim fest vorgenommen, dass meine Schüler und möglichen eigenen Kinder einmal in den Genuss der Freiheit kommen sollten, die für mich eine reine Freude war.
Auch über Krankheiten dachte ich viel nach. Warum war ich früher, als unglückliche Zimperliese, so oft krank, und jetzt so selten? Macht eine gesunde Seele den Körper gesund? Wenn dem so wäre, grübelte ich, dann wären Medikamente keine Lösung. Dann musste einfach dafür gesorgt werden, dass jeder Mensch sich wohl fühlt, dass es ihm seelisch gut geht. Fragen über Fragen taten sich auf, und ich stellte mich ihnen mit Vergnügen. Ich bestand das Abitur und freute mich sehr aufs Studium, von dem ich mir viele Antworten erhoffte.
Studium – eine neue Welt
An der Pädagogischen Hochschule in Kiel taten sich neue Welten auf. Endlich erhielten meine ambitionierten Grübeleien eine solide theoretische Grundlage. Psychologie fand ich besonders spannend, schließlich ging’s hier um Menschentypen und dazugehörige Verhaltensweisen, also um das, was mich seit der Blätterhöhle so brennend interessierte. Ich war Studentin mit Leib und Seele. Mit vor Aufregung hochrotem Kopf verfolgte ich die Vorlesungen und begann – endlich, endlich – das eine oder andere zu begreifen. Warum zum Beispiel verschiedene Menschen in bestimmten Situationen ganz unterschiedlich handeln. Es war eine Offenbarung für mich, von den vier Grundtypen zu hören, dem Sanguiniker, dem Choleriker, dem Phlegmatiker und dem Melancholiker. Das berühmte und einleuchtende Beispiel von der Hürde, jedem Psychologie-Erstsemester wohlvertraut, amüsiert mich noch heute. Hopp, sagt der Sanguiniker lachend und springt über das Hindernis. So ein Ärger, schreit der Choleriker und tritt wütend dagegen. Kann man nichts machen, sagt der Phlegmatiker und kehrt wieder um. Warum muss ausgerechnet mir das passieren, jammert der Melancholiker und geht auch zurück. Ich machte mir einen Spaß daraus, meine Freunde und Bekannten typmäßig zu bestimmen. Ließen sie sich leicht einordnen oder gehörten sie zu den zahlreich existierenden Mischtypen? Und vor allem: Was ist eigentlich mit mir? Und weiter gefragt: Sind diese typbedingten Eigenschaften angeboren oder werden sie im Lauf der Jahre erworben? Haben wir also eine Chance, unseren Typ zu verändern, oder sind wir unseren Fehlern und Schwächen hoffnungslos ausgeliefert? Ich fand das alles unglaublich spannend und gratulierte mir immer wieder dazu, dass ich mich für dieses Studium entschieden hatte.
Auch die Pädagogik gefiel mir. Hier erfuhr ich viel über Menschen, die ihr Leben dazu genutzt hatten, das Leben anderer glücklicher zu machen. Ich war fasziniert von Makarenko, der gewalttätige Kinder und Jugendliche von der Straße holte und mit ihnen gemeinsam ein Heim gründete, in dem die Kinder bei allem Mitspracherecht hatten, respektiert wurden und sich dadurch weiterentwickeln konnten. Ja, dachte ich. Das ist es. Das will ich auch. Ich möchte etwas schaffen, bei dem die Menschen sich so angenommen fühlen, dass sie gar nicht erst auf die Idee kommen, irgendwo einen Krieg anzuzetteln.
In den Seminaren wurden auch andere Pädagogen vorgestellt, die auf Vertrauen statt Strafe setzten. Eine damals noch revolutionäre Vorstellung. Fast unheimlich. In den Schulen war die Prügelstrafe noch längst nicht abgeschafft, und die gelegentliche oder regelmäßige Ohrfeige gehörte fest zum Erziehungsprogramm des Durchschnitts-Deutschen. Strafe muss sein! Kaum einer hatte je davon gehört, dass man Kinder nicht schlagen sollte. Der alte Spruch von Zuckerbrot und Peitsche galt nach wie vor. Andererseits war ein Aufbruch zu spüren, eine erste, noch sehr zaghafte Auflehnung gegen den »Muff von Tausend Jahren«. Nach den Vorlesungen gab es lange, lebhafte Diskussionen. Die Studenten waren leidenschaftlich bei der Sache.
In den Semesterferien arbeitete ich in der Fabrik, um Geld fürs Studium zu verdienen. Hier lernte ich Menschen kennen, die jahrein, jahraus dieselbe stumpfsinnige Arbeit taten, die ich kaum sechs Wochen lang aushielt. Sie taten mir schrecklich Leid. Das ist doch kein Leben, dachte ich. Aber ich konnte nichts für sie tun. Oder doch? Irgendwann?
Zum Lehramtsstudium gehörten diverse Praktika an Schulen. Das war auch gut so, denn alsbald mussten wir verkopften Kandidaten feststellen, wie grausam die Realität sein kann, wie frech und laut die Kinder sein konnten, die sich nicht um unsere wunderbaren pädagogischen Ansätze scherten. Kilometerweit klafften Theorie und Praxis auseinander, und Ratlosigkeit machte sich breit. Wie kann das sein, fragte ich mich. Pestalozzi und die anderen haben doch so viel erreicht. Sie haben das Stückchen Welt, das sie in Angriff genommen haben, verändert, haben ihre großartigen Ideen umgesetzt. Vielleicht, dachte ich, lag es einfach daran, dass sie ihre Ideen gelebt haben. Ja, das musste die Lösung sein.
Theorie und Praxis
Nach dem ersten Staatsexamen wurden die Lehramtskandidaten auf ganz Schleswig-Holstein verteilt. Bilsen sollte in den nächsten Jahren meine Heimat sein. Das Dorf zählte nur einige Hundert Seelen und die Schule, an der ich künftig arbeiten würde, hatte nur zwei Klassen: Die Erst- bis Viertklässler besuchten die Grundstufe, die Fünft- bis Neuntklässler die Hauptstufe. Zu dem hübschen kleinen Neubau gehörte ein Flügel mit Lehrerwohnungen. Ich wurde als Klassenlehrerin für die Kleinen eingeteilt, musste aber auch ein paar Stunden bei den Großen unterrichten. Der Arbeitsplatz gefiel mir. Mein Kollege, der bereits kurz vor der Pensionierung stand, war emsiger Hobbygärtner, und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Das ländliche Idyll inspirierte mich, aber etwas fehlte mir doch: Als begeisterte Sportlerin mit Schwerpunktfach Leibeserziehung wollte ich nicht akzeptieren, dass es weder eine Sprunggrube noch irgendein Sportgerät gab.
Um diesem Manko abzuhelfen, musste ich zunächst den Bürgermeister überzeugen, der als Schirmherr der Schule bei jeder Veränderung mitreden durfte. Das war kein unüberwindbares Problem, da ich den Herrn ohnedies täglich besuchte. Das Dorfoberhaupt arbeitete nämlich hauptberuflich als Landwirt, und ich kaufte meine Milch bei ihm. Oft begleitete ich ihn sogar in den Kuhstall, pausenlos auf ihn einredend. Wie wichtig Schulsport sei. Wie sehr es der Gesundheit und dem Gemeinschaftsgefühl der Kinder nutzen würde, wenn sie regelmäßig trainieren könnten. Es gebe doch bereits einen Spielnachmittag im Wald, versuchte der Bürgermeister die übereifrige Jung-Lehrerin abzuwimmeln. Aber nur bei schönem Wetter, konterte ich. Und außerdem sei mir das zu wenig. Ich wolle richtige Geräte, die man zu bestimmten Zeiten in einem Klassenraum aufbauen könne. Die müssten nicht mal gekauft werden, säuselte ich, längst hätte ich mit anderen Schulen und Sportvereinen der Umgebung Kontakt aufgenommen und Leihgaben ausgehandelt. Schließlich kapitulierte der Schirmherr. Statt des gewohnten »Wat schall dat« und »Bruuk wie doch nich« knurrte er eines glücklichen Tages »Mienswegen«. Sofort leitete ich alles Nötige in die Wege. Binnen Tagen gab es einen Barren, einen Kasten, drei Bodenmatten, Bälle, Reifen, Keulen und Ähnliches. Die Kinder freuten sich mindestens so sehr wie ich über das neue Schulfach.
Aber das war nur der Anfang. Längst hatte ich in Gedanken die große Wiese vor dem Schulgebäude zum Sportplatz umfunktioniert. Und ich war mit meiner Idee nicht mehr allein: Die Mütter und Väter meiner Schüler trabten geschlossen an, mit Schaufel, Spaten und Hacken. Gemeinsam schufteten wir für die gute Sache, maßen, hackten, gruben und vertilgten zwischendurch die köstlichen Speisen, die einige Dorfbewohner mitgebracht hatten. Es war eine Gemeinschaftsaktion, wie ich sie mir nicht besser vorstellen konnte. Ich war denn auch rundum zufrieden, als wir am Abend das stolze Ergebnis unserer Anstrengungen begutachten konnten: Die ehemalige Wiese bestand jetzt aus einer Sprunggrube, einer Lauf- und Wurfbahn und einem schönen Spielfeld. Und natürlich wurden die Sportstunden jetzt endgültig zum Lieblingsfach der Grund- und Hauptschüler. Bei all dem dachte ich oft an meine Vorbilder, O’Neill, Pestalozzi, Makarenko, Menschen, die so viel erreicht hatten. Und auch ich, merkte ich nun, konnte Dinge umsetzen, die mir wichtig waren. Ein Weilchen sonnte ich mich im Hochgefühl bestandener Taten. Aber nicht lange.
Es gab Probleme, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Meine Schüler konnten sich nicht auf Freundlichkeit und Nachsicht einstellen. Vor allem die älteren Jungen vermissten die »starke Hand«. Sie waren daran gewöhnt, mit Ohrfeigen und Stockschlägen zu Ordnung und Gehorsam angehalten zu werden. Und ihr Enthusiasmus über meine modernen Erziehungsmethoden hielt nur bis zur ersten Meinungsverschiedenheit. Ich musste bei den Kindern etwas durchsetzen, was sie nicht wollten. Gewalt war für mich kein Argument, mit Diskussionen konnten die Schüler nichts anfangen, und so kam es zum Eklat. Die größeren Jungen glaubten von jetzt an, einen Freibrief bei der dämlichen Lehrerin zu haben. Unsere Beziehung war unrettbar zerstört, und bald fühlte ich mich von der Situation, mit der ich nicht klar kam, überfordert. Mein fast pensionierter Kollege bekam Oberwasser, sah sich in all seinen Vorurteilen bestätigt und unterstützte mich in keiner Weise. Ich war unglücklich und wurde, wie in meiner Kindheit, krank. Zweimal musste ich ins Krankenhaus, ließ Mandeln und Nasenscheidewand entfernen, hatte aber trotzdem ständig Halsschmerzen und litt an chronischer Heiserkeit.
Ich kam ins Grübeln. Was hatte ich falsch gemacht? Ich wollte Begeisterung für eine interessante Sache wecken, bei Kindern und Eltern. Statt dessen gab es Streit, Zwist, Ärger – ein für mich unhaltbarer Zustand. Als die Schule nach zwei Jahren aufgelöst wurde, wie so viele dieser Zwergenschulen in jenen Jahren, nutzte ich die Gelegenheit, um mich für ein Jahr vom Schuldienst beurlauben zu lassen.
Karneval in Rio
Ich war enttäuscht von mir. Gleich bei meiner ersten ernsthaften Tätigkeit hatte ich versagt, hatte das Versprechen, das ich mir damals in der Blätterhöhle gegeben hatte, nicht eingehalten. Andererseits, versuchte ich mir Mut zu machen, hatte es auch schöne Zeiten in dem Dorf gegeben. Sicher würden sich Eltern und Kinder an mein Engagement erinnern. Ein Anfang, immerhin. Beim nächsten Mal würde ich ein Stück weiterkommen, ganz bestimmt. Trübsal blasen bringt nichts, beschloss ich energisch. Nach vorn schauen und neue Ideen entwickeln ist viel besser! Ich würde eine Reise machen. Das Reisen hat mir immer geholfen, unklare Lebenssituationen zu bewältigen. Unterwegs gelingt es mir, nur für den Augenblick zu leben, Verpflichtungen auf ein Minimum zu reduzieren und Sorgen zu vergessen.
Von meiner Mutter wusste ich, dass wir Verwandte in Brasilien hatten, die ein Geschäft in Blumenau führen, einer von Deutschen gegründeten Siedlung in Brasilien. Dort wollte ich hin, vielleicht im Laden helfen oder mich sonstwie nützlich machen. Konkrete Vorstellungen hatte ich nicht, ich wollte bloß weg, das Weitere würde sich ergeben. Nur eines wusste ich sicher: Beim Karneval in Rio würde ich meine Lebensfreude wiederfinden. Die farbigen Bilder von dem Spektakel hatten mich immer fasziniert. Jetzt wollte ich das alles hautnah erleben. Meine Freunde und Bekannten sparten nicht mit gut gemeinten Ratschlägen. Rio sei kein Pflaster für junge Frauen. Die Gewalt, der Schmutz, ich würde schon sehen, was ich davon hätte. Ein paar Freundinnen, die sich niemals auf eine solche Fahrt ins Ungewisse begeben würden, bewunderten meinen Mut. Ich bewunderte ihn selbst ein wenig. Ich wusste um das Risiko, aber auch um meine Bereitschaft dazu, der ich bis heute viele Abenteuer verdanke und die vielleicht mit der Flucht aus Ostpreußen zu tun hat. Wer einmal alles zurücklassen musste, dem fällt es beim zweiten oder dritten Mal nicht mehr so schwer. Was konnte mir schon passieren?
Ich verkaufte mein Auto und meine Möbel und stellte den Rest meiner Habe bei meiner Mutter unter. Das Ticket für die Schiffspassage hatte ich längst besorgt. Nur das Nötigste im Gepäck, ging ich schließlich in Genua an Bord des großen weißen Dampfers mit Namen »Enrico«. Sofort fielen alle Sorgen der vergangenen beiden Jahre von mir ab. Ich freute mich wieder auf die Zukunft.
Als ich an der Reling stand und das Treiben der Menschen um mich herum beobachtete, sagte mir eine innere Stimme, dass ich auf dieser Reise nicht allein sein würde. Tatsächlich kam ich bald mit einer der Frauen, die meine Kabine teilten, ins Gespräch. Sie hatte Kassettenrecorder, Filmausrüstung und Tonbandgerät dabei und wollte damit zu den Indios. Wir wurden uns schnell einig: Sie würde mit zum Karneval kommen, und später würde ich sie auf ihrer Expedition begleiten. Von da an waren wir unzertrennlich und ständig mit einer kleinen Landkarte zugange, auf der wir unsere Reiserouten markierten, nur um sie am nächsten Tag wieder umzuwerfen. Es machte Spaß, etwas zu planen, nach dem wir uns nicht richten mussten. Wir hatten das Gefühl, alles sei möglich und wir allein seien die Herrinnen unserer Zeit und unseres Daseins. Als wir dann auch noch den Äquator gequert und den Winter hinter uns gelassen hatten, wusste ich endgültig nicht mehr, wohin mit meiner Lebenslust.
Beim Karneval in Rio feierten wir die Nächte durch, tanzten mit den Samba-Gruppen, lachten mit den Einheimischen und hatten vermutlich großes Glück, dass wir, zwei junge Europäerinnen auf großer Fahrt, ungeschoren davon kamen. Danach reisten wir etwa drei Monate lang durch Brasilien. Meine Gefühle waren zwiespältig, ich war überwältigt von dem lebhaften bunten Treiben und konnte gleichzeitig die unfassbare Armut der Menschen nicht ertragen. Familien hausten auf der Straße, vegetierten im Schmutz dahin, litten unter der Hitze. Überall sah man Kinder mit verstümmelten Gliedmaßen, bedeckt von Geschwüren und Fliegen. Ich ging durch die Favelas, musste weinen und war fassungslos über dieses Elend.
Mein Versprechen fiel mir wieder ein. Wir mussten etwas tun, sagte ich mir, wir durften nicht einfach zusehen, wie Menschen verhungerten oder starben, weil es keine Medikamente für sie gab, während wir Europäer im Überfluss lebten und unsere Ressourcen hemmungslos verschwendeten. Aber allein konnte ich hier nichts tun, auch wenn es mir jedesmal das Herz brach, wenn die Kinder mich bettelnd verfolgten, weil sie in der jungen blonden Frau eine reiche Weiße sahen. Sie wollten Geld von mir, doch ich hatte kein Geld.
In Blumenau machten wir einen Abstecher zu meiner Verwandtschaft, aber wir blieben nur wenige Tage. Nach dem, was wir gerade in den Dörfern gesehen hatten, war die Ignoranz der Zugewanderten kaum auszuhalten. Faul und träge seien die Einheimischen, höhnten sie, und selbst schuld an ihrem Elend: »Wir haben es schließlich auch zu etwas gebracht!« Ich war heilfroh, von diesen tüchtigen Germanen wegzukommen.
Als uns das Geld ausging, beschlossen wir nach Chile zu gehen, wo meine Freundin eine Familie kannte. Ich fing in einer deutschen Schule als Lehrerin an, ohne Vertrag, da ich nicht wusste, wie lange ich bleiben konnte – oder wollte. Bald war ich heilfroh, mich auf keinen Vertrag eingelassen zu haben, denn meine Situation entpuppte sich als äußerst unerfreulich, vor allem die Ungerechtigkeit machte mir zu schaffen. Im Unterschied zu den Kollegen, die von der deutschen Regierung eingestellt worden waren, wurde ich wie eine chilenische Lehrkraft bezahlt, das heißt, ich bekam nur ein Viertel des »deutschen« Gehalts, ein wahrer Hungerlohn. Nach einigen Monaten beendete ich diese unerquickliche Tätigkeit.
Santiago de Chile – Tor in eine andere Welt
Meine Freundin hatte einen guten Job in einer deutschen Firma gefunden. Gemeinsam bezogen wir ein Zimmer in Santiago de Chile, das uns eine Krankenschwester vermietete, die mit ihrer 17-jährigen Tochter seit dem Tod ihres Mannes allein über die Runden kommen musste. Jetzt waren wir keine staunenden Touristinnen mehr wie in Brasilien, nun hatten wir uns dem ungewohnten chilenischen Alltag zu stellen. Wie die Einheimischen kämpften wir täglich um unsere Stehplätze im Bus, falls der Bus überhaupt anhielt. Oft fuhr er einfach vorbei, weil jeder Quadratzentimeter bereits besetzt war. Manchmal hielt er, obwohl eigentlich niemand mehr hineinpasste. Dann wurde nachgeschoben, bis wirklich gar nichts mehr ging. Das Aussteigen war jedesmal eine echte Herausforderung. Überhaupt, die Menschen! Das ständige Gewimmel auf den Straßen! Ein ganz neues Bild für mich. Gegen Santiago de Chile war eine deutsche Großstadt wie Hamburg geräumig und leer. Ein Großteil der chilenischen Bevölkerung lebte damals in der Hauptstadt, der Rest verteilte sich auf Dörfer und kleinere Ortschaften.
Wir kannten inzwischen etliche Einheimische. Zu unseren Vermieterinnen hatten wir guten Kontakt, und irgendwann erzählten die beiden, dass ihnen der tote Ehemann und Vater immer mal wieder erscheine. Ich war sprachlos, so einen Unsinn hatte ich noch nie gehört. Für mich, die aufgeklärte Deutsche, war klar: Ein gestorbener Mensch ist tot, basta. So einen Unsinn hatten wiederum die freundlichen Vermieterinnen noch nie gehört. Jeder Tote lebe weiter, nur in anderer Form, erklärten sie uns Ungläubigen geduldig. Auch unsere anderen chilenischen Bekannten wussten von Erscheinungen zu berichten, so was war hier offenbar völlig normal. Wer keine Lust hatte, seine Kontakte über den Tod hinaus zu pflegen, holte sich bei Kräuterfrauen Tipps, wie man die ungebetenen Gäste aus dem Jenseits loswerden konnte. Unsere neuen Freunde sprachen viel von Energien, davon, wie böse Geister das Leben beeinflussen, es sei denn, man wisse sich zu schützen. Ich wollte das alles nicht glauben, belächelte heimlich den seltsamen Aberglauben und hielt mich für realistisch.
Das änderte sich, als ich meinen Nachbarn kennen lernte. Ein Kunstmaler, so alt wie ich, mit indianischem Blut in den Adern. Ein schöner und interessanter Mann, sehr philosophisch und nachdenklich. Juan wollte ein Porträt von mir malen. Ich saß ihm mehrere Male Modell und erfuhr bei diesen Gelegenheiten viel über die Chilenen im Allgemeinen und diesen einen im Besonderen. Obwohl ich noch nicht gut Spanisch sprach, wusste Juan immer, was ich sagen woll- te. Wenn seine Angehörigen der radebrechenden Fremden höflich, aber verständnislos lauschten, konnte er immer »übersetzen«, was ich meinte. Ich war beeindruckt. Und als er mir sagte, er habe immer gewusst, dass ich eines Tages zu ihm kommen würde, wurde ich darüber hinaus nachdenklich. Er konnte mir sogar das Datum meines Reiseantritts nennen, und er zeigte mir ein Bild, das er gemalt hatte, während ich noch unterwegs war. Ein Bild, das eine Situation darstellte, die ich tatsächlich erlebt hatte.
Mir war das alles unheimlich. Bis mir einfiel, dass ich meinerseits auch eine Ahnung gehabt hatte. Damals in Genua, auf dem Schiff, als ich ganz deutlich eine Stimme hörte, die mir zusicherte: Du wirst nicht allein bleiben. Nun war ich auch nicht allein geblieben, hatte schnell eine Freundin gefunden, aber jetzt fragte ich mich doch, ob die Stimme nicht in Wirklichkeit diesen attraktiven jungen Mann gemeint hatte, der genauso hieß wie das Schiff.
Jedenfalls brachte er mich gehörig durcheinander. Unsere gegenseitige Anziehung war sehr intensiv, und Juan behauptete, mich aus einem anderen Leben zu kennen. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Ein europäischüberlegenes »Der spinnt« funktionierte nicht. Dafür gab es zu viele Situationen, die ihm Recht zu geben schienen. Manchmal stand er mitten in der Stadt plötzlich neben mir. Wenn ich dann sagte: »Was für ein Zufall«, lächelte er und erwiderte, dass es keine Zufälle gäbe. Er hätte auf einmal deutlich gespürt, dass er hierher fahren müsse: »Alles passt zusammen.« Bald fing ich selbst an, Beobachtungen zu machen, bei denen es nicht mit rechten Dingen zugehen konnte. Ich wusste nicht so genau, ob mir das gefiel. Auf der einen Seite war ich fasziniert, auf der anderen Seite machte es mir Angst. Als Juan mich fragte, ob ich ihn heiraten wolle, sagte ich ja. Obwohl alles in mir »Tu es nicht!« schrie. Unsere Ehe wurde ein Fiasko. Aber heute weiß ich, dass sie für uns beide wichtig und richtig war.
Erinnerung an ein Versprechen
Weil mein Mann in Chile nicht genug Bilder verkaufen konnte, um eine Familie zu ernähren, und ich mit meinem Hungerlohn unzufrieden war, beschlossen wir, nach Deutschland überzusiedeln. Mein Urlaubsjahr ging gerade zu Ende und ich bekam eine Stelle in Schwarzenbek bei Hamburg zugewiesen. Die nächsten fünf Jahre nahmen mich ähnlich mit wie die Flucht und die Nachkriegsjahre. Ich war todunglücklich, ständig überfordert und verlor jeden Halt. Im Abstand von nicht mal einem Jahr wurden unsere beiden Kinder geboren. Sie sahen aus wie kleine Indios und machten mir viel Freude, forderten aber auch eine Menge Energie, die ich längst nicht mehr hatte. Ich unterrichtete die volle Stundenzahl und machte nebenbei das zweite Staatsexamen. Juan lernte kein Deutsch, weshalb ich als seine einzige Ansprechpartnerin immer zur Verfügung zu stehen hatte. Als er den Philosophen Ortega y Gasset für sich entdeckte, waren meine »freien« Abende dahin. Kaum schliefen die Kinder, wollte mein Mann über Ortega plaudern. Ausreden ließ er nicht gelten. In keiner Situation. Und so wurde ich nach dem Motto »und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt« ein halbes Jahrzehnt lang drangsaliert. Dann ließ ich mich scheiden. Juan musste Deutschland verlassen – ohne Rückkehrmöglichkeit. Ich atmete auf.
Während meiner Ehe hatte ich mich sehr verändert. Die lebensfrohe Unbeschwertheit meiner Internats- und Studienzeit war wie weggeblasen. Und jetzt, nach der Scheidung, war ich alleinerziehende Mutter mit voller beruflicher Belastung. Ich wurde wieder krank. Die altbekannten Halsschmerzen plus Heiserkeit, dazu ein paar neue Allergien. Ich war Dauerpatientin bei verschiedenen Ärzten und fühlte mich ein paar Jahre lang als vom Leben betrogenes Opfer.
Aber so leicht ließen sich meine Lebensgeister nicht ausbremsen. Nach und nach entdeckte ich, dass meine schlimmen Erfahrungen auch ihr Gutes hatten. Während ich mich früher oft oberflächlich und uninteressant fühlte, hatte ich jetzt etwas Wesentliches zu verarbeiten. Das Leid hatte meine Fähigkeit zum Mitgefühl verstärkt. Und je mehr ich mich vom Gedanken, ein Opfer zu sein, verabschiedete, desto größer wurde mein Selbstvertrauen. Ich hatte viel geleistet in den vergangenen Jahren!
Ich zog mit meiner Tochter und meinem Sohn in ein Haus am Waldrand. Hier fühlte ich mich so wohl, dass mir das Versprechen wieder einfiel, das ich mir als kleines Mädchen in der Blätterhöhle gegeben hatte, nämlich mitzuwirken an einer positiven Veränderung der Welt. Ich wollte gleich damit anfangen, und zwar mit dem Nächstliegenden.
Schwarzenbek war damals eine Stadt ohne Ambiente. Das müsste sich doch ändern lassen! Mit einem Treffpunkt für Kreative zum Beispiel. Und warum nicht gleich in meiner Wohnung? In meinem Freundeskreis gab es Maler und Musiker, die mit mir gemeinsam das Kreativ-Zentrum planten. Wir funktionierten die unteren Räume, in denen ich wohnte, zu einer Galerie um. Für die Kinder gab es einen eigenen Bereich in der oberen Etage, wo sie ungestört waren. Nach einer Vernissage nur für geladene Gäste öffnete ich meine Türen zweimal in der Woche für alle. Mir schwebte ein harmonisches Miteinander vor, eine Gemeinschaft, in die sich jeder, so gut er konnte, einbringen und gleichzeitig von den anderen profitieren sollte. Ein künstlerisches Geben und Nehmen würde hier entstehen.
Nach kurzer Zeit entstand eine Gruppe, die sich regelmäßig bei mir traf. Wir lasen einander vor, wir schrieben ein Hörspiel, das wir gemeinsam produzierten. Wir sangen, spielten Theater und hatten viel Spaß. Das Ganze erinnerte mich an meine Internatszeit. Aber eigentlich war mir das alles viel zu wenig. Gut, wir hatten Spaß, aber was hatte das mit der Welt zu tun? Dann entdeckte ich das Kunsthaus und bekam ganz neue Mitspieler.