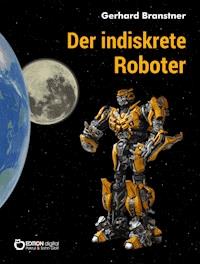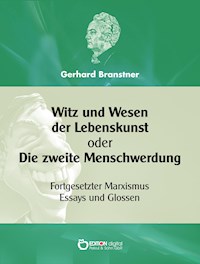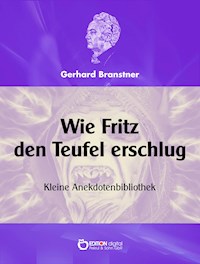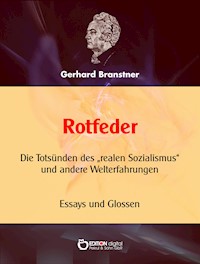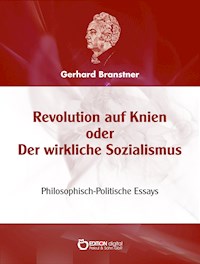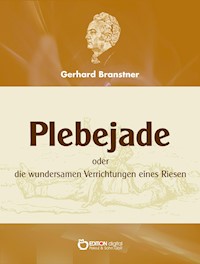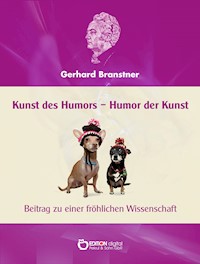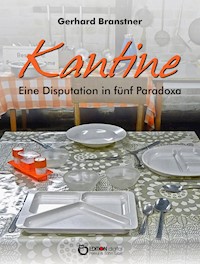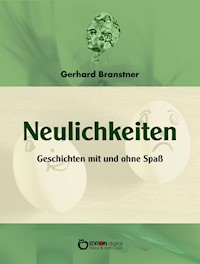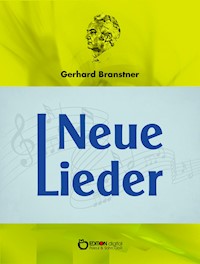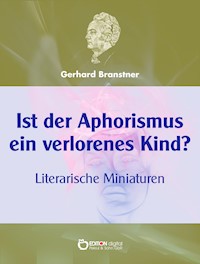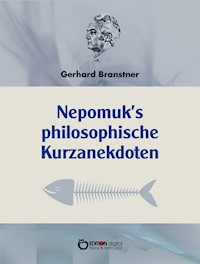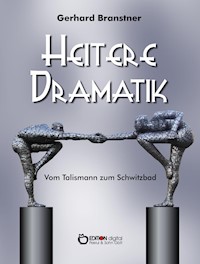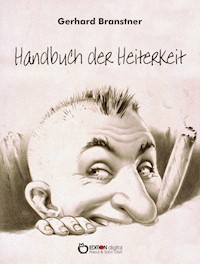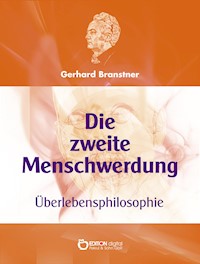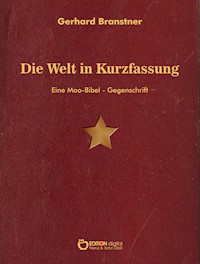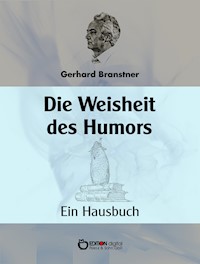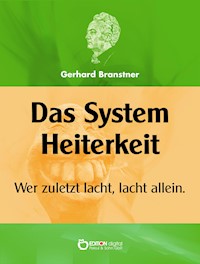
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Sicht des Autors auf das Thema Heiterkeit und den Zustand der Welt kann man vielleicht am allerbesten an der vorletzten seiner „Sentenzen zur Heiterkeit“ erkennen, die am Ende seiner Grundlegung stehen. Dort schreibt er: Welthumor Gefragt, weshalb er nicht an Gott glaube, erwiderte Nepomuk: „Weil mir nicht bewiesen werden konnte, dass Gott jemals gelacht hat. Wie aber könnte ein Mann, der diese Welt gemacht hätte, ernst bleiben.“ Und damit ist schon viel, wenn nicht sogar alles gesagt und außerdem kommt in diesem Zitat eine Lieblingsfigur Branstners zu Wort – sein Nepomuk, der immer wieder gern mit überraschenden An- und Absichten zum Mit-Denken provoziert und der wohl selbst ein heiterer Dialektiker ist. Fangen wir mit dem Anfang dieses Systems der Heiterkeit an, dem Branstner eine kurze Einführung voranstellt, in dem er seine Weltsicht knapp und klar zusammenfasst: Nach der Gleichheit ist mir die Heiterkeit die vornehmste Eigenschaft des Menschen. Freiheit kann nur inmitten dieser beiden wohnen. Die Heiterkeit aber, jedenfalls wenn sie aus sozialer Gleichheit und Freiheit entspringt, ist der Sinn und Genuss unseres Daseins. Und da der Mensch von Natur aus und normalerweise gleich und frei ist, führt er auch dieses Dasein. Alle anderen Berichte entsprechen nicht der Wirklichkeit. Es folgen eine Darlegung zur „Heiterkeit der Naturvölker“, die mit den drei bemerkenswerten Sätzen beginnt „Die ernstesten Zeiten bedürfen der größten Heiterkeit. Das ist eine paradoxe Forderung. Oder vielmehr eine dialektische“, eine Passage über „Die Phase der Verernstung“ (ein welthistorisches Unglück) und über „Das Ende mit Schrecken“, worin es um den wirklichen Sozialismus bis zur Vollendung des Kommunismus einschließlich einer heftigen Kritik an der damaligen PDS geht, sowie ein Kapitel über „Die erwachsene Heiterkeit“ – worin auch der heiteren Helden der Menschheit wie Till Eulenspiegel und der ernsten Helden der Menschheit gedacht wird und die mit der Erkenntnis schließt: Die erwachsene Heiterkeit ist die beste Bedingung und Methode, die soziale Vererbung voll zu verwirklichen, die Aufhebung, Verarbeitung und Verwertung alles Aufhebenswerten aus der bisherigen Geschichte der Menschheit. Schließlich sind wir wieder bei den bereits erwähnten „Sentenzen zur Heiterkeit“, deren erste ganz im Sinne des Branstnerschen Systems lautet: Humor hat, wer gleich lacht. Denn, so erläutert der Autor an anderer Stelle, Humor hat, wer gleich lacht. Später lachen ist keine Kunst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 94
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Gerhard Branstner
Das System der Heiterkeit
Die Religion der Atheisten – Elemente einer Grundlegung
Das Buch erschien 2001 bei KALASCHNIKOW, Das Politmagazin als Der Querschläger Nr. 4 (Philosophischer Salon).
ISBN 978–3–96521–748–5 (E–Book)
Titelbild: Ernst Franta
© 2022 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E–Mail: verlag@edition–digital.de
Internet: http://www.edition–digital.de
Einführung
Nach der Gleichheit ist mir die Heiterkeit die vornehmste Eigenschaft des Menschen. Freiheit kann nur inmitten dieser beiden wohnen. Die Heiterkeit aber, jedenfalls wenn sie aus sozialer Gleichheit und Freiheit entspringt, ist der Sinn und Genuss unseres Daseins. Und da der Mensch von Natur aus und normalerweise gleich und frei ist, führt er auch dieses Dasein. Alle anderen Berichte entsprechen nicht der Wirklichkeit. Die Heiterkeit ist den Naturvölkern, bei allen Irritationen durch Aberglauben und natürliche Widernisse und dergleichen, die unablässige Grundstimmung.
In der Klassengesellschaft geht mit der Gleichheit auch die Freiheit und mit dieser die Heiterkeit als Grundstimmung verloren und wird zur Grundsehnsucht. Um lediglich als verfehltes Bedürfnis und karnevalistische Narrheit fortzuexistieren. Mit welcher Lebenskraft die Heiterkeit ihre Bedingungen sucht, beweist sie in der italienischen Commedia dell’ arte, wie sie infolge der Renaissance ihre eigene Welt errichtete, eine geschlossene Welt der Heiterkeit. Hingegen verdirbt die Verernstung der Klassengesellschaft alle positiven menschlichen Eigenschaften wie Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Geselligkeit, Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft, Frieden und Freundschaft.
Nach dem Gesetz der Dialektik folgt der Negation, der Phase der Verernstung in der Klassengesellschaft, die Negation der Negation, die Aufhebung des Ernstes in Heiterkeit, und zwar nicht mehr als Grundstimmung, sondern in Heiterkeit als Grundhaltung. Einhergehend mit der Aufhebung der Ungleichheit und der Unfreiheit. Jetzt ist die Heiterkeit nicht mehr naive, sondern bewusste, philosophische. Als das ist sie gewolltes und gekonntes Regularium: Lebenswille, Lebenshilfe und Lebensgenuss. Aufhebung des Einzelnen in der Gattung, als Gattungswesen. Die Philosophie der Heiterkeit wird zur „Religion“ der Atheisten. Und je unwahrscheinlicher uns diese Metamorphose der Menschheit erscheint, desto unwürdiger muss uns der gegenwärtige Zustand erscheinen.
Der Menschheit wird eines Tages unsere Gegenwart unglaubhafter sein als uns heute eine vernunfthörige Zukunft.
Die Vorhersicht dieser Entwicklung ist ihre Wissenschaft.
Die folgenden Texte sind im Laufe mehrerer Jahre und aus unterschiedlichen Anlässen entstanden Daher ist eine äußere Harmonie nicht immer gegeben. Die innere Harmonie hingegen ist unverkennbar.
Die Heiterkeit der Naturvölker
Die ernstesten Zeiten bedürfen der größten Heiterkeit. Das ist eine paradoxe Forderung. Oder vielmehr eine dialektische. Fridjof Nansen berichtet von einer Gruppe von Eskimo, die durch einen verfrühten Wetterumschlag den Wechsel zu ihrer nächsten Nahrungsquelle verpasst hatte und nun abgeschnitten war. Und obwohl die Eskimo schon am Verhungern waren, erlebte Nansen sie als die heitersten, lachlustigsten Menschen, denen er je begegnet war. Und die Pygmäen wurden schon von den alten Römern ob ihrer Lustigkeit geschätzt. Lachlustig sind sie auch heute noch, denn sie haben bis heute, wie die von Nansen
Dass die Eskimo zu ihren Zeiten nach unserem Verständnis schlimme Übeltäter nicht bestraften, sondern vermittels Lachwettbewerben nur den gemeinschaftlichen Frieden wieder herstellten, egal ob das Lachen auf Kosten des Täters oder des Opfers ging, da nach ihrem Verständnis kein Mensch von Natur aus schuldig oder lobenswert ist, beschäftigt hingegen keinen Historiker und schon gar nicht Millionen Menschen, weder Franzosen noch Deutsche noch Chinesen, obwohl das doch vielmal bemerkenswerter ist als die Feldzüge Napoleons.
Das ursprüngliche und eigentliche Wesen des Menschen sei Heiterkeit? Das ist zu belegen.
Zunächst die Heiterkeit als ursprüngliches Wesen des Menschen. Beginnen wir mit dem nördlichsten der Naturvölker, den Eskimo. Von ihnen sagt Eva Lips, dass sie „die fröhlichsten und lachlustigsten unter den Völkern Amerikas“ seien. Sie konstatiert „eine Fröhlichkeit des Herzens … die kaum vorstellbar“ ist und bezeichnet die „Lachlust als anerkannte Hauptemotion der arktischen Menschen“.
Von den Indianern Nordamerikas sagt Georg Catlin: „Unter den Irrtümern, in die man … hinsichtlich der Wilden verfällt, ist wohl keiner allgemeiner verbreitet und falscher und zugleich keiner so leicht zu widerlegen als der, dass der Indianer ein mürrisches, verdrießliches, verschlossenes und schweigsames Wesen sei. Und nach seinen Erfahrungen mit den Mandanern, die „von den mannigfachen Leidenschaften und Begierden des zivilisierten Lebens noch unberührt geblieben sind“, berichtet Catlin, dass er „Zeuge der unerschöpflichen Scherze und des unauslöschlichen Gelächters“ sein konnte.
Diese Wesensart zeichnet auch die südamerikanischen Indianer aus, solange sie von der Zivilisation „unberührt geblieben“ sind. So charakterisiert Karl von Steinen die zentralbrasilianischen Bakairi als „heiter“ und Maximilian zu Wied–Neuwied die Botokuden als „lustig“.
Das gleiche gilt für die schwarzafrikanischen Naturvölker. Schon der Römer Galen wusste davon, wenn er die „Leute von Zendsch“ um 200 unserer Zeitrechnung wie folgt beschreibt: „Sie sind ausgelassen fröhlich. Nie sieht man einen Zendsch bekümmert, der Kummer ficht sie nicht an, und die Freude umfasst sie alle.“ Die Heiterkeit der Naturvölker ist den „zivilisierten“ Menschen so ungewohnt, dass in Afrika tätige Naturforscher beispielsweise bei den Pygmäen noch heute „eine für uns Europäer unvorstellbare Heiterkeit“ antreffen. Da kann es einem vom Ernst geschlagenen Wissenschaftler, wie Johann Ludwig Kropf, passieren, diese Heiterkeit noch unerträglicher als eine Unbill der Natur zu empfinden. „Ich war sehr froh, … abreisen zu können, da mir die empfindliche Nachtkälte, … noch mehr aber das lärmende Wesen der Wanika und Wakamba sehr zuwider war. Wenn die Leute nichts zu tun haben und in Sicherheit sind, so schwatzen und lachen sie und verüben alle möglichen Tollheiten, dass ein Europäer bei ihnen fast nicht aushalten kann.“
Die Heiterkeit der Südseeinsulaner ist uns geläufiger. Schon Adelbert von Chamisso berichtet von den Kanaken der Sandwichinseln: Das „Lachen hat hier nichts Feindseliges … jeder lacht über den anderen, König oder Mann, unbeschadet der sonstigen Verhältnisse.“ Und selbst von den heiligsten Kultveranstaltungen sagt er: Gegen „die Lustigkeit, mit der sie vollzogen wurden, könnte die Lustbarkeit eines unserer Maskenbälle für ein Leichenbegängnis angesehen werden.“ Nach einer Fülle gleichartiger Beobachtungen resümiert Chamisso: „Man findet den regsten Sinn und das größte Talent für den Witz unter den Völkern, die der Natur am wenigsten entfremdet sind.“ Und Georg Heinrich von Langsdorff spricht von den „immer frohsinnigen Menschen“ der Marquesas–Inseln. Ebenso Hermann Melville: „Ich hatte reichlich Gelegenheit, die Sitten der Eingeborenen zu beobachten … Eine von mir bewunderte Eigenart war die unablässige Heiterkeit.“
Heiterkeit war, um mit Eva Lips zu sprechen, unter den Naturvölkern die „Grundeinstellung zum Leben“. Sie entsprang der auf sozialer Gleichheit beruhenden Freiheit und war daher keine Laune oder individuelle Charaktereigenschaft, sondern gesellschaftliche Wesensart des Menschen, seine allgemeine und dauernde Stimmung; weshalb sie als Grundstimmung definiert werden kann. Daraus erklärt sich, dass auch die Kunst der Naturvölker heiter „gestimmt“ ist, Heiterkeit zum allgemeinen und dauernden Inhalt hat.
Die Kunst der Urgesellschaft ist noch unmittelbarer Ausdruck des Wesens des Menschen, seiner Heiterkeit. So können gleich mehrere Forscher von den „witzigen Trommeltänzen“ der Eskimo und den „Spottliedern“ berichten, die als „Gerichtssitzungen des verurteilenden Lachens … eine Institution des gesamten Eskimogebietes“ sind. (Gerichtsbarkeit in Form witziger Kunst ist wohl die menschlichste Form von Gerichtsbarkeit.)
Und von der Kunst der Indianer sagt Eva Lips: „Immer ist das Lachen das Mittel der Wirkung.“ So stellt sie bei den Nootka eine „Hinneigung zum Spaßmachertum“ fest: „Der Sinn für Späße ist schon in den Gemeinschaftstänzen der Nootka … In diesen Tänzen zeigt sich treffend das angeborene Komikertalent … Ähnliche Talente zeigen sie in den Spielen, die regelrechte Theatertitel tragen … Dabei werden neben anderen Späßen die Häuptlinge verhöhnt … Der Sinn für Spaß geht bei den Nootka so weit, dass sogar ein Kind es wagen darf, die heiligen Gesänge der Schamanen in spielender Lustigkeit karikierend nachzuahmen … Dass ein derart humorbegabtes Volk sich auch seinen Kulturheroen (den Helden, der alles Lebenswerte gebracht und gelehrt hat) nur als scherzhaften Charakter vorstellen kann, ist verständlich … ‚Nicht in jeder Kultur ist es möglich, vor einem dankbar applaudierenden Publikum in fröhlicher Weise diejenigen Institutionen derb zu parodieren, die der Gemeinschaft heilig und teuer sind‘.“ Und Catlin sieht, nachdem er das Gebiet der Indianer am Yellowstone als ein „wahres Land der Epikuräer“ kennengelernt hat, „diese Wildnis als die wahre Schule der Kunst“ an. Man betrachte ihre „Spiele und Unterhaltungen, die von unaufhörlichem Freudengeschrei begleitet sind, oder man gehe in ihre Wigwams und beobachte die um das Feuer versammelten Gruppen, wo Scherze und Anekdoten erzählt werden und fröhliches Gelächter erschallt – und man wird sich überzeugen, dass Lachen und Fröhlichkeit ihnen natürlich sind.“ Und bei den Sioux hat Catlin „so viele verschiedene Tänze“ gesehen, dass er „dieses Volk die tanzenden Indianen nennen möchte“. Einige dieser Tänze „sind ungemein grotesk und lächerlich und erhalten den Zuschauer in fortwährendem Gelächter“. Und von den Bakairi sagt Karl von Steinen, dass sie „mit lebendiger Pantomime“ zu spotten verstanden.
Die Heiterkeit der Kunst Schwarzafrikas belegt Eva Lips mit reichlichen Beispielen. So „dienen die in den Märchen auftretenden schalkhaften Tiere Afrikas einer geistvollen Lustbarkeit unter den Menschen und dienen außerdem im Palaver dem Beweis von Schuld oder Unschuld vor Gericht“. (Wenn nicht nur bei den Eskimo, sondern auch in Schwarzafrika Gericht in Form heiterer Kunst gehalten wird, kann das nicht aus dem Klima oder der Hautfarbe erklärt werden!)
Von den Polynesiern berichtet Chamisso: „Poesie, Musik und Tanz, die auf den Südseeinseln noch Hand in Hand, in ihrem ursprünglichen Bunde einhertreten, das Leben der Menschen zu verschönen, verdienen vorzüglich beachtet zu werden. Das Schauspiel der Hurra, der Festtänze der -Waihier, hat uns mit Bewunderung erfüllt … Im wandelnden Tanze entfaltet sich … die menschliche Gestalt aufs herrlichste, sich im Fortfluss leichter, ungezwungener Bewegung in allen naturgemäßen und schönen Stellungen darstellend … Welche Schule eröffnet sich dem Künstler, welcher Genuss bietet sich hier dem Kunstfreunde dar. Die schöne Kunst … ist die Blüte ihres Lebens, welches den Sinnen und der Lust angehört.“ Und zum gleichen Gegenstande: „So hingerissen und freudetrunken, wie die O-Waihier von diesem Schauspiel waren, habe ich wohl noch nie bei einem anderen Feste ein anderes Publikum gesehen.“ Und endlich: „Wahrlich, seit ich wiederholt die widrigen Verrenkungen anzuschauen mir Gewalt angetan habe, die wir unter dem Namen Balletttanz an unseren Tänzerinnen bewundern, erscheint mir, was ich … von der Herrlichkeit jenes Schauspiels gesagt habe, blass und dem Gegenstande nicht entsprechend! Wir Barbaren! Wir nennen jene mit Schönheitssinn begabten Menschen ‚Wilde’… Ich habe es immer bedauert und muss hier mein Bedauern wiederholt ausdrücken, dass nicht ein guter Genius einmal einen Maler, einen zum Künstler Berufenen … auf diese Inseln geführt. – Es wird nun schon spät. Auf O-Taheiti, auf O-Waihi verhüllen Missionshemden die schönen Leiber, alles Kunstspiel verstummt, und das Tabu des Sabbats senkt sich still und traurig über die Kinder der Freude.“
Von den Insulanern auf Imeo berichtet Friedrich Gerstäcker: „Unter einem der größten Brotfruchtbäume … standen fünf Indianer mit Trommeln … einander gegenüber … Um sie her lagerten in bunten Massen ich glaube alle Frauen, Mädchen und Kinder der ganzen Nachbarschaft. Die Männer trieben sich plaudernd und lachend zwischen ihnen herum. Jeweils wenn die Trommeln ihren Marsch begannen, warfen sich ein paar der Mädchen wie im tollen, wilden Übermut in die Reihe, und führten teils einzeln, teils gegeneinander den wildesten Tanz aus, den sich menschliche Einbildungskraft nur denken oder ersinnen kann. Ich habe nie etwas gesehen, das zu gleicher Zeit so graziös und doch so kräftig, so natürlich und dabei so unanständig gewesen wäre, als dieser Cancan … Es schien, als wäre die ganze weibliche Bevölkerung von der Tarantel gestochen. Wilder und jubelnder wurde dabei der Tanz, je mehr sich die Tanzenden selber an der Glut desselben erhitzten; schärfer wirbelten die Trommeln, die Augen brannten, die Locken flogen, und wieder und immer wieder stürmten die tollen Mädchen wie rasende Bacchantinnen, wenn ich sie schon zu Tode erschöpft glaubte, immer aufs Neue zwischen die Trommeln, die einen zauberhaften Einfluss auf sie auszuüben schienen … Wär ich ein Maler, das Bild dieses Abends müsste ich auf der Leinwand haben … es war ein wildes herrliches Bild, und ich werde den Abend in meinem Leben nicht vergessen.