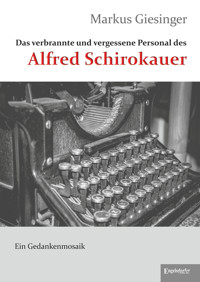
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Alfred Schirokauer wurde 1880 in Breslau geboren, wuchs in London auf, studierte in Hamburg und lebte als Schriftsteller in Berlin. 1933 flüchtete er nach Amsterdam und starb 1934 in Wien. Die zweiunddreißig Romane des jüdischen Erfolgsautors wurden auf nationalsozialistischen Scheiterhaufen verbrannt und Jahrzehnte lang nicht wieder aufgelegt. Markus Giesinger, Germanist und Historiker aus Wien, erweckt mit seinen Kurztexten die Figuren des nahezu Vergessenen zu neuem Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Giesinger
Das verbrannte und vergessenePersonal desAlfredSchirokauer
Ein Gedankenmosaik
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2025
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Angaben nach GPSR:
www.engelsdorfer-verlag.de
Engelsdorfer Verlag Inh. Tino Hemmann
Schongauerstraße 25
04328 Leipzig
E-Mail: [email protected]
Copyright (2025) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Titelbild © Tom Foolery [Adobe Stock]
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Einleitende Überlegungen
Alte Zeiten
Kleopatra (69 – 30)
Canidia
Charmion
Marullus
Gajus Julius Caesar
Calpurnia
Cytheris
Fulvia
Quintus Dellius
Lucilius
Arsinoe
Marcus Antonius
Octavia
Rhodon
Artavasdes
Domitius Ahenobarbus
Canidius Crassus
Octavian
Kleopatra
Messalina (20 – 48)
Valerius Messala Barbatus
Fufidius
Abalanda
Menalippus
Proculejus Gillo
Fabulla
Callistus
Pyrrha
Amyklas
Cäsonia
Cassius Chärea
Pollio Valerianus
Paris
Caligula
Polybius
Rubria
Narzissus
Livilla
Lepida
Publius Suillius
Gajus Silius
Pallas
Claudius
Agrippina
Valeria Messalina
Lucrezia Borgia (1480 – 1519)
Pomponius Lätus
Isabella di Luna
Carlo de Canale
Penthesilea
Gasparo da Procida
Juan Francesco da Procida
Beatrice del Sera
Alexander der Sechste
Pico della Mirandola
Angelo Poliziano
Giovanni Sforza
Cesare Borgia
Alfonso von Salerno
Michelangelo Buonarroti
Alfonso d´Este
Pietro Bembo
Lucrezia Borgia
August der Starke (1670 – 1733)
Joseph Fröhlich
Johann Siegmund Leister
Matthias David Pöppelmann
George Bähr
Christine Eberhardine von Sachsen
Aurora von Königsmark
Johann Przependowski
Jakob Heinrich von Flemming
Franziska von Radziwill
Ursula Katharina von Lubomirska
Georg Dominik von Lubomirski
Franz Josef Hoffmann
Friedrich der Zweite
August der Starke
Mirabeau (1749 – 1791)
Emilie de Mirabeau
Louise de Cabris
Sophie Monnier
L´Avisé
Julie Dauvers
Henriette-Amélie de Nehra
Olive Lejay
August Maria Raimund Prinz zu Arenberg
Marie Antoinette
Gabriel de Mirabeau
Napoleons erste Ehe (1796 – 1810)
Paul Barras
Eugène de Beauharnais
Louise Compoint
Eglé Marchery
Tobias Coen
Theresia Caraman
Joseph Fouché
Hortense de Beauharnais
Josephine de Beauharnais
Napoleon Bonaparte
Lord Byron (1788 – 1824)
Joe Murray
John Musters
Mary Chaworth
John Hobhouse
Charles Dallas
Nanny Smith
Augusta Leigh
Caroline Lamb
John Murray
Samuel Rogers
Annabella Byron
George Gordon Byron
Lassalle (1825 – 1864)
Hirsch Mendelsohn
Marie Krafft
Ludmilla Assing
Anton Krafft
Sophie Hatzfeld
Sophie Adrianowna de Solutzeff
Gustav Strasser
Ludwig Loewe
Hedwig Klingbeil
Karl Marx
Lothar Bucher
Otto von Bismarck
Ferdinand Lassalle
Neue Zeiten
Ilse Isensee (1904)
Franz Joppich
Terrie Miller
Martha Langer
Edgar Isensee
Manon Obal
Hilde Isensee
Hugo Wellmann
Adolf Faltus
Ilse Isensee
Junges Volk (1906)
Marga von Aust
Käte von Ruland
Agnes Kochius
Herbert Kochius
Erna Stein
Paul Brosig
Hedwig Kroll
Erwin Stein
Ludwig von Aust
Ernst Zoellner
Eva Stein
Marta Riel (1908)
Grete Klein
Hede Vollmer
Lotte Günter
Liese Berg
Olga Hartung
Fritz Wittmann
Otto Hagen
Anna Sybel
Jane Burton
Otto Heidekamp
Marta Riel
Die graue Macht (1910)
Walter Hoff
Elfriede Damerow
Anton Burgstaller
Lisbeth Hoff
Herta Hoff
Esther Honigmann
Susanne Neubert
Otto Rüdebusch
Ewald Hoff
Einsame Frauen (1911)
Elfriede Hasselbach
Werner Burkhardt
Lieschen Rademacher
Else Lange
Lotte Heine
Magda Heine
Hugo Heine
Anton Heine
Bruno Springer
Johannes Bode
Felix Wangenheim
Gertrud Arnheim
Otto Hesse
Walter Leyen
Käte Voigt
Hermann Reifeisen
Hanna Storm
Eine Jugendsünde (1912)
Beatrice Herforth
Manja von Ingenheim
Sophie Faber
Helene Pahlow
Fritz Faber
Fritz Salomon
Karl Hancke
Hanna Schulze
Heinrich Herforth
Egon von Ingenheim
Die siebente Großmacht (1914)
Pawel Michaelowitsch Wasmibratow
Percy Marwood
Amed Halim Pascha
Gabryèle Schreiner
Belkis Halim Hanum
Fedor Ryß
Herbert Ryß
Satan (1914)
Hans Slanina
Fritz Plath
Winni Johansen
Erna Plath
Hanna Carmen Nohr
Wally Fischer
Käthe Slanina
Die Stürmer (1916)
Wolfgang Maria Bauer Senior
Wolfgang Maria Bauer Junior
Rudolf Hartung
Hella Bauer
Adeline Frauendorfer
Tora Planck
Jan Muryn
Anni Muryn
Gustav Meißner
Theofil Rosen
Martin Weigell
Käte Vollmer
Gustav Roethe
Werner Baumgart
Carl Gustav Planck
Heinz Lohoff
Herbert Gise
Irrwege der Liebe (1920)
Oskar Wilm
Irene Hey
Die kleinen Fürsten (1922)
Fürst Alberto der Zweite
Giacomo Barella
Giovanni Diaconi
Marco Menari
Togna Diaconi
Angela Uvodic
Sava Ruvic
Milovan Gjorgjevic
Hinter der Welt (1926)
Sigfus Thorsteinsson
Arni Einarsson
Thyri Torarinsson
Asta Asmundsdatter
Karl Foehre
Helga Helaason
Die bunten Schleier (1927)
Jane Humphrey
Edward Ferry
David Mac Lean
Georgios Adamantos
Philipp Euphorion
Britomartis Tiotix
Andreas Boulos
Abel Wharton
Robert Ferry
Gentilla Rash
Der Tanz auf der Weltkugel (1927)
Rudolf Gedon
Luiz Barboso
Walter Ortner
Anna Iwanowna Ortner
Renate Gedon
Gegen Mensch und Schicksal (1928)
Bettina Sax
Maurice von Carisbrooke
Alex von Carisbrooke
James Britton
Beatrice von Carisbrooke
Robert Jeremiah Browne
John Moody
Tom Weller
Francis Sistare
Mae Walton
Fred Fox
Ruby Browne
Henry von Carisbrooke
Marya Fjodorowna Isajeff
Jakob Krause
Elisa von Gusserow
Erwin Oven
Lotte Bergwald
Else Schatter
Grete Lemke
Walter Breer
Henry B. Perrin
Wolfgang Röhn
Hilde von Lobach
Marta Markettan
Hedwig Schury
Alwil Schwanebeck
Horst von Kirchbach
Paul Linde
Wanda Linde
Peter Steinkamp
Toni Markettan
Helene Kunitz
Agnete Markettan
Karoline von Kirchbach
Knut von Lüneburg
Ramon Breton de Los Herreros
Angelita Breton de Los Herreros
Muriel Bouterweg
Septimus Egan
Roland Jerram
Robert Hay
Jan Bouterweg
John Rutland
Acht im Urwald (1930)
Joachim Dosse
Noel Pütter
Marga Behrend
Else Kruse
Anneliese Uth
Meta Pütter
Barbara Dosse
Karl Zwiebusch
Joao Miranda
Friederike Ahlgrimm
Manoel Camarao
Paul Majut
Beate Uth
Hede Kroll
Hanna Bira
Dieter König
Naomi Steven
Veit Nadler
Max Utpatel
Heinrich Habermehl
Albert Bernet
Dorit Klyß
Don Juan auf der Flucht (1932)
Elisabeth Bridon
Marcel Bridon
Evert Dermout
Cäcilie Jung
Robert Marsan
Ben Malcolm
Jim Parkins
Eva Schoy
Der erste Mann (1932)
Julie Just
Esther Mayer
Marta Wolter
Irma Kiesel
Ute Haink
Dina Quenz
Käthe Haink
Felipe Serrano
Ulrich Just
Schüsse in Shanghai (1932)
Iwan Filkin
William Ryan
Lionel Fairman
Edwin Ransom
Isa Ryan
Der Held von Berlin (1934)
Fritz Buchner
Jo Ternitz
Fatma Nansen
Viola Windal
Henry Bara
Martin Schneeberger
Peter Heise
Fritz Windal
EinleitendeÜberlegungen
Die frühen Achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts waren die Geburtszeit großer Vertreter jüdischer Erzählkunst: 1880 Alfred Schirokauer, 1881 Emil Ludwig und Stefan Zweig, 1882 Ernst Weiß und Leo Perutz, 1883 Franz Kafka und 1884 Lion Feuchtwanger.
Emil Ludwig hauchte den in seinen Biografien geschilderten Personen Empfindsamkeit ein und liebte das Herausarbeiten bisher unbekannter Aspekte. Er vermittelte den Unterschied zwischen Urteil und Verurteilung. Kritik üben bedeutete für ihn Schwächen erkennen und ihre Ursachen benennen, ohne Herabwürdigung.
Stefan Zweig, der Meister der Aphorismen und Metaphern, setzte mit psychologischem Blick Meilensteine der Weltliteratur und wurde von Völkerbundstatistiken als meistgelesener Autor der Zwischenkriegszeit ausgewiesen.
Leo Perutz blieb als farbenprächtiger Magier in Erinnerung. Mit seinem Aufheben von Gut und Böse verwirrte und faszinierte er die Leserschaft.
Ernst Weiß war einer der unaufdringlichsten und präzisesten Diagnostiker seiner Zeit. Mit nahezu sachlichem Schreibstil gelang ihm das Hervorrufen von Empörung und Leidenschaft.
Franz Kafkas Rang in der modernen Literatur bedarf keiner weiteren Erläuterung. Sein düsteres Erzählwerk erlebt seit Jahrzehnten ikonische Verehrung.
Lion Feuchtwanger widmete sein gesamtes Schaffen dem Kampf gegen religiöse und nationale Feindbildkonstruktionen. Vernunft war sein Credo des gemeinsamen Handelns von Menschen und Völkern.
Alfred Schirokauers Werke brannten ab 1933 ebenso wie die der Genannten auf den braunen Scheiterhaufen der Poesie. Doch anders als die seiner Kollegen blieben sie Jahrzehnte lang eingeäschert.
Dieses Buch ist der Versuch einer Wiederbelebung. Nicht nur des Autors, der unvergessen bleiben soll. Sondern auch seiner historischen und fiktiven Gestalten, deren Kämpfen und Zögern, Triumphieren und Scheitern dem Handeln und Leiden seiner berühmteren Zeitgenossen um nichts nachsteht.
Wie einem Verehrten gerecht werden? Mein Weg war das Hineinschlüpfen in seine Rollen mit meinen Worten.
Die am häufigsten angewandte Sprachform des Menschen ist nicht das Reden und nicht das Schreiben, sondern das Denken. Daher scheint mir das Gedankenporträt eine legitime Literaturgattung zu sein. Es besteht aus Sätzen von großer Unmittelbarkeit. Ohne Umweg über die Kommunikation mit der Außenwelt. Die Figuren bleiben in sich und für sich. Und wirken absichtslos. Weder an Zuhörende noch Lesende gerichtet.
Alfred Schirokauers Erzähltempo ist hoch. Das von mir gestaltete Denken der Handelnden bietet ein Innehalten. Besinnen. Oft auch abwägen. Ohne Hast. Die kurzen Texte sind Mosaiksteine, die zum Schluss ein Bild ergeben, das einzigartige Personen in einzigartigen Situationen darstellt.
Ich verstehe mich als Literaturarchäologe. Lese Verschollenes. Staune. Übersetze das Denken und Fühlen der vom Autor geschaffenen und nicht mehr gelesenen Zeugen früherer Lebensarten ins heute Verständliche. Und erschaffe sie neu.
Sprachforscher warnen alle Schreibenden vor zu üppigem Gebrauch von Adjektiven. Weil sie tendenziell weniger aussagen als Verben und Nomen. Schirokauer zeigt uns wie kein anderer das exakte und bereichernde Anwenden dieser etwas in Verruf geratenen Wortart. Seine Individuen sind voll von Eigenschaften, Eigentümlichkeiten, Einmaligkeiten.
Des Autors vielleicht größter Unterschied zu anderen Schriftstellern: Das Trennen von Charakter und Leistung. Viele seiner Figuren schaffen Großes, ohne groß zu sein. Oder sind Schwergewichte, die wenig bewirken.
Die von ihm erschaffenen Persönlichkeiten wirken weniger gemalt als fotografiert. Nicht verklärt, nicht geschönt, nicht liebenswürdig. Vielmehr dargestellt mit der Unbarmherzigkeit der Kamera. Schirokauer, in der Stummfilmzeit Mitglied und kurzzeitig Präsident der Vereinigung deutscher Drehbuchautoren, ist der Pionier des filmischen Erzählens.
Seine Helden der Vergangenheit sind stets gespalten zwischen Wollen und Erreichen. Menschlich sind ihre Ziele, blutig die Wege. Das erkennen sie. Daher fehlt ihnen der Fanatismus. Sie haben Skrupel. Das macht ihre Menschlichkeit aus.
Jeder Schirokauer-Mensch in den Gesellschaftsromanen, geschrieben von 1904 bis 1934, präsentiert eine Facette des frühen 20. Jahrhunderts. Das selbstbewusste Erwachen von Seelen, die immer weniger an Gott und daher zwangsläufig an sich selbst und das gesellschaftliche Fortschreiten glauben.
Meine Texte sind Kürzestgeschichten. Inspiriert von acht Romanen des Autors aus Europas Vergangenheit. Es folgen mit vierundzwanzig Titeln die fiktiven Zeugen aus der von Schirokauer erlebten Zeit. Beide Male chronologisch – die historischen in der Reihenfolge des Geschehens, die zeitgenössischen nach ihrem Erscheinungsjahr. Das Ergebnis nenne ich Mosaikprosa.
Alte Zeiten
Kleopatra (69 – 30)
Canidia
Für mein Haus benötige ich keinen der sieben Hügel. Zu mir passt die Mitte der Stadt. Dicht besiedelt, voller Geräusche und Geheimnisse.
Viele Frauen warten schon auf meinen Rat. Kaufen bei mir wohlmeinende Mittel, mit denen sie ihren Auserwählten halten können. Oder weniger wohlmeinende für den anderen Fall. Lautlose Rache sozusagen. Viele Säfte brauen meine Gehilfinnen und ich. Ohne feste Preise. Je nach Situation und Einkommen.
Natürlich ärgert es die meisten, dass des Caesars Ägypterin eintritt ohne Wartezeit. Vor allem die mit mir Gereiften, die vor Jahren selbst noch mit des Mächtigen Lächeln oder gar Schmeicheln protzen konnten.
Um ihre nahe Zukunft befragt sie mich. Die Antwort fällt nicht schwer. Und schon deute ich zischende und duftende Zeichen aus geweihten Essenzen.
Sie werde ihre Position in Rom festigen. Eher noch erhöhen. Ihre vom Geliebten beauftragte Statue werde zur Anbetung beitragen. Sie könne hoffen, den in ihrer Heimat erworbenen Göttinnenstatus auch hier zu erlangen.
Dies alles gebe ich mit Worten von mir, die Erfüllung versprechen oder wenigstens vermuten lassen. Garantien kann es keine geben für angst- und hoffnungsvolle Kundinnen.
Charmion
Seit Kindertagen kenne ich sie. Und wohl besser als alle anderen. Zweiundzwanzig ägyptische und zwei römische Jahre. Ich verstehe sie auch ohne Sätze. Worte reichen. Blicke. Bewegungen. Alles hat für mich Bedeutung.
Vor vier Jahren begegneten sie sich. Er nahm sie in der ersten Nacht zu sich ins Bett. Vor drei Jahren gebar sie ihm einen Sohn. Sein Begehren nahm ab und erlosch.
Das Caesar-Denkmal in der Stadt erhielt die Krone. Die Hälfte der Bürger spendete Beifall. Die andere Hälfte nicht.
Sie lebt für seine Triumphe. Und kann wenig anfangen mit dem Kind, das mit ausgestreckten Armen auf sie zustürmt.
Verbissenheit vertrieb ihre Freude am Spielen. Mit allem, was sich bespielen lässt. Und am Lachen. Über alles, was sich verlachen lässt. Meine arme Herrin, was verspricht sie sich vom Herrschen über Millionen?
Marullus
Zuerst teilte Caesar die Macht mit Crassus und Pompeius. Dann starb der eine, später der andere. Jetzt stört ihn nur noch der Senat.
Die Krone ließ er sich auf das Haupt setzen. Vorerst nur auf das steinerne. Ich entriss es ihm. Öffentlich. Und erhielt Applaus. Er soll spüren, dass nicht jeder sich nach seiner Allmacht sehnt.
Einen gefährlichen Gegner habe ich seit heute. Doch als gewählter Volkstribun vertrete ich viele. Mit Recht zürnt er mir. Der sich selbst meint, wenn er vom Volk spricht.
Gajus Julius Caesar
Unvorstellbar ist vielen noch der Gedanke vom Königtum. Ich muss ihnen Zeit lassen. Sie beobachten lassen, wie die Republik zerfällt. Und sich auflöst.
Schluss mit der Kultur des Niederschreiens und Niederstechens! Ich biete das Rom des Einen, der sich Ideen anhört und durchführt, wenn sie überzeugen. Mit Schlüsselpositionen betraue ich bewährte Kämpfer, die mehr können als ständig hinweisen auf ihre uralte Familienzugehörigkeit.
Fließen und nicht mehr versumpfen soll alles in diesem Staat. Was pulsiert, muss geschützt werden vor der Leichenstarre.
Sollen sie es als Diktatur bezeichnen. Ich nenne es das große Miteinander, garantiert durch meine Person.
Die Pharaonentochter hält mich jung und macht mich müde. Sie steht hinter mir und drängt. Geduldiges Abwarten lernte sie nie. Ihr Temperament vertritt wahrlich die Mentalität des Ostens. Sie denkt nur im Hier und Jetzt. Will Hindernisse nicht übersteigen, sondern beseitigen.
Sie ist Mutter und immer noch Kind. Voller Sehnsucht und Berechnung. Doch verdanke ich ihr die Botschaft meiner Politik: West und Ost sollen sich ergänzen. Voneinander lernen. Sobald die Schlachten geschlagen sind.
In meinem Rom werden alle Menschen würdig wohnen, weil sie ein Recht auf Obdach haben. Neubauten in den Städten, Beackerung des Landes, Straßen von einem Ort zum anderen. Wer dann noch nichts zu tun hat, wird gebraucht für die Errichtung der Häfen und das Befahren der Meere. Guter Lohn wird ausbezahlt für gute Arbeit. Und natürlich sollen die Bürger wissen, wem sie ihr Wohlergehen zu verdanken haben.
Calpurnia
Jetzt ist er wieder bei mir. In unserem Stadthaus, das ihm jahrzehntelang genügte. Hierher brachten sie den Leichnam. Und nicht zur Villa, jenseits des Tiber, wo die Bezaubernde vom Nil residiert. Und ihm ihre Träume einflüsterte, so lange, bis sie seine wurden.
Heimeliges Erholen von allem, was ihn draußen forderte, suchte und fand er bei mir. Bis es ihn trieb, in Ägypten den Mord an seinem Freund Pompeius aufzuklären. Dort verfiel er der orientalischen Berauschung.
Nach seiner Rückkehr war er uns allen unheimlich. Auch Brutus und Cassius schauten mich an mit verdrehten Augen. Mir signalisierend, dass auch sie sich von ihm verraten fühlten.
Als mein Mann war er einer, der den Senat überzeugen wollte. Und nicht entmachten. Gemeinsam mit Freunden und Kritikern wollte er Ziele formulieren und Wege skizzieren. Keine Andeutungen vernahmen wir je vom Griff nach diktierender Weltherrschaft.
Heute starb er durch die Dolche derer, die ihm einst vertrauten. Ich kann die Mörder verstehen. So wie ich früher den Ermordeten verstand.
Cytheris
Dem Riesen Marcus Antonius, der Caesars Stellvertreter war, schenke ich alles, was seine Gattin ihm nicht gibt. Seine begehrlichen Worte sind mir süßer Auftrag. Im Wissen um seine geheimsten Bedürfnisse.
Ob sie von mir weiß? Wie soll sie sich seine häufigen Abwesenheiten sonst erklären? Sein Haus bleibt mir verschlossen. Dort ist er nur Audienzen haltender Freund des Volkes.
Sie leitet die Finanzen. Weil sie weiß, dass er davon nichts versteht. Und daher ihr zu Willen sein muss.
Nichts ahnen die ihn Verehrenden von den Abhängigkeiten ihres Idols. Das nur mit mir zu höchsten Freuden und nur mit ihr zu höchstem Einkommen gelangt.
Fulvia
Szenen gibt es, die ich selbst meinem Mann, dem unmäßig saufenden Liebestollen, nicht zutraute. Er saß in seinem Arbeitszimmer, hinter ihm stand die um Caesar trauernde Ägypterin und knetete seine Schulter.
Ob in ihrer Heimat Königinnen auch massieren lernen, fragte ich sie. Schlagfertig meinte sie, dort lerne man als Frau, einen Ehemann so zu behandeln, dass er sich nicht auswärts vergnügen müsse.
Wie gut, dass ich meinem tollpatschigen Marcus Antonius riet, das letzte Testament seines toten Freundes zu vernichten. Die würde tatsächlich ihren Sohn zum zukünftigen Herrn über das Imperium ausrufen lassen. Und dazu benötigt sie den Konsul, den die Römer lieben, weil sie ihn nicht durchschauen.
Natürlich musste ich sie darauf hinweisen, dass hier jeder weiß, wie sehr sie mit ihrem Ehrgeiz den einst Beliebten und Verehrten seinen Landsleuten entfremdete. Ihre dreiste Antwort: Wie froh könne der vorläufige Nachfolger Caesars sein, dass seine Gemahlin ihn belehre und bevormunde.
Das war gestern. Heute wurde sie von einer Eskorte abgeholt. Die von mir angewiesen wurde, die orientalische Königin mit Kind zum Hafen nach Brindisi zu begleiten. Von dort wird ein Schiff sie führen, wo sie hingehört: zum Nil.
Quintus Dellius
Mein Herr, der Berechenbare, schickte mich zur unberechenbaren, aber nicht undurchschaubaren Königin Ägyptens. Und ich werde ihm ihre Bereitschaft verkünden.
Sie hat nur drei Ziele: Ihr eigenes Wohl, das Wohl ihres Sohnes und das Wohl des Ostens. Wenn der große Feldherr ihr Kind adoptiert, scheint für sie alles erreicht.
Mit ihrer Flotte unterstützte sie den Caesarmörder Cassius. Und sah nach dessen Niederlage ihren Fehler ein. Wird sie nun vor Marcus Antonius, um Verzeihung bittend, niederknien oder mit ihrer siebenundzwanzigjährigen Leibesblüte des Mannes Reizbarkeit ausloten?
Allmählich musste sie erkennen: Nicht nur Caesars mystische Ausstrahlung kann Menschen begeistern. Auch mit rauschhafter Unersättlichkeit und Genießen kurzer Freuden kann man die augenzwinkernde Zuneigung der Millionen gewinnen.
So wird er ihr wohl die irregeleiteten Mutterträume und sie ihm den Testamentsraub nach des Diktators Tod vergeben oder gar vergessen.
Lucilius
Ausgerechnet ich, der Geradlinige, Unbestechliche, Kompromisslose unterliege dem Charme einer Frau. Mich wundert nicht, dass sogar Caesar und andere Machtausübende taten, was sie wollte.
Marcus Antonius, Statthalter der östlichen Provinzen, befahl sie zu sich und wartete auf dem Marktplatz. Stundenlang. Auf die Frau, die sich entschuldigen und Begnadigung empfangen sollte.
Sie kam nicht. Residierte auf ihrem Prachtschiff, bejubelt von der Menschenmenge am Hafen.
Ich schien der Richtige, sie abzuholen. Mit Kommando und nicht mit Bitten. In Demut sollte sie ihre Absetzung als Königin und die Einverleibung Ägyptens in das Imperium zur Kenntnis nehmen. Und danken sollte sie für diesen milden und weitsichtigen Beschluss.
Doch selbst in mir weckte sie männlichen Stolz. Mir komme die Ehre zu, ihre Entscheidung dem Freund des unvergesslichen, von ihr geliebten und im März vor drei Jahren ermordeten Vertreters römischer Größe mitzuteilen. Er und ein von ihm ausgesuchter Kreis würdiger Gefährten werden von ihr auf das Schiff eingeladen. Um mit ihr über die Zukunft der Völker am Mittelmeer zu verhandeln.
Kein Wort von Unterwerfung. Bewirten will sie uns mit Köstlichkeiten ihrer Heimat. Und wie reagiert der Mann, der Caesars Nachfolge antreten will? Geschmeichelt signalisiert er Kompromisse. Diplomatisches Geschick sei oft zielführender als zelebrierter Sieg. Worte eines großen Kriegers.
Arsinoe
Meine Schwester verführte den römischen Eroberer. Ich nicht. So wurde ich Gegenkönigin. Und führte Krieg gegen den, der mit ihr die Nächte verbrachte.
Natürlich verlor ich. Und wurde beim Triumphzug in Ketten vorgeführt. Ich war die Machtlose, sie die Mächtige.
Doch niemals hätte Caesar eine sich ergebende Frau töten lassen. So wurde ich nach Ephesos verbannt.
Ich weiß von der Lebensgefahr, in der ich mich befinde. Denn jetzt teilt sie die Herrschaft mit einem, der im Umgang mit dem Weiblichen keine Ehre kennt.
Sie wird meine Vernichtung fordern. So wie ich ihre fordern würde, wenn ich könnte. Weil wir unbeherrschte und unbeherrschbare Schwestern sind.
Viel wird gesprochen von Geschwisterliebe. Und wenig von Geschwisterhass. Der mich am Leben erhält. Doch nicht mehr lange, wie ich fürchte.
Marcus Antonius
Wunderschöne Monate durfte ich unter Ägyptens Sonne verbringen. Mit der kleinen Unwiderstehlichen. Die nur mit mir leben will. Und mich nach Athen schickte, damit ich zum Krieg gegen die Parther rüste und wohl auch ihren, mit unserer Liebe angeschwollenen Bauch nicht sehe.
Mit meinen Gefährten kann ich über alles, was mich erfüllte, nicht reden. Sie machen abfällige Bemerkungen über die Eine, die mich Liebe erfahren ließ. Deuten an, mit mir könne man nicht mehr herzhaft über männlich-weibliche Bewegung und Lauterzeugung lachen. Ob mir in Alexandria mein fröhliches Römertum aus Leib und Seele gesaugt worden sei?
Kürzlich besuchte mich die Griesgrämigste von allen. Mit der ich mich in jungen Jahren verehelichte. Und die stets glaubte, ihr Rat sei für mich unentbehrlich.
In meiner Abwesenheit, aber in meinem Namen erklärte sie dem Verbündeten Octavian den Krieg. Und warf mir vor, ich hätte sie im Stich gelassen. Unverzüglich müsse ich in Rom beenden, was sie begann. Mit Worten hass- und neiderfüllter Eifersucht brach sie zusammen und verstarb. Ein schwaches Herz in einer starken Frau.
Sterbend siegte sie ein letztes Mal. Ich muss sie wohl in Rom bestatten lassen. Und Caesars Adoptivsohn niederringen. Erst dann kann ich das Reich in Asien absichern und vergrößern. Und römische Macht mit orientalischer Lebensart in Einklang bringen.
Octavia
Blut ist das sichtbarste Ergebnis des Kriegs. Es lässt andere Auswüchse erträglicher scheinen.
Häuser, verlassen von denen, die sie erbauten. Weil nun Soldaten sich darin von ihrem vernichtenden Handwerk ausruhen müssen.
Felder, sonst bearbeitet für die Märkte. Jetzt zertreten von Kriegerstiefeln. Deren Besitzer das Wenige essen, das geerntet wurde.
Waffen und Rüstung, hergestellt mit den Steuern der Wehrlosen.
Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und Hühner werden geschlachtet und landen nicht auf dem Tisch der Friedfertigen.
Daher suchte ich den großen Kriegsherrn auf, der kein Staatsmann ist. Im Namen meines Bruders Octavian, der kein Kriegsherr ist, doch vielleicht ein Staatsmann wird.
Sie sollen sich versöhnen, damit unser Land wieder atmen kann. Und nicht mehr Römer sterben von römischer Hand.
Ich weiß, dass der inzwischen verwitwete Marcus Antonius seine Frau verließ und den Verlockungen der königlichen Schönheit im Land der Pyramiden erlag. Ich weiß aber auch, dass er sich schon lange nach römischen, Vertrauen erweckenden Frauenaugen sehnt.
Der vor Monaten verstorbene Vater meines Kindes würde die den Feind umarmende Absicht verstehen: durch zärtliches Miteinander das Morden beenden.
Rhodon
Als Bettler verkleidet suchte ich die Nähe des Heerführers. Um ihn zu schützen. Und um alles zu erfahren, was er dachte, sprach und tat. Meine schwangere Herrin in Alexandria sollte stets informiert sein.
Kleine Nachrichten wurden von kleinen Informanten überbracht. Die große Nachricht blieb mir vorbehalten.
Ihre Dienerinnen wollten mich nicht vorlassen. Sie sei kurz vor der Geburt. Doch ich bestand auf Mitteilung der Neuigkeit.
Ein paar Augenblicke lang fixierte sie mein Gesicht und fragte, ob Marcus Antonius tot sei. Schlimmer, antwortete ich, er sei verheiratet.
Sie gebar Zwillinge, für die sie sich nicht interessiert. Immer wieder ersucht sie mich, die neue Gattin zu beschreiben. Alle vorgebrachten Details führen zur Erkenntnis: Octavia ist Römerin, Kleopatra nicht.
Warum musste es die Schwester seines Konkurrenten um Caesars Erbe sein? Ist sie am Ende das Bindeglied zwischen Kriegskunst und Verhandlungskunst? Fragen ohne Antwort.
Artavasdes
König der Armenier zu sein hieß von Anfang an: gute Nachbarschaft mit dem römischen Reich im Westen. Das ankündigte, keine Grenzen in Asien zu dulden. Und gute Nachbarschaft mit den Parthern im Osten, die römisches Herrschen nie anerkennen werden.
Ich beschloss die Unterstützung der römischen Übermacht, die jedoch parthischer Taktik nicht gewachsen war. So wechselten wir zu den Angegriffenen in der Hoffnung, unsere Sprache und Eigenart zu bewahren. Die Römer nannten es Verrat.
Und tatsächlich: Da sie die Parther nicht triumphierend durch die Straßen zerren konnten, taten sie es mit uns. Nicht in Rom, sondern in Alexandria. Armenier in Ketten als Symbol der neuen Hauptstadt. Und als Geschenk des Schlächters an die Frau, die ihm drei Kinder gebar.
Ob dies alles der rechtmäßige Erbe Caesars hinnehmen wird? Ich kann es mir nicht vorstellen. Die Weltherrschaft strahlt vom kleinen Tiber aus und nicht vom großen Nil.
Höhepunkt der Siegesfeier wäre unser Niederknien vor der Königin Ägyptens gewesen. Ich blieb stehen. Meine Gemahlin auch. Unsere Kinder auch. Vor tausenden Entrüsteten. Wir verloren den Krieg, aber nicht den Stolz.
Domitius Ahenobarbus
Grau wurde er in wenig Jahren, mein alter Freund. Und willenlos verliebt in eine Frau, die nur für sich kämpft.
Viele Senatoren und ich, der Konsul, kamen nach Ephesus, um ihn im Krieg gegen Octavian zu unterstützen. Weil dieser zuerst gegen uns und bald ohne uns herrschen will.
Nun sitzen wir da und müssen uns strategische Vorschläge einer auf dem Thron Sitzenden anhören. Ich unterbreche und ersuche sie, den Saal zu verlassen. Weil hier römische Männer über eine römische Sache zu beraten haben.
Zornig verlässt sie uns. Marcus Antonius eilt ihr hinterher. Kann es sein, dass vieles nicht Gerücht, sondern Tatsache ist? Haben wir Beschützer der alten Republik nur die Wahl zwischen diktatorischer Bedrohung in Rom und weiblicher Verhöhnung aus Alexandria?
Canidius Crassus
Die Einladung zum Kriegsrat nach Kleinasien kam zur rechten Zeit. So können die römischen Gläubiger lange nach mir suchen. Und jetzt bietet mir die Königin alle Schätze Ägyptens an, wenn es mir gelingt, die Senatoren umzustimmen.
Mit dem Verzicht auf ihre Seeflotte brüskiere man alle bewaffneten Kräfte, die nicht in lateinischer Sprache erzogen wurden. Und das sind viele.
Den Krieg gewinne man mit guter Stimmung im Heer und nicht mit antiorientalischen Ressentiments in der Heimat. So trete ich ein für das Imperium der Völker und gegen die Senatorenübermacht der alten Familien.
Empört beenden sie die Sitzung. Morgen fahren sie nach Rom und begeben sich unter den Schutz dessen, den sie bisher bekämpfen wollten. Weil sie eine leitende, vorausschauende und verschiedene Kulturen einigende Frau nicht ertragen können.
Ich aber bleibe beim Gefährten meiner Kindheit. Und bei der Mutter seiner Kinder. Und fern der Stadt, in der ich Schulden hinterließ.
Octavian
Den einen Mann, Caesar, den Fünfzigjährigen, liebte und beherrschte sie. Den anderen, Marcus Antonius, den Vierzigjährigen, verführte und beherrschte sie. Auch mich, den Dreißigjährigen, wollte sie auf ihre Seite ziehen.
Ein Leben lang war sie stets dort, wo ihr Wille durchgeführt wurde. War der Widerstand gegen sie schwach, wurde er beseitigt. War er stark, wurde er gestreichelt. So lange, bis er nicht mehr stark war.
Warum ich ihr nicht erlag? Vielleicht weil ich verheiratet bin mit einer Frau, die ihr sehr ähnlich ist. Die Macht ausübt und mich repräsentieren lässt. Und neidlos blickt, wenn ich bejubelt werde.
Nach dem großen Strategen Caesar und dem großen Krieger Marcus Antonius benötigt Rom das große Mittelmaß, das sich nicht betrügen lässt. Der Denker starb durch Mord, der Kämpfer durch Selbstmord. Vielleicht werde ich, der raffiniert Abwägende, im Bett sterben.
Kleopatra
Nichts faszinierte mich so sehr wie das ägyptische Leben, in dem alles Geschehen der Wille der Götter war. Und nichts liebte ich so sehr wie die griechische Sprache meiner Ahnen, in der alles begründet und erklärt werden konnte. Und nichts beeindruckte mich so sehr wie die römische Kraft, die alles erobern will.
Diese drei Vorstellungen von menschlichem Gedeihen prägten mich. Sie sollten sich nicht widersprechen oder gar verachten. Sondern gemeinsam und sich ergänzend wirken.
Königliches Vereinen des miteinander Handelns unterschiedlichster Völker war mein Lebensplan.
Mit Caesar, dem Weitblickenden, schien die Verwirklichung sehr nahe. Marcus Antonius tat sein Bestes, meine Gedanken mit seinem Schwert zu verbreiten. Octavian, Erbe des ersten und Feind des zweiten, zerstörte meine Ziele.
Wo ich lebte, war Liebe, Streit und auch Gewalt. Aber keine Gleichgültigkeit. Den friedlichen Austausch von Waren und Göttern dieser Erde wollte ich erreichen. Unter der Herrschaft eines Königs, der Menschen nicht befragen muss, weil er sie kennt und für sie da ist. Und wenn es diesen König nicht gab, hätte ich es mir selbst zugetraut. Ein großer Gedanke, für den ich mich nicht schäme.
Messalina (20 – 48)
Valerius Messala Barbatus
Sie ist noch ein Kind und weiß nicht, was sie sagt. Auf die Frage des Kaisers Caligula, ob sie noch unberührt sei, antwortet sie, nur weil er der Herrscher über alle sei, bleibe seine Schamlosigkeit unbestraft.
Er lässt nicht von ihr und lädt sie ein zu einer Feier heute Abend. Sie möge in dünnem Seidenkleid erscheinen. Und meine Tochter? Sie denke nicht daran, im Dirnengewand vor ihn zu treten.
Es wurde Zeit für mich, zur Rettung meiner Familie einzuschreiten. Er möge die etwas direkte Art eines Mädchens nicht überbewerten und es sei eine Ehre für unser Haus, wenn eine von uns zu ihm geladen sei. Gerne werde sie das kaiserliche Abendmahl besuchen und alles tun, um seiner Güte gerecht zu werden.
Fufidius
Fünfzigtausend römische Idioten bejubeln den Oberidioten. Der glaubt, wir seien genauso blutrünstig wie er. Wir sollen das Maul halten und uns an den Unterhaltungen in der Arena erfreuen.
Wenn mich etwas langweilt, dann sage ich, dass es mich langweilt. Mein Freund warnt mich. Sagen, was man denkt, sei derzeit lebensgefährlich. Ich aber bin nicht geboren, um meine Eindrücke für mich zu behalten.
Fressgierige Raubkatzen sind auch nichts Neues. Mit Fleischstückchen wird ihre Mordlust erhöht.
Jetzt wird ihnen ein alter Mann vor die Mäuler geschleudert. Sein Verbrechen: Er grüßte den Furchterregenden nicht, als Tausende es taten. Denn er ist stumm. Nur gurgelnde Laute kamen je aus seinem Mund.
Nach dem Aufprall ist er ein lebloser, blutender Haufen. Und muss das Aufgefressenwerden nicht mehr erleiden.
Abalanda
Als Germanenprinz in römischer Toga den Spielen beiwohnen zu dürfen ist nicht selbstverständlich. Der Kaiser gewährt mir dieses Vorrecht. Immerhin trage ich dafür die Haare kurz nach Art meiner Gastgeber.
Die letzte Vorführung scheine mich nicht beeindruckt zu haben, meint Caligula mit leisem Vorwurf in der Stimme. Ich antworte im Bewusstsein meiner geschützten Stellung: Einen stummen Bürger hinzurichten, weil er nicht grüßte, sei kein überzeugender Beweis römischer Gerechtigkeit.
Drohend gibt er von sich, er habe nicht den Mann bestraft, sondern die Natur seines Körpers, die dem Staatsoberhaupt den nötigen Respekt verweigerte. Im Übrigen möge ich ihn beim Reden nicht anstarren.
In meiner Heimat sei der Blick in die Augen des Angesprochenen ein Zeichen der Aufrichtigkeit.
Dem Bösesten und leider Mächtigsten fällt dazu nichts mehr ein. Muss er sich ein neues Opfer suchen, weil er mich nicht opfern kann?
Menalippus
Er fixierte mich, sprach mich an und ich wusste, dass er mich vernichten will. Irgendwer überbrachte ihm meine unvorsichtigen Worte über ihn.
Ganz offen teilte er mir mit, er habe sich eine Vorrichtung ausgedacht, die einen prominenten Gegner in Wachsflügel zwängt und der Hitze entgegen zieht. Das Opfer stelle Ikarus dar, der sich unbedacht der Sonne nähert. Und er, der Imperator, sei die Sonne, die freche Nähe nicht verzeiht.
Er wusste noch nicht, wer gerichtet werden soll. Nun weiß er es. Nachdem ich ihn als Abschaum auf dem Kaiserthron bezeichnete, beschloss er meine heimliche Vernichtung. Doch dass ich ihn auslachte, ließ ihn mein sofortiges Ende befehlen.
So sterbe ich denn jetzt und nicht in ein paar Tagen. Möge mein Tod allen zeigen, dass dieser zerstörungsgierige Herrscher mir bald folgen muss. Schaut zu, ihr Römer, wie es einem geht, der ausspricht, was ihr denkt!
Proculejus Gillo
Berater des Kaisers zu sein heißt für alles zu sorgen, was ihn erfreut. Und alles, was ihn nicht erfreut, von ihm fernzuhalten.
Die Raubkatzennummer in der Arena konnte er genießen. Ebenso den geflügelten, am Seil hochgezogenen und in die Tiefe stürzenden Querulanten.
Der Auftritt der fünfzig unbekleideten Frauen, die mühsam ihre Körperhaare entfernten und mit unflätigen Bewegungen aufreizten, langweilte ihn so, dass er sich erhob und ging. Tötende Energie berauscht ihn offenbar stärker als belebende Ausschweifung.
Und trotzdem beauftragte er mich, die Eltern der von ihm eingeladenen Messalina auszuladen. Was immer mein Gebieter vorhat: Väterliche und mütterliche Kindesaufsicht scheint ihm unerwünscht zu sein.
Neben tausendfachem Applaus für die blutigen Darbietungen sah ich auch eisige und empörte Blicke. Soll ich sie als erste Anzeichen schwankender Stimmung in Roms Bürgerschaft deuten?
Fabulla
Eine im Herrschaftshaus geborene Sklavin hat auch Rechte. So darf ich die mir aufgetragenen Tätigkeiten durchaus kommentieren. Komplimente sind erwünscht, wohlmeinende Anmerkungen werden geduldet, wenn ich Messalinas Leib im warmen Wasser knete.
Sie hört auf meine um fünf Jahre größere Erfahrung. Lässt sich von mir beraten, wenn es um das Formen der Haare und den Duft der Haut geht.
Bei der Kleidung ist sie eigenwillig. Sie lässt sich im Herrenmantel durch die Straßen tragen. Der Kaiser bevorzuge auch oft Frauengewänder. Ein kühnes Argument.
Noch nie hat mich die junge Gebieterin geschlagen. Sie ist in jeder Hinsicht anders als ihre mit der Peitsche ausgestattete Mutter.
Wie soll ich antworten auf ihre Frage, was der Herrscher bezwecke, wenn er beim Gastmahl ihre Anwesenheit und der Eltern Abwesenheit wünsche? Ich bin oder stelle mich zumindest ahnungslos. Dienerinnen sind gewohnt zu dienen und nicht einzuschätzen, was Mächtige vor oder nach dem Essen von ihren Gästen erwarten.
Callistus
Obwohl der Beherrscher Roms und somit der Welt mir vertraut, werde ich nie vergessen, dass ich ein Freigelassener aus Griechenland bin. Mir obliegt es, seine Launen zu lenken oder zu ertragen.
Eigentlich wollte er die heutigen Gäste im goldenen Brustpanzer Alexanders des Großen empfangen. Tatsächlich ließ er ihn aus dem Grab des legendären Kriegers entfernen.
Schließlich entschied er sich für das Darstellen von drei Gottheiten. Mit Goldfäden auf dem Kopf und im Gesicht will er die Macht Jupiters verkörpern. Das Seidenkleid aus Indien symbolisiert die Weltoffenheit des Merkur. Die mit Smaragd verzierten Frauenschuhe und die Socken aus Antilopenleder sollen an Venus erinnern.
Für alle muss ersichtlich sein: Sie haben die Ehre, die Gastfreundschaft des Mächtigsten, Tüchtigsten und Schönsten zu genießen.
Frühere Kaiser zeigten sich in weißer Toga ohne Schmuck. Und waren trotzdem als Staatsoberhaupt erkennbar. Mit bunter Extravaganz muss Caligula die Reizlosigkeit von Augenspiel, Stimme und Wortwahl ausgleichen. Ich weiß es. Er ahnt es.
Pyrrha
Heftiger kann eine Frau nicht beleidigt werden. Was ich heute erdulden musste, bleibt unvergessen. Und unverziehen.
Ein Spottgedicht auf mich, vorgetragen vom Imperator persönlich. Mein Aussehen sei eine einzige Lüge.
Das in Rom ergraute Haar werde durch pflanzliche Stoffe vom Rhein verblondet. Verhaltenes Schmunzeln einzelner Gäste.
Zwei Drittel meiner Zähne verbringen die Nacht nicht im Mund, sondern in einem Kästchen. Grinsen vor allem der jüngeren um die Gunst des Verhöhners Bemühten.
Wangen und Augenbrauen seien faszinierende Ergebnisse der Malkunst meiner Sklavinnen. Zustimmendes Kichern.
Der poetische Abschluss des Gefürchteten: Was mein Mann liebe, sei nicht ich. Und was ich sei, liebe er nicht. Applaudierendes Gelächter derer, die froh sind, verschont zu bleiben.
Ich beabsichtige aufzustehen und das kaiserliche Abendmahl zu verlassen. Doch mein Gatte verhindert es mit drohendem Blick. Denn er möchte Senator bleiben. Und Konsul werden.
Amyklas
Kaum ein Komiker ist für eine Abendgesellschaft unterhaltsamer als Claudius, der Onkel des dreifach göttlich gekleideten Gastgebers. Denn die beste Komik ist wohl die ohne Absicht.
Nie erscheint er pünktlich. Dann tritt er auf mit der gespielten Eile des Verhinderten.
Im Verlauf der noch verbleibenden Essensgänge kann er sich mit uns nicht unterhalten, weil er niemals weiß, worum es geht. So spricht er am liebsten über die Bücher, die er mit Leidenschaft schreibt und die keiner versteht.
Die anschließenden Darbietungen tanzender und singender Mädchen genießt er schnarchend und verdauend. Musik wirkt sehr beruhigend auf ihn.





























