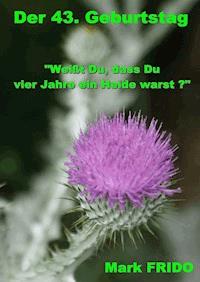
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine bewegende Biografie in klarer, einfacher Sprache und mit der richtigen Mischung aus Abstand und Nähe, die aus tief persönlicher Betroffenheit entsteht. ( R..G. Fischer Verlag). Auffallend spielt der „Freitag, der 13-te“ darin eine denkwürdige Rolle. „Weißt Du, dass Du vier Jahre ein Heide warst? “ sagte der Spiritual des Knabenseminares vorwurfsvoll zum elfjährigen Seminaristen und meinte damit, dass er erst mit vier Jahren getauft wurde. Dadurch erfuhr dieser erst wirklich, warum er trotz glänzend bestandener Aufnahmeprüfung ins Bischöfliche Gymnasium zunächst nicht aufgenommen wurde und ein Jahr die Hauptschule besuchen musste. Ein weiterer noch schwerwiegenderer Grund war der Suizid seines Vaters, als er selbst vier Jahre alt war. Damit bestrafte die römisch katholische Kirche nicht nur ihn, sondern die ganze Familie. Aber er konnte sich nicht schuldig fühlen! Es begann eine schmerzliche Beziehung zur r. k. Kirche, die durch die spartanische Erziehung im Seminar und zusätzlich durch die jahrelange Diskriminierung homo-sexueller Menschen, zu denen er sich hingezogen fühlte, zum seelischen Trauma führte. Der eruptive Ausbruch seines äußerst quälenden Tinnitus am 43. Geburtstag, an einem Freitag, dem 13-ten, war der „gellende Aufschrei seiner gequälten Seele“ und wurde ein entscheidender Wendepunkt in seinem Leben. Dazu kam noch die „Unheilige Dreifaltigkeit“ von Schwerhörigkeit, Tinnitus und Homosexualität, unter denen sein erfolgreiches Berufsleben als Lehrer sehr erschwert wurde. Der Autor geht mit der römisch katholischen Kirche kritisch um, schätzt aber das, was er ihr verdankt. Dazwischen auch humorvolle Episoden. Und immer wieder spielen die Zahl 13, und der Freitag, der 13-te, eine Rolle in seinem bewegten Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Mark Frido
wurde am 13. April 1941, am Ostersonntag, geboren und durchlebte eine zutiefst bewegende Kindheit, mit Tragödien in der Familie. Er war „Zögling“ in pädagogischen Institutionen der katholischen Kirche, wie im Knabenseminar, im Bischöflichen Gymnasium und schließlich im Priesterseminar – wobei er „nomen est omen“ das Seminar als „Zuchtanstalt“ erlebte, wiewohl er auch davon profitieren konnte.
Er war außerordentlich begabt, tat sich in der Schule und beim Studium leicht, was ihn nicht besonders beliebt machte. Er fühlte sich meist als Außenseiter. Er war überaus musikalisch und durfte als erster Zögling eines Knaben-Seminares auf das Konservatorium gehen um Klavier zu studieren.
Er ist homosexuell, was er Jahrzehnte lang verschweigen musste. Seine Interessen waren nicht die seiner Kollegen, wie Kartenspielen, Fußball und das andere Geschlecht. Auch tanzte er nicht gerne - obwohl Musiker - und hasste Sport.
Er studierte drei Jahre lang Theologie, wohnte im Priesterseminar und wechselte dann zum Studium der Germanistik, Schulmusik und Sologesang, weil er schwul war und keine Zukunft in der katholischen Kirche sah.
1968 promovierte er zum Doktor der Philosophie. Er unterrichtete über 35 Jahre als leidenschaftlicher und begeisternder Deutsch-Musiklehrer an Gymnasien und war letztlich Musik-Professor an einer kirchlichen Pädagogischen Akademie (Pädagogischen Hochschule).
Der 43. Geburtstag (ein Freitag, der 13-te!) war ein Wendepunkt in seinem Leben: Der eruptive Ausbruch seines quälenden Tinnitus stürzte ihn in eine tiefe Lebenskrise, der er letztlich dadurch entkam, dass er für eine neue Klientel, für Tinnitus-Betroffene und Schwerhörige, seine ganze Kraft und Freizeit altruistisch und gekonnt einsetzte.
Die diskriminierende und ungerechte Haltung der r. k. Kirche gegenüber Homosexuellen war zeitlebens ein schmerzvolles Kapitel, auf das er in diesem Buch kritisch, mit Verve und auch mit dem nötigen Abstand eingeht.
INHALT
Die Zahl 13 – Angst vor Freitag, dem 13-ten?
Familie
(Großvater, Tante Jola, Linie mütterlicherseits-Mutter, Großmutter, Vater Alex, Schwester Edda, Bruder Alexander)
Freundschaft mit Rosa und Gerti Kober
Die „falsche“ Lieblingstante Ria
Kriegszeit - Umquartierung bei einem Bauern - Das bäuerliche Leben, der bäuerliche Alltag
Mitten im Kriegsgebiet- Drei Tage und Nächte in einer Fuchshöhle
Vaters Selbstmord
Mit einem Ochsengespann auf der Flucht
Kindheit und Schulzeit
Knabenseminar - Bischöfliches Gymnasium
Studienzeit - Theologie
Schwere drei Jahre im Priesterseminar
Germanistik – und Musikstudium
Mein kritisches und schmerzliches Verhältnis zur r. k. Kirche
Deutsch-und Musikprofessor an Gymnasien und an der
Pädagogischen-Akademie
Die Musik – sinngebend für mein Leben
Der 43. Geburtstag
Der Tritonus meines Lebens – Schwerhörigkeit, Tinnitus, Homosexualität
Der „Umgang“ mit Homosexualität
Pensionszeit
Die Zahl 13 – Unglücks- oder doch Glückszahl?
Mein Lebenspartner
Mein zweiter Geburtstag
Das Fazit meines Lebens
Die Zahl 13 – Angst vor Freitag, dem 13-ten
Eigentlich war ich nie abergläubisch.
Ich wurde am 13. April geboren, bin aber sogar ein Ostersonntagskind. Ist man abergläubisch, so wären Unglück und Glück zu gleichen Teilen in meiner Person vereint.
Von meiner Mutter wusste ich, dass ich eigentlich am Karfreitag auf die Welt kommen sollte. Dann wäre das „drohende Unglück“ solide grundgelegt gewesen. Ich kam erst am Ostersonntag auf die Welt, aber an einem 13-ten. Und auch mein Vor- und Nachname bestehen in Summe aus 13 Buchstaben.
Auch mein Lebenspartner ist an einem 13-ten geboren. Allerdings soll es sich dabei um einen Schreibfehler der Pfarrkanzlei in der Taufurkunde handeln. Tatsächlich soll er am 11-ten geboren sein. Darüber nachzudenken, ob mit dem Freitag, dem 13-ten, Unglück verbunden sei, begann ich erst vor kurzem brandneu, als mein bereits seit Jahren gut kompensierter Tinnitus gerade am Freitag dem 13.09.2013 wieder derart unerträglich laut und quälend geworden ist, was meine seelische Balance erneut grundlegend erschüttert hat.
Beim Schreiben dieses Abschnittes recherchierte ich, auf welchen Wochentag der 13. April 1984, mein 43. Geburtstag, fiel, an dem um halb sieben Uhr morgens, als ich noch im Bett lag, mein leidlicher Tinnitus zum ersten Mal mit Urgewalt ausbrach und mein Leben seit nunmehr über 30 Jahren wesentlich mitbeeinflusst hat.
Mein 43. Geburtstag (13.04.1984) war ebenso ein Freitag, der 13-te.!
Auch die Zahl 43 ist eher eine Negativzahl für mich. Im Jahr 1943 fiel mein Bruder Alexander in Russland. An meinem 43. Geburtstag brach mein nunmehr langjähriger quälender Tinnitus aus.
Und der Todestag meiner Schwester Edda war auch ein Freitag der 13-te.
Und im Jahr 2013 erlitt ich einen Schlaganfall.
Der Freitag der 13-te gilt als Stiefkind der Kalendertage. Er tritt mindestens ein-Mal im Jahreskalender auf, und manchmal sogar drei-Mal pro Jahr.
Betrachte ich die negativen Ereignisse in meinem Leben an einem 13-ten, so frage ich mich: „Soll dies alles Zufall sein?“ Wer dies verstehen kann, der verstehe!
Die Angst vor dem 13-ten nennt man Triskaidekaphobie.
„(Aus griechisch τρεισκαίδεκα, translit. treiskaídeka, deutsch ‚dreizehn‘ und griechisch φόβος, translit. fóbos, deutsch ‚Furcht‘) wird die abergläubische Angst vor der Zahl Dreizehn genannt. Bei starker Ausprägung, insbesondere dann, wenn die Betroffenen alles, was mit der Zahl 13 zu tun hat, vermeiden und umgehen, spricht man von einer isolierten oder spezifischen Phobie im medizinischen Sinne.“ (Wikipedia – Aus dem Internet)
Vermutlich ist aber nicht der 13-te allein „schuld“ am Unglück oder Glück meiner doch recht bewegten Lebens-und Familiengeschichte.
Familie
Mein Großvater väterlicherseits war unnahbar - ich erinnere mich nur lose an ihn. Meine Mutter und ich wanderten zehn Kilometer zu Fuß von der Bezirksstadt Fellach nach Reigersberg, um ihn zu besuchen, - es war sehr heiß - ich war sechs Jahre alt. Wir kamen im Haus Reigersberg Nr. 25 an, der Großvater machte seinen Mittagsschlaf; dann kam er im Vorhaus die Stiege herunter. „Wer ist er?“ fragte er mich in der dritten Person. Dieser „er“ war ich. Leider gab es nie eine nähere Beziehung zu ihm.
Der Großvater väterlicherseits kam aus einer armen Keuschler-Familie aus dem Raum Bergen und heiratete die reiche Bauerstochter Juliane Priest aus Stenzen. Sie brachte den Reichtum mit. Sie starb schon 1922. Also 21 Jahre vor meiner Geburt.
Von Beruf war der Großvater Kaufmann, Gastwirt und Landwirt. Einige Jahre war er sogar Bürgermeister. Es war bekannt, dass er sich gut in Rechtssachen auskannte. Angeblich war er immer mit einem Advokaten zusammen zu sehen. Die Kinder (auch mein Vater) hatten keine Zuneigung oder irgendeine Gemütsbewegung von seiner Seite verspürt. Sie mussten alle an einem Extratisch, fernab von den Erwachsenen, zu Mittag essen und durften die Eltern nicht anreden. Großvater hatte bis zu seinem Tod, obwohl durch den Krieg verarmt, eine Köchin und einen Knecht.
Tante Jola, die Schwester meines Vaters, ging etwas verspätet in der Landeshauptstadt in die LehrerInnen-Bildungsanstalt und kam meist nur zu den Schulferien nach Hause nach Reigersberg. Sie wurde mit der Kutsche vom Bahnhof in Fellach abgeholt. Sie hatte ihr Zimmer im Haus Reigersberg Nr.33 eingerichtet. Großvater hatte in Reigersberg zwei Häuser, Nr.33 und Nr.25, die nur 50 Meter voneinander entfernt waren. Eines Tages, als sie wieder einmal von der Landeshauptstadt nach Hause kam, hatte mein Großvater ihr Zimmer im Haus Nr.25 - zwei Häuser weiter - am unteren Ende des Marktplatzes, eingeräumt und sie aus dem Stammhaus „auswaggoniert“. Tante Jola war empört und sprach von dort an mit ihrem eigenen Vater 20 Jahre kein Wort mehr.
Aber der Krieg nahm dem Großvater fast alles, das große Stamm-Haus mit dem Gastbetrieb war abgebrannt. Das Haus Nr.25 wurde von einigen Russen an der Vorderseite angezündet. Die resolute Tante Jola löschte gleichzeitig von der Hinterseite des Hauses her. Mutig gab sie den Zündlern saftige Ohrfeigen und vertrieb sie damit. Der Großvater wohnte nun auch im Ausweichhaus Nr.25 und hatte nicht einmal mehr ordentliche Kleidung, sodass er nach dem Suizid meines Vaters (03.04.1945) dessen Anzüge tragen musste. Da war Tante Jola zur Stelle.
Tante Jola war Lehrerin, wurde aber wegen ihrer Nazivergangenheit ins Gefängnis geworfen, und ihre Pension wurde strafhalber gekürzt, sodass sie eher karg leben musste. Trotzdem nahm sie ihren Vater auf und versorgte ihn bis zum Tod, obwohl sie 20 Jahre lang zuvor kein Wort mit ihm gesprochen hatte.
Das Testament des Großvaters war fintenreich konzipiert. Ein Kabinettstück eigener Prägung! Alleinerbe wurde der in Russland vermisste Sohn Robert, mein Onkel, der Bruder von Jola und von meinem Vater Alex und von dem in der Bundeshauptstadt lebenden Bruder Onkel Kurt, mit der Zusatzbestimmung, dass Robert nie toterklärt werden darf. Ein Advokat wurde zum Nachlassverwalter bestimmt. Also konnte eigentlich niemand das Erbe antreten. Als Alternative hatte er aber doch seine anderen Kinder, Onkel Kurt, der in der Bundeshauptstadt lebte, und die Kinder seines Sohnes Alex (also Edda, meine Schwester und mich) als Erben eingesetzt. Seine Tochter Jola setzte er dennoch auf den gesetzlichen Pflichtteil, obwohl sie ihren Vater in den letzten Jahren von ihrem kärglichen und aus Strafe zusätzlich gekürzten Lehrergehalt miterhielt. Nach ziemlich langer Hinhaltetaktik des Rechtsanwaltes wurde diese Variante des Testaments dann vollzogen.
Mein Vater Alex beging am 03.04.1945 Suizid.
Onkel Robert kehrte aus dem Krieg nicht mehr zurück.
Der Großvater starb am 05.11.1951 in Reigersberg.
Onkel Kurt, ein weiterer Bruder meines Vaters, starb 1961 in der Bundeshauptstadt.
Tante Jola starb am 03.04.1965 in einer Pflegeanstalt, auf den Tag genau 20 Jahre nach meinem Vater. Leider wurde sie hochgradig dement und erkannte am Ende ihres Lebens niemanden mehr, obwohl sie eine hochgebildete Frau war. Sie galt in ihrem Heimatort als strenge aber gute Lehrerin. Ansonsten war sie eher abgehoben und pflegte nicht mit jedermann Kontakt.
Sie blieb ledig und hatte keine Kinder, wie auch die anderen Geschwister, mit Ausnahme meines Vaters. Onkel Kurt hatte eine lockere Beziehung zu einer etwas geistig behinderten Frau, vermutlich aus Mitleid mit ihr.
Die Linie mütterlicherseits
Am 09. Jänner 1988 starb meine Mutter mit 85 Jahren, die ich sehr geliebt habe. Sie war das jüngste von den sechs lebenden Kindern der Kleinbauernfamilie Maria und Josef Mörtl aus Lobensdorf und wurde am 06. April 1903 geboren. Sie bekam den Vornamen Johanna und wurde zeit ihres Lebens immer Hanni und Hanni-Tante genannt
Ihr Vater, mein Großvater mütterlicherseits war sehr früh verstorben. Meine Mutter hatte keine Erinnerung an ihn, und ich kannte ihn generationsbedingt überhaupt nicht.
Die Großmutter mütterlicherseits meisterte ihr karges Kleinbauern-Leben mit den sechs Kindern und galt als warmherzige, tüchtige Frau. Sie hatte mit 81 Jahren der Schlag getroffen und lag krank darnieder. Meistens starben solche Patienten am dritten Tag danach oder spätestens nach einer oder zwei Wochen. Ihr Sterben am 06. März 1951 erlebte ich traumatisch.
Als meine Mutter das Telegramm mit der Todesnachricht bekam, schrie sie laut auf, und ich wusste nicht, wie ich sie beruhigen konnte. Wir fuhren am Vortag des Begräbnisses mit dem Zug nach Föhring, und dann hatten meine Mutter und ich noch einen Fußmarsch von über zehn Kilometern vor uns.
Die Großmutter war im Bauernhaus, in der Stube, offen aufgebahrt. Eine Tür führte von der Küche direkt in die Stube. Ich erinnere mich lebhaft, als ich allein bei der aufgebahrten Großmutter in der Stube weilte, da puschte jedes Mal, wenn beim Bockspringen in der Küche einer über den Rücken des anderen sprang, dieser lautstark gegen die Stubentür.
Es war in dieser Gegend Brauch, dass Verwandte und Nachbarn auf diese Weise die Totenwache hielten. Man kam zusammen, aß und trank, bzw. man besoff sich und vertrieb sich die Zeit mit Spielen.
Es war kaum einer nüchtern bei der Totenwache. Allerdings war diese Gegend als Säufer-und Raufer-Gegend bekannt. Für ein Kind aus der Stadt, wie mich, war dies ziemlich roh und wild und schwer begreiflich. Für mich schockierend war auch die Tatsache, dass ihr Sohn, mein Onkel Seppl, schon zwei Wochen, bevor meine Großmutter starb, den Sarg im Haus bereitgestellt hatte.
Wenn man aber die zum Himmel schreienden Totenklagen und das Klagegeheul der Klageweiber in südlichen Ländern betrachtet, war diese bäuerliche Totenwache im Vergleich dazu trotzdem fast dezent.
Meine Mutter setzte ihre letzte Kraft ein um für uns beide (meine um sieben Jahre ältere Schwester Edda und mich) vorbildlich zu sorgen. Sie verzichtete zu unseren Gunsten praktisch ihr ganzes Leben lang auf das nicht unbedingt Nötige.
Sie war das jüngste von sechs Kindern der Familie Mörtl und wurde am 06.04.1903 geboren. In dieser Zeit nahmen Kleinbauern zum eigenen Baby ein gleichaltriges aus der Stadt gegen Bezahlung in Pflege. So kam Maria Heiligenbrunner (später verheiratete Maria Brenner) aus der Bundeshauptstadt zur Familie Mörtl als Ziehtochter.
Eigentlich blieben die beiden Ziehschwestern ein ganzes Leben lang eng verbunden. Und Tante Ria wurde für mich meine liebste Tante, obwohl sie nur eine „falsche“ Tante war. Und immer, wenn ich von meiner „falschen“ Tante sprach, war mir die volle Aufmerksamkeit der neugierigen, skandalträchtigen Zuhörer gewiss.
Meine Mutter erzählte mir, dass sie eigentlich immer auf sie Rücksicht nehmen musste, da sie ja ein ganz zartes Kind gewesen sei. Das blieb auch so in ihrer späteren Beziehung zu ihr. Ich erinnere mich an „Tante“ Ria, wenn sie aus der Bundeshauptstadt zu uns nach Fellach kam. Sie brachte immer etwas mit. Vor allem aber wurde unsere Wohnung stimmungsmäßig auf einmal hell und fröhlich, denn Tante Ria konnte aus voller Kehle lachen, was meiner Mutter schwer fiel. Sie war meist zurückhaltend, introvertiert, melancholisch und im Benehmen eher gehemmt.
Sie entwickelte im Lauf der Zeit Eigenschaften, die später auch auf mich abfärbten. Kartenspielen, Fußballspielen, Pfeifen auf der Straße, besonders von Frauen, und natürlich Trinken von Alkohol waren ihr suspekt. Auch zu lautes Niesen war ihr peinlich. Und das alles übernahm ich unbewusst in mein Leben.
Meine Angst vor Hunden
Meine Mutter stammt aus einer Kleinbauernfamilie. Dennoch entwickelte sie in ihrem Leben eine unerklärliche Angst vor Tieren, die sich auch auf mich übertrug. Hunde beißen, Katzen kratzen, Gänse schnappen zu, der Hahn und die Hühner flattern gefährlich auf und kreischen, Pferde schlagen aus, Schafböcke stoßen, wie auch die Kühe. Stiere sind ohnedies gefährlich, Mäuse und Hamster sind abzulehnen und Ungeziefer, und Ratten sind abscheulich. Das führte dazu, dass ich eigentlich keinen Bezug zu Tieren bekam. Auch heute noch würde ich gerne auf den Tisch oder auf den Sessel flüchten, wenn eine Maus voller Angst und Panik durchs Zimmer läuft.
Zur realen Angst vor Hunden trug noch ein Vorfall bei:
Meine Mutter hatte einen kleinen Vorgarten und schickte mich mit dem ausgerissenen Bohnenkraut und anderen gejäteten Pflanzen, mit dem vermeintlichen Futter, zu einer Nachbarin, die Ziegen hatte. Als ich die zehn Betonstiegen zum Hauseingang hinaufgestiegen war und anläutete, kam die Nachbarin mit ihrem kläffenden Hund, den sie mit dem einen Arm zurückhielt, heraus. Als ich ihr aber das Futter überreichte, ließ sie den Hund los, und als ich mich umdrehte und die Treppe hinunter steigen wollte, biss mir der kleine Köter in mein Hinterteil. Vor lauter Schreck fiel ich kopfüber die zehn Betonstiegen hinunter. Das war der endgültige Anlass, der meine fast lebenslange Angst vor Hunden besiegelte.
Schon in meiner Internatszeit, spotteten meine Jahrgangskollegen über meine Hundeangst. Wenn ich auf der Straße ging und ein Hund kam mir entgegen, wechselte ich die Straßenseite. Ging ich um die Ecke und ein Hund kam überraschend daher, wurde ich kreidebleich und mir wurde schlecht. Erst viele Jahrzehnte später löste sich diese Angst auf.





























