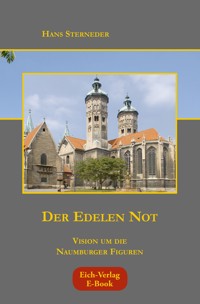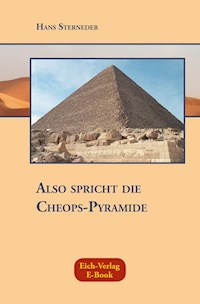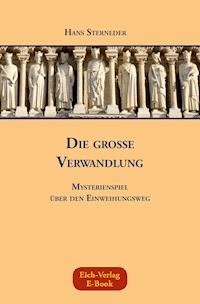10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eich, Thomas
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein hochinteressantes und abwechslungsreiches Buch in Tagebuchform. Hier offenbart sich die vielgestaltige Weltsicht Hans Sterneders. Volkskundliche Hinweise auf altes Brauchtum und Bauernwissen stehen gleichberechtigt neben Naturbeobachtungen, mystischen Erfahrungen, alltäglichen Begebenheiten und spirituellen Erkenntnissen. Die Wiener Volkszeitung bezeichnete „Frühling im Dorf“ 1928 als Sterneders „gereiftestes, innigstes und innerlichstes Werk, das Bekenntnisbuch eines wahrhaftigen Dichters, Gestalters, Sehers und Predigers.“ Und der Berliner Lokalanzeiger nannte es „ein Buch für stille Stunden, von dem man wünschen möchte, dass es recht viele Leser findet.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Hans Sterneder
Frühling im Dorf
Tagebuch eines Besinnlichen
Eich-Verlag
Bitte respektieren Sie das Urheberrecht. Sie dürfen dieses E-Book
nicht kopieren, verbreiten, reproduzieren oder zum Verkauf anbieten.
Das betrifft sowohl kommerzielle als auch nicht-kommerzielle Zwecke.
Danke für Ihr Verständnis.
1. E-Book-Auflage 2018
© Thomas Eich-Verlag, Werlenbach 2010
Alle Rechte vorbehalten
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Umschlagfotos: © emeraldphoto - Fotolia.com / © Anobis - Fotolia.com
Umschlaggestaltung, Satz und Datenkonvertierung E-Book: Thomas Eich
Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.eich-verlag.de
ISBN 978-3-940964-52-6
Meiner langjährigen Mitarbeiterin
Frau Emmy Hausamann
in freundschaftlicher Verbundenheit
INHALT
Gottsehnsucht
Heubodennächte meiner Jugend
Wunder des Sternenhimmels
Der Sternenhimmel im Ackerkrümchen
Lao-Tses Weisheit
Die Schneerosen und der Bub ohne Seele
Der hellsehende Knecht und die Schau der Urahne
Über die Einsamkeit des Menschen
Sympathie und Antipathie in der Natur
Nachtsturm
Ein Brief aus Java und das Geheimnis der schwarzen Korallen
Brief des sächsischen Landbriefträgers
Weisheit der Chinesen
Der Odem der Erde
Mein Buch im Ozeandampfer
Vorfrühlingsseligkeit
Über Saatengrün und den tieferen Sinn des Baumveredelns
Dschelalledin
Tod der Bäuerin
Frühlingsanfang; der Tischler und die Heckenrose
Der Landbriefträger und Meister Eckehard
Die heilige Zahl 13
Die zwölf Apostel und die kosmische Symbolik im Christentum
Der erste Leierkasten
Begräbnis der Bäuerin
Kurt Hielscher
„Die Keule“
Die Kunst sich freuen zu können
Der Hyazinthenstock
Frühlingsfeier
In der Augustinerkirche: Die Magie der Musik
Aus der Bhagavad Gita
Das schwebende Bild
Die Zahl 7 und die Flöte Pans
Das Rotkehlchen
Gustav Meyrink
Maria Verkündigung: Ist die unbefleckte Empfängnis möglich? Hypnose, Stigmatisation, Therese von Konnersreuth
Atmen, Schwalben und das Zugvogelgeheimnis
Der rohe Pferdeknecht; Zorn, der Vergifter der Lebenskraft
Verbindung mit dem Erdgeist
Manu-Weisheit
Magie des Wortes
Unsere Gedankenlosigkeit dem Leben der Worte gegenüber
Mensch und Affe
Antiquariate, Bilder und Damenmode
Die moderne Frau und der Mond
Bauernwissen: Der Mond, der Befruchter alles Lebens
Der Mond, die große Mutter
Mond und Magnetismus
Der Schutzgeist jedes Menschen und wie man sich mit ihm verbindet
Palmsonntag: Kindheitserinnerung und das Geheimnis des Eselsrittes
Die Enzianwiese
Mein Freund der Flickschuster
Sie scheuen das Licht
Gründonnerstag und die Poesie der Sonnenbrüder
Die Henne und die Küchlein
Karfreitag: Christi und Wotans Tod
Karsamstag
Auferstehung: der kosmische Sinn des Osterfestes; das Geheimnis des uralten Lammkultes und das Osterei
Meine blühenden Kirschbäume
Persisches Wortspiel
Sonnenpreisung
Die Mohnkapsel
Löwenzahnblüte
Das Hohelied über die Bienen
Japanisches Sprichwort
Das Glück des Schweigens
Maeterlincks Bienenbuch
Bienenkönigin und Künstler entstehen durch das gleiche esoterische Gesetz
Blumenschändung
Aus Tolstois Tagebuch
Segen der Nacht und der Morgenstunde
Gang zur Post
Mein Arbeitsplatz und die Vögel
„Einpflöcken“ von Krankheiten
Meise und Adler
Frühlingswonnen
Also spricht Thomas a Kempis
Der Blumensamariter
Hellsehen
Abschied
Verklärung des Alltags
Einer meiner „Neffen“
Gang durch die Kornfelder und die Not des Malers
Über Naturschutz und die Trägheit der Herzen
Sternnacht am Roggenacker
Glück der Arbeit
Der grellrote Automat
Noch ein japanisches Sprichwort
Albrecht Dürer
Morgensonnenpreis
Feier im Morgentau
Der Brief: Sinn der Träume
Morgenpost
Der Ruf aus dem Jenseits
Bruder Baumkauz
Aus Balzac
„Jakob“
Kastanienblüte
Erinnerung an Hans Thoma
Wie einer ist, so ist sein Gott
Christi-Himmelfahrt: Sind Auferstehung und Himmelfahrt möglich?
Löwenzahnkugeln
Ludwig Huna
Japanische Sprichwörter
Freundschaft mit Jakob
Mai-Ende
Das mysteriöse Bild
Jakob der „Maler“
Mystische Betrachtung von Dürers „betendem heiligem Antonius“
Jakob und die Tintenwürmer
Das Geheimnis der Sphinx
Ödipus und die Sphinx
Das Rätsel der vier Evangelientiere
Der magische Tod Lord Carnavons
Die Unzerstörbarkeit der Gedanken
Almpfingsten
ANHANG
Der Fluch des Stolzes
Das magische Zeichen der unsichtbaren Wesen
Aus Meister Eckehard
Was ist das in mir, dieses Unnennbare, das mich oft in den glücklichsten Stunden meines Lebens heiß und brennend überfällt?
Diese unheimliche Sehnsucht nach irgendetwas, das so groß und unergründbar ist, dass es mir das Herz bedrängt? Das nicht nach einem Ding der Erde geht, nicht nach Liebe, Ruhm oder Ähnlichem verlangt. Die heute aufbricht und in mich stürmt bei der Versenkung in das Mysterium eines Blütenkelches, die mich morgen erfasst bei irgendeinem erhabenen Wort von großer Schönheit oder Tiefe in einem Buch oder auf der Bühne; die plötzlich unter Aberhunderten von Menschen in mir aufflammt und dann wieder hoch oben in der feierlich erhabenen Einsamkeit eines Berggipfels mich überfällt; und die bis zu Tränen mich übermannt bei den unerwartet aufbrechenden Tönen eines frühlingsgläubigen Leierkastens!
Was ist es, dieses seltsame Verlangen, eins zu werden mit einem unvorstellbar Hohen, Reinen, Großen? Dieses sich Vereinenwollen mit einem gewaltig Vorhandenen und dennoch nicht Vorstellbaren, einer Macht, einem Odem; dieses sich Ergießenwollen in ein wundersam mildes und dennoch urstarkes Licht!
Ja, ein Licht!
Ich habe viel nachgedacht darüber und weiß jetzt, dass diese nothafte Licht-Sehnsucht Heimweh ist! Heimwehverlangen nach dem Schoß und Ziel unseres Lebens! Urheimweh nach letzter, beglückendster Geborgenheit in Gott! Ja, dass diese leidvolle Sehnsucht höchster, letzter Sinn unseres Lebens ist!
Und dass dieses Heimweh, wenn auch nicht bewusst empfunden, dennoch in Stein, Pflanze und Tier genauso heilig wach ist, wie es in Menschen und Gestirnen pulst und drängt.
O gepriesen das Herz jenes Menschen, in dem diese heilige Flamme der Sehnsucht aufbricht zu immerwährender Unruh!
Gesegnet das Herz, in das sich das inbrünstigste Gottverlangen eingenistet!
Gott! Mein Gott! Darum rufe ich zu Dir bei Tag und Nacht, im Träumen und im Tun. O lasse sie flammen, die Feuer, lasse sie brennen, die Not der Sehnsucht!
Brandgenarbt will ich sein über und über, denn ich weiß, dass in der Stunde dereinst im Ring der Äonen, in der ich ein einziges Feuer sein werde, Dein Ruf erschallen wird, der meine Erdbahn endet und mich heimkommen heißt für ewig in Dein Licht!
*
Als ich noch ein Bub war und bei meiner Großmutter in dem kleinen Bauerndorf lebte – Tag um Tag mutterseelenallein, bis sie abends aus der Tagelöhnerei bei den Bauern heimkam –, liebte ich nichts mehr, als wenn wir im Sommer auf den Dachboden stiegen und uns im duftenden Heu zur Ruh legten. Wie war da die Stille geheimnisvoll! Großmutter war müde und schlief rasch ein. Dann war ich allein in der lautlosen, beinah unheimlichen Dunkelheit, die ich allein nicht ertragen hätte und die nun für mich, weil die Großmutter neben mir lag, so reizvoll war.
Ich machte mir keine Gedanken dortmals, warum ich die undurchdringliche Dunkelheit und die Stille so liebte, warum ich mich Tag um Tag auf beides freute und das Einbrechen der Nacht kaum erwarten konnte.
Und dann lag ich regungslos, mein Herz pochte und alles in mir lauschte.
Und meine Seele kam in prickelnde Erregung in diesen Stunden voll einer unerklärlichen Macht.
Ab und zu knackte es leise im uralten Gebälk des Giebels, scharrte es gruselig über die verwitterten sonnzersprungenen Schindeln: die scharfen, hornigen Krallen einer schleichenden Katze. Und wenn ich meinen Kopf ein wenig hob und zur Seite drehte, blitzte irgendein Himmelsstern in die Finsternis.
Meist aber lag ich regungslos, wie von einer unsichtbaren Macht bezwungen und horchte in die Stille.
Und plötzlich begann es zu raunen, leise und heimlich, dass es mir den Atem benahm. Und ich wurde ganz verwirrt, denn ich konnte nie ergründen, woher die Stimme kam.
Und ich bin jedes Mal schließlich zwischen Gruseln und unerklärlicher Lust eingeschlafen und habe nie hinter das Geheimnis der rätselhaften Stimme kommen können.
Viele Jahre sind seither verflossen; das Schicksal hat mich aus dem Dorf und dem winzigen Häuschen meiner Großmutter geweht. Ich habe Lust und Leid der Erde in hohem Maß erlebt und Dinge erfahren dürfen, die andere Menschen ein Leben lang nicht einmal ahnen. Und wenn ich heute wieder „in die Stille gehe“, ist diese geheimnisvolle Stimme meiner Kindheitstage noch eben so klar in mir, nur dass ich heute weiß, wer zu mir redet.
Ein Vierteljahrtausend vor meinen Jugendtagen aber hat der mystisch erleuchtete Geist des großen Deutschen Angelus Silesius diese flammenden Worte mit seiner selbstgeschnittenen Kielfeder aufs Papier geschrieben:
Je mehr du dich aus dir kannst austun und entgießen,
Je mehr muss Gott in dich mit Seiner Gottheit fließen.
*
Was ist es doch für ein Geheimnisvolles um diese Nächte!
Der Himmel scheint in doppelter Kraft und wildester Aufbruchsfreude.
Kommt es vom Aufwachen des heiligen Lebens in diesen Tagen, oder ist der königliche Jäger Orion, der Nacht um Nacht über den Himmel stürmt, umheult von seinen beiden Hunden Sirius und Procyon, die wild den sich zu Wehr setzenden Stier anspringen, daran schuld?
Ja, königlich sind sie, diese letzten Winternächte! Königlich ist der Kampf und der Jäger, der, alles überstrahlend, sieghaft am Himmel steht.
Ich kann mich nicht sattsehen in diesen Nächten, doch so sehr meine Augen auch schwelgen, immerzu müssen sie auf den Orion schauen.
Welche Schönheit der Form! Wie das Geschmeide seines Schwertgürtels leuchtet! Ich muss, wenn ich länger zum Himmel emporschaue, die Arme heben, naturnotwendig. Wohl, mein Herz ist voll Inbrunst, aber dies ist es nicht, es ist ein Urdrang, dem ich gesetzmäßig nachgeben muss – und bald fühle ich ein seltsames Prickeln in den Fingerspitzen: das Einfließen der kosmischen Kraftströme. Und ich fühle mich geheimnisvoll verbunden mit dem Sternenhimmel, dessen unsichtbare Ströme von den Antennen meiner vorgestreckten Finger aufgefangen und eingesogen werden und in balsamischer Kühle meinen Körper durchrieseln. Das ist das Geheimnis, warum die Priester aller Völker beim Gebet die Hände zum Himmel heben.
Was ist Zeit, was ist Raum?
Was ist groß, was ist klein?
Siehe die tiefrot leuchtende „Schulter des Riesen“, wie die Araber Beteigeuze im Orion nennen. Wie klein ist der Stern, gemessen an der Goldkugel unserer Sonne, von der die Gelehrten sagen, dass ihr Durchmesser 1400000 km beträgt. Wie aber, Bruder, wird dir zu Mut, wenn du hörst, dass Beteigeuze 8 Millionen Mal so groß ist wie unsere Sonne? Wo muss er im Weltraum stehn und was mag er rings um sich für Welten schauen, Räume, von denen unser Geist nichts ahnt!
Ich lese: Beteigeuze ist von der Erde 160 Lichtjahre entfernt. Was sagte das? Eines wissen wir sicher, dass nichts mit solcher Irrsinnsgeschwindigkeit rast wie das Licht! Nun, ein Lichtjahr, also der Raum, den das Licht in einem Jahr zurücklegt, ist 9 500 000 000 000 km, also: 9 ½ Billionen km!
Ein Lichtjahr! Und Beteigeuze ist 160 solcher Lichtjahre von uns entfernt! Warum redest du nicht, Bruder? Bist du plötzlich klein geworden? Du bist doch sonst so groß! Bist stolz auf deine Häuser – wie groß sind sie! Hast Gründe, wie weit sind sie! Hast Geld – und was nicht das Unwichtigste ist: – du vermagst ohne Gott zu leben!
Doch höre weiter: Der helle, leuchtende Stern dort im Skorpion ist Antares, er ist gar 350 Lichtjahre entfernt!
Aber nicht genug, lange nicht genug! Es gibt Sterne, deren Globularsystem so weit entfernt ist, dass ihr Licht 500 Jahre braucht, um den eigenen Sternenhaufen zu durchdringen und 200 000 Lichtjahre, um zu uns zu dringen.
Was ist dir? Fällt die Welt deiner Größe zusammen? Umwehen dich Schauer des Atems eines Wesens, an das zu glauben du nicht für nötig findest? O Bruder, wo ist nun deine Welt? ...
*
Ich habe heute auf meinem täglichen Nachmittagsspaziergang durch die Felder – den ich so lebensnotwendig brauche wie der sagenhafte Antäus die Berührung mit der Erde – von einem soeben umgebrochenen, noch schlafenden Acker eine Scholle Erde aufgehoben und sie lange betrachtet.
So sehr ich sie auch zerbröckelte und durch die Finger rieseln ließ, sie blieb braune, kalte Erde. Zum Schluss lag noch ein winziges Krümchen auf meinem Handteller.
Und dieses winzige Bröckchen Erde begann zu reden. Wieder waren es – seltsam! – dieselben Worte, mit denen gestern Nacht der Sternhimmel zu mir sprach: – Bruder, was ist groß, was ist klein? Sieh, so klein bin ich, dass du kaum je Zeit hast mich zu betrachten – und doch berge ich eine Welt von über 100 000 Kieselalgen in mir. Über 100 000 räder- und schiffchenartige Kieseltierchen bewegen sich, leben und sterben in mir, lauter herrlichste, weise und wundervoll gebaute Dome des Lebens, so schön, dass dein Gemüt ganz andächtig und still werden würde ob ihres Baues, könntest du sie sehen. Dein Fuß schreitet achtlos über mich und meine unzählbaren Wunder, und deine Seele ahnt nicht, dass du über ganze Sternenhimmel, ja Weltenräume schreitest!
Und doch – kannst du ergründen, wie ein einziges dieser hunderttausend, dem bloßen Auge unsichtbaren, Geschöpfe in meinem Leibe entsteht, was für eine Kunst in ihnen am Werke ist? Was weißt du und wissen all deine Brüder von dem, was das Leben ist! Von der heiligen Flamme, die ebenso feurig in der Alge loht wie im Stern da oben? Denn du wirst doch nicht glauben, dass diese Wunder der bestimmungslose Stoff vermag!
Und weißt du, dass kein einziges Getreidefeld fruchtschwer im Winde wellen, kein einziges Rind auf Wiesen weiden könnte, und dass ihr alle, trotz eurer Klugheit und Selbstherrlichkeit, kläglich vergehen müsstet wie Laub und Gras, wenn diese meine Kinder in meinem Leibe nicht wären, die allein die nur ihnen eigene Fähigkeit besitzen, den in der Luft befindlichen Stickstoff einzufangen und derart umzuwandeln, dass die heilige Mutter Erde, die du eben so sinnend in deiner Hand zerbröckeltest, die Nahrung schenken kann.
Sieh, so groß bist du, dass du einem Weltenriesen gleich über den Sternenhimmel unter deinen Füßen wuchtest!
Und doch so klein bist du, dass du ohne diese winzigen Pioniere nicht leben könntest!
Betrachte die Erde und schaue in ihr die Demut des Dienens!
Blicke hinauf zum Himmel und fühle seine alldurchströmende Liebe! Staune, schweige und sinne! Und lass beides dir erhabenes Vorbild sein.
*
Ich habe den ganzen Abend in der Weisheit des Lao Tse gelesen:
„Die lebende Kraft des Werdens ist unvergänglich,
Sie ist die unfassbare Mutter.
Die unfassbare Mutter ist Wurzel des Alls,
Stetig webend bedarf sie nicht des Antriebs.“
Ehe ich schlafen gehe, tue ich noch einige Schritte in sternklarer Nacht! Es lässt mir nicht Ruhe! Welten im Himmel und Welten im Erdenkörnchen! Und wir Menschen dazwischen! Wo ist die Grenze, wo das Ende? …
Meine Seele flackert wild im hohen Aufruhr wie ein Wachslicht, das im Winde steht!
Ich kenne den Wind, ahne den Hauch, der meine Seele durchschauert! Gott, lass mich bestehen vor Deinem Angesicht!
*
Strahlender Winterendtag! Ich bin nach dem Nachmittagskaffee den schönen Weg am Bach entlang durch die Au gegen Wörth zu gegangen. Gottvolle Stimmung! Die Au schneeweiß, die Nadelbäume dicke Wollmützen auf wie im tiefsten Winter. Dazu ganz leises tänzelndes Schneien, Totenstille, nur der Fluss sprudelnd und plaudernd, wenn auch gedämpfter als in Sommertagen. Im kahlen Geäst der Eichen – die, wo immer ich ihnen begegne, sofort die meisterhaften, nebelverhangenen Winterlandschaften Caspar David Friedrichs in mir erstehen lassen – ein wenig steif und melancholisch Krähen; am Ufer entlang ab und zu das Aufblitzen des exotisch schillernden Gefieders zweier Eisvögel.
Und unter dem Geäst der Bäume, heimlich unter Schnee und altem Laub versteckt, unzählige Schneerosen mit ihrem süßen, keuschen Duft. Ich gehe diesen Weg für mein Leben gern. Er gibt wie keiner Gelegenheit, mit seiner Seele spazieren zu gehen.
Doch nicht lange sollte mir heute dies Glück stiller Beschaulichkeit zuteilbleiben.
Ein halbwüchsiger Bub, mitten in der Stille der Au nach Schneerosen suchend. – Doch wie! Er stöberte und scharrte mit einem Stock, ohne sich die Mühe zu nehmen, sich zu den lieblichen Wundern niederzubeugen, und ohne Bedürfnis, das erste Lebendige des werdenden Frühlings mit Händen anzufassen! Mit Hast und Lieblosigkeit stocherte er unter den alten Bäumen herum, dass Schnee und dürres Laub – und leider auch so manche Knospe nur so flog!
Mir schnitt es tief in die Seele, dass dieses junge, noch nicht zerquälte Menschenreis schon so roh dem Leben gegenüberstand!
Denn solange Menschen dem Leben in welcher Form immer beziehungs- und ehrfurchtslos gegenüberstehen, werden sie auch den Frieden und das wahre Glück nicht finden
*
Ich habe heute etwas ganz Großes erlebt. Ich wachte früh um halb vier auf, was um diese Jahreszeit bei mir sonst nie vorkommt, wie von jemand gerufen und konnte lange nimmer einschlafen.
Meine Gedanken gingen seltsamerweise zu dem armseligen, jungen Pferdeknecht. Er lebt in unserem Ort, steht den ganzen Tag schwer in Arbeit, pflügt, führt Holz, schleppt Lasten. Jahrelang bin ich an dem Menschen vorbeigegangen, bis uns die reifgewordene Stunde zusammenführte. Und bis ich wieder einmal mit Beschämung erleben musste, wie oberflächlich, oder soll ich sagen: wie blind, unwissend wir leben, wie wenig wir die Seele unserer Mitmenschen erfühlen – und, sagen wir es ruhig: wie wenig wir uns Mühe geben sie zu erfassen! Dieser Mensch liest seit Jahren mit einem Lichthunger und Erkenntnisdrang, der so vielen unserer schulgebildeten Mitmenschen alle Ehre machen würde, die schwersten mystischen und philosophischen Bücher und trägt dauernd die Bibel bei sich.
Mit einem Mal trommelte es an mein Fenster. – Der Knecht! Er war so offensichtlich verstört, dass er ganz zu grüßen vergaß. Auf meinem Bettrand sitzend, erzählte er mir Folgendes: Er hätte sich gestern Abend, ganz gegen seine sonstige Gewohnheit, frühzeitig niedergelegt, da er ausnehmend müde gewesen und rasch eingeschlafen sei. Plötzlich wäre er aus dem Schlafe aufgefahren, aus dem ihn ein lautes, deutlich vernehmbares Singen geweckt habe. Er habe sich anfangs noch für träumend gehalten, sei aber, um sich der Wirklichkeit vollauf zu versichern – umso mehr als der Gesang, der aus einer der unteren großen Stoben zu dringen schien, unverkennbar wie ein Totenlied klang –, aufgestanden, hätte ein Zündholz angerissen und nach der Uhr gesehen, die fünf Minuten nach drei gezeigt, und wäre lauschend stehen geblieben. Da der Gesang aber plötzlich aufhörte und er nun deutlich die betende Stimme des Pfarrers vernommen, hätte es ihm keine Ruhe mehr gelassen, er sei die Treppe hinuntergestiegen, über den Flur auf die Tür zugegangen, durch die ganz deutlich das lateinische Totengebet drang. Kurz entschlossen habe er die Tür geöffnet, und er wäre beinah umgesunken, als er den Raum von Kerzen hell erleuchtet gefunden hätte, die um einen Sarg aufgestellt waren, in dem die Bäuerin lag, und davor der Pfarrer, der im schwarzen Ornat eben den Totensegen betete. Darüber wäre er so entsetzt gewesen, dass er sich nicht zu rühren vermocht; plötzlich sei ihm aber klar geworden, in welchem Aufzuge er vor den Leuten stehe, und er habe hierauf fluchtartig die Türe hinter sich zugerissen. Auf halber Treppe sei ihm aber durch den Kopf geschossen, dass man doch nie und nimmer mitten in der Nacht eine Leiche begrabe, wo doch die Bäuerin noch vor ein paar Stunden springlebendig gewesen, und so sei er entschlossen zurück und habe die Tür nochmals geöffnet. – Stockdunkel der Raum, kein Licht, kein Ton, kein Leichengeruch, und er wisse sich deutlich zu entsinnen, dass er denselben noch vor ein paar Augenblicken stark empfunden.
Das Ganze sei ihm so gruslig gewesen, dass er kein Auge mehr habe zutun können und bei Kerzenlicht den Anbruch des Morgens abgewartet habe.
Er hätte immerzu an mich gedacht und nun wäre er hier, er habe nicht anders gekonnt, und ich möge ihm sagen, was davon zu halten sei.
Ich sah seinen Augen an, welcher Wandel sich in seiner Seele zu vollziehen anfing und sagte ihm, dass er das zweite Gesicht zu bekommen, also hellsehend zu werden scheine.
Ich werde mein Lebtag nicht vergessen, was bei diesen Worten für eine Veränderung in dem Menschen vor sich ging.
So mögen die Antlitze der altjüdischen Propheten geleuchtet haben, als sie die Stimme der Berufung traf.
Ich gab ihm den Rat, von heute an womöglich kein Fleisch mehr zu essen, da die feinen kosmischen Ströme im Blute kreisen und dies durch Fleischgenuss verschlackt und dadurch leistungsungeeigneter gemacht würde.
Was sein seltsames „Gesicht“ betraf, bot ich ihm auf, zu keinem Menschen davon zu sprechen und gottergeben abzuwarten.
Ich habe den ganzen Morgen viel über den einfachen Menschen, seine seltsame Schau und seine Gabe im Besonderen nachgedacht.
So wird er nun leben, ein Auserwählter, ein Seher, ein Mensch, in dem die Seele die inneren Schleusen brach – und doch „nur“ ein Knecht, ein „arm-seliger“ Knecht!
Viele haben die Gabe, ohne sich über sie recht ins Klare zu kommen, andere geben sich ihr bewusst hin, hüten sie aber heimlich, um sich und das Hohe vor Zweifel und Spott zu bewahren, den die Menge dort immer wohlfeil zur Hand hat, wo sie, um mit Goethe zu reden, nicht „wägen und messen“ kann.
Und fast keiner ist unter allen Menschen – denn die Gabe liegt schlummernd in uns allen –, an dessen Ohr nicht irgendeinmal ein rätselhafter Ton, ein Ruf – unser Name, den „jemand“ rief, so deutlich, dass wir uns befremdet umwenden –, ein Schrei brach, vor dessen Auge nicht wenigstens einmal für Blitzeslänge etwas auftauchte aus der „anderen Welt“.
Ich erinnere mich, dass meine Großmutter mir und meinen Gespielen manchmal von ihrer Urgroßmutter erzählte, also meiner Urahne im 5. Glied, die zu ihr, als sie noch ein kleines Kind gewesen, oft gesagt hätte: „Kinder, ihr werdet sehen – ich werde es ja nicht mehr erleben –, es wird eine Zeit kommen, wo die Wagen auf der Straße fahren und es werden keine Pferde davor sein!“ Großmutter sagte dann noch, sie habe oft die Urahne gefragt, sie möge das doch genauer erzählen, wie das denn nur möglich sei, aber die Alte habe immer nur den Kopf geschüttelt und hartnäckig behauptet: „Was ich euch sage, ist wahr, ob ihr es glaubt oder nicht, denn ich sehe die Wagen deutlich vor mir! Sie sind anders als heutzutag. Vorn sitzt einer, der ein Rad in der Hand hat, an dem er dreht, und sie laufen auch viel schneller, aber wieso das geht, kann ich selbst nicht erklären.“
Die Urahne ist vor fast 70 Jahren schon in die Bauernerde meines Heimatdorfes gelegt worden; meine Großmutter aber hat die geheimnisvollen Wagen, die ohne Pferde fahren, noch erlebt und wenn sie sich auch nie auf so ein „Teufelszeug“ setzen mochte – die Jungen benutzen dankbar und selbstverständlich, was das hellsehende Auge der Urahne fast ein Jahrhundert im Voraus schaute.
Gibt das dem Besinnlichen nicht sehr zu denken?
Ein einfaches Bauernweib, das ihr Leben lang nicht aus dem Dorfe kam, „schaut“ eine grandiose technische Errungenschaft fast ein Jahrhundert vor ihrer Erfindung!
Wie ist das möglich?!
Zeigt, predigt das nicht, dass jeder menschliche Gedanke, jede Erfindung längst vorgedacht ist von dem großen, erhabenen Meister alles Lebens und dass diese Gedanken diejenigen in schauender oder ausführender Form aufzunehmen vermögen, die dazu bestimmt sind?
*
Was ist mir für eine Freude geworden! Über Nacht ist der zinnoberrote Kelch meines großen Kaktus aufgeblüht! Wie ein ornatgeschmückter Kardinal, der auf dem Weg ist, seine Messe zu zelebrieren, steht er unter all seinen anderen kleinen und großen Geschwistern im Kakteenfenster vor meinem Arbeitstisch. Und die aufgebrochene Blüte ist leise über die zierliche Elfenbeinpagode geneigt, in der Buddha regungslos in seiner Versenkung sitzt.
Seltsam, dass dieses Südlandskind Jahr um Jahr aufflammt, wenn draußen Eis und Schnee noch die Erde bedräuen.
Es ist früh am Morgen, noch dringt kein Laut von der Straße zu uns, wir sind allein, ganz allein, ich und die Blüte. Ich beuge mich nah zu ihr, mit angehaltenem Atem, und starre unverwandt in ihren weiten strahlenden Kelch, der vom schneeverstärkten Morgenlicht durchschimmert ist wie ein edles Glas und dessen Zackenblätter sich aufeinanderlegen, ganz so wie man es an den Lotosblättersockeln sieht, auf denen der Erhabene kauert. Und ich fühle mit einem Mal die pulsenden Lebensströme in dem lichtdurchdrungenen Zinnobertabernakel, und das alabasterweiße Staubgefäßbündel, das in rhythmischem Schwung mit seinen goldenen Narben aus dem Dämmer des Allerheiligsten quillt, wandelt sich mir in den Seelenstrom der Blüte selbst, an dessen Ende die goldenen Schalen des Gottesfunkens leuchten.
Meine Augen verklammern sich in das Mysterium, ich fühle, wie ein Strom von mir zur Blüte und von dieser hinwieder zu mir geht, und ich verfalle in einen tiefen Bann und vermag mich nicht aus ihm zu lösen, denn unwiderstehlich ist die Seligkeit der Stunde.
– – Dröhnend in seiner ganzen rohen Gewalt der Materie rasselt draußen das erste Lastauto durch die Straße. Und es schneidet ein Schmerz durch mich, dass ich für den Augenblick ganz benommen bin. Ich blicke nach der Mysterienblume. Regungslos und feierlich ruht sie, wie zuvor.
Doch so innig ich mich auch mühe – kein noch so wehender Hauch dringt mehr an meine Seele!
Da stehe ich, ein Mensch, so nahe dem Kelch der Blüte, ... ich spüre das Drängen der Seele in mir, doch kein Weg vom einen zum andern!
Mich überfällt grenzenlose Verlassenheit.
„O wie einsam ist der Mensch!“
Mein Auge gleitet von der Blüte weg zum Fenster hinaus, ruht auf einer Schar bunter Tauben, die auf dem Dreieck der Giebelabschrägung des Scheunendaches hocken, mit roten Füßen trippeln, sich das Gefieder durch die Schnäbel ziehen, einander nachgehen, sich ducken, und auf das Morgenfutter warten. Das Bild tröstet mich.
Ich werde, wie alle Morgen, von dem schönen Anblick gefangen, freue mich an dem blau-, grau- und violettschillernden Gefieder der Hälse, der Grazie der Bewegung, der Gravität ihres Schreitens, der gottseligen Unbekümmertheit ihres Abflugs in die Tiefe, schaue ihr Spiel, fühle ihr Leben und frage mich: „Was weißt du von ihnen! Von dem, was durch sie geht, was ihres Lebens Urlebendigstes ist? Keinem Hund, nicht einmal einem Käfer vermagst du dich im Innersten zu verbinden, du siehst nur die Hüllen!
Wie einsam ist doch der Mensch!“ – –
Der Mensch! ruft es hastig in mir ... Gott sei gedankt – ich bin nicht allein, nicht so grausig verlassen, wie es mir eben schien. Ich habe die Menschen, viel tausend Brüder und Schwestern, die mich verstehen und die ich verstehe, mit denen ich reden, lachen und scherzen, bei denen ich mir Trost holen kann!
... Verstehen? Ist denn das die ganze Welt des Menschen? Umfasst das sein ganzes Wesen? Ist dir dadurch wirklich sein Innerstes enthüllt und sonnenklar bis ins Letzte, Tiefste hinein? Ist noch nie irgendein heimlicher Gedanke in dir aufgestiegen, vor dem du selber erschrakst?
Haben wir nicht ganze Welten solch heimlicher, sorgsam gehüteter Gedanken in uns? Steigen sie nicht immerzu aus unserem Innersten, wie Blasen aus der dunkelsten Tiefe des Wassers? Und sind wir nicht in Wirklichkeit auch das, was wir nicht aussprechen? Was wir sorgfältig gehütet in uns tragen? ... Ist uns der Mensch wirklich in seinem Wesen um so vieles klarer als Pflanze oder Tier, nur weil er Laute spricht, die wir verstehen?
Mein Gott: Ja, ich lebe und bewege mich zwischen Menschen, sie sind mir Eltern, Weib, Freund, Kind, sie reden mit mir und doch, was weiß ich von ihnen?
Ich grüße seit Jahren einen Menschen und weiß nicht, dass er mich heimlich hasst und längst verleumdet hat; ich gehe achtlos an einem anderen vorbei und spüre nichts davon, dass er mich in der Stille liebt; ich sitze neben einem dritten und fühle nicht, dass die Not ihm bis zur Kehle steht, ahne nicht, dass er meine Hilfe braucht als letzten Halt. Du sorgst dich und betest für dein Kind und weißt nicht, dass es längst auf Abwegen irrt; du siehst deinen Vater lachen und bist ahnungslos, dass ihn und dich das Gespenst verfehlter Spekulationen zu verschlingen droht!
Soll ich dir noch weiter sagen, wie sehr du den Menschen „verstehst“? ... Dir weiter zeigen, dass es hier Mauern gibt, die alle Sehnsucht nicht zu überwinden vermag?
Und willst du das Grausigste hören? Dies: – dass der Mensch sich selber nicht kennt!
Sind noch nie Gedanken in deinem so geregelten Leben aufgetaucht, die wie Räuber in dir stehen?
Hast du noch nie erlebt, dass ein Mensch, der viele Jahrzehnte redlich lebte, plötzlich zum Dieb oder Mörder wurde?
Ich weiß, was jetzt durch dich zieht, was dich frierend quält! Es ist das beklemmende Wissen um die grenzenlose Einsamkeit des Menschen. Des Menschen, von dem sie alle sagen, dass er der Herr der Schöpfung wäre!