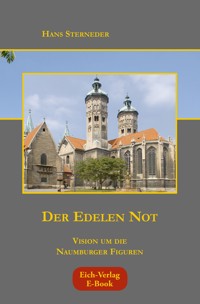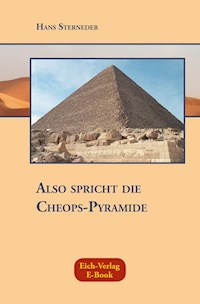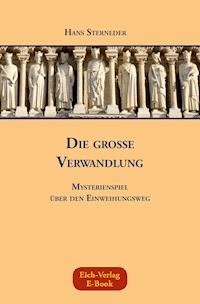12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eich, Thomas
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der zweite Teil von Hans Sterneders Tagebuch eines Besinnlichen steht dem ersten Band „Frühling im Dorf“ in nichts nach. Wieder ist es geprägt durch eine bunte Vielfalt tiefsinniger Gedanken, wieder stehen kleine Alltagsbegebenheiten neben allumspannenden Gedankengängen über Mikrokosmos und Makrokosmos. Und alles immer aus dem weisen Blick des Geistmenschen, der in allem einen tieferen Sinn erschaut und das Leben über die Maßen liebt. Nanda Herbermann schrieb 1931 in der katholischen Kulturzeitschrift „Der Gral“: „Das ist eines von jenen Büchern, die man nicht mehr aus der Hand legen möchte, bis man es durchgelesen hat. In ihm vereinigen sich scharfer Geist, eine kritische Beobachtungsgabe, ein mitfühlendes Herz und ein köstliches Gemüt. Noch mehr als im ‚Frühling im Dorf‘ erreicht hier der Dichter eine geistige sowie künstlerische Höhe, die über die Erde mit ihren tausend Schönheiten, mit ihren Menschen, Pflanzen, Tieren hinaufführt in das Reich des Geistes, wo vom Materialismus unserer Tage gar nichts mehr zu spüren ist, wo Gott ist und Ewigkeit.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Hans Sterneder
Sommer im Dorf
Tagebuch eines Besinnlichen
Eich-Verlag
Bitte respektieren Sie das Urheberrecht. Sie dürfen dieses E-Book
nicht kopieren, verbreiten, reproduzieren oder zum Verkauf anbieten.
Das betrifft sowohl kommerzielle als auch nicht-kommerzielle Zwecke.
Danke für Ihr Verständnis.
1. E-Book-Auflage 2019
© Thomas Eich-Verlag, Werlenbach 2011
Alle Rechte vorbehalten
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Umschlagfotos: © momanuma – Fotolia.com / FotoMaxl2 – Fotolia.com
Umschlaggestaltung, Satz und Datenkonvertierung E-Book: Thomas Eich
Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.eich-verlag.de
ISBN 978-3-940964-53-3
INHALT
Sommernacht-Mysterium
Rosen-Wunder
Das Pentagramm im Bergbauernhof
Das Geheimnis des Pentagramms
Der Segen des Barfußgehens
In der Wiese
Dschuang-Dsi's Schmetterlingslegende
Ein Wunsch
Abendbrot unterm Nussbaum
Morgengebet der Kreatur
König Salomos Morgenpsalm
Morgenglocken-Läuten
Schweizer Treue
Sonnabend
Die alte Eiche
Ameisen-Predigt
Kugelschreiben mit den Dorfbuben
Der kosmisch-planetarische Rhythmus im Menschenleben
Über die heimlich klagenden Seelen
Über das Buch Hiob
Amsel und Wurm
Das Korn blüht: Das kosmische Geheimnis des Weizens
Jugend, zu dir will ich reden
Die Ahnungslosigkeit der Jugend dem heiligen Eros gegenüber
Die Jugend fragt: Was sollen wir tun?
Wahre Menschwerdung in der Ehe
Das brütende Rotschwänzchen
Die Heilighaltung des keimenden Lebens in der Natur
... Und du, o Mensch?
Menschen, lernt die Ehrfurcht des Tieres vor dem tragenden Schoß
Der Brief der Nonne aus Jerusalem
Der Blondkopf ist da!
Der Zeitbegriff bei den Pflanzen
Sonnabend-Behagen im Dorf
Nachtgedanken vor Trinitatis
Der kosmische Sinn des Dreifaltigkeits-Festes
Mein Urgroßvater, der Schäfer
Die kleine Amazone
Die vier Ur-Handwerke
Regenvorgefühl der Tiere
Newtons Gottesehrfurcht
Es regnet, es regnet!
Das Ur-Licht, der kosmische Telegrafenmeister
Phlox
Die Wiesenmahd ist nah
Die Pflanzen als Aufspeicherer der Sonnenenergie
Wann soll man Gemüse schneiden?
Vorbereitungen im Dorf für das Fronleichnamsfest
Die Liebe Christi, die höchste Religion aller Religionen
Wie sah Christus aus?
Christus und keine Christen!
Mein Freund, der alte Scherenschleifer
Ein Wort aus den Upanishaden
Kaushitakis Sonnengruß
Der flammende Admiral
Der heilige Dominikus
Die Vision beim Uhrmacher: Das Wunder des Stäubchens
Das Stäubchen, ein Weltall!
Die Linden blühen
Sommer-Sonnwend-Morgen
Geistertage um Sonnenwend
Sonnwendfeuer
Das kosmische Geheimnis der Sonnwendnacht und ihre christliche Feier im Johannistag
Der altägyptische Sonnen-Hymnus
Johanniskraut-Pflücken
Taubenfeder
Glühwürmchen-Nacht
Die Einstellung der Menschen zu ihren geistigen Führern
Wiesenmahd: Über das Schmerzgefühl der Pflanzen
Bettina von Arnim über die Bienen
... Sie haben Augen und sehen nicht!
Die schwangere Tagelöhnerin
Siebenschläfertag
... Wenn das Huhn wüsste!
Hühner-Ei und Gebirgsbildung
Die Vogellieder sind verstummt
Staat, wie steht es mit deiner Tierliebe?
Auf dem Leiterwagen über Land
Seuses königliche Quintessenz
Die Seele Chinas redet zu mir
Fünf junge Schwälbchen im Nest
... Und der Sommer wächst!
Das geheimnisvolle Wesen der Sonne
Das Wunder der Welten-Lotos
Die Sonne als Mutter und Kind
Die Atmung der Sonne
Der Landstreicher am Wegkreuz
Die Ursache und das Geheimnis der Sonnenflecken
Eine Analogie zwischen Sonne und Weib?
Sommerstille
Im Steinbruch
Von der Gnade des Schweigens
Abendgang durch die Flur
Gießen meines Gartens
Die große Bedeutung der Farben für die Entwicklung des Menschen
Das schönste Schmetterlingsbuch
Castellamare
Weißt du, wie viel Sternlein stehen?
Das Firmament, der Leib Gottes
Die Zahl 432 als Weltenangel
Bericht des Mount Wilson-Observatoriums
Lavendelsingen
Ein Wort Hans Thoma's
... Seele, wo bist du?
Die geheimnisvollen geistigen Kräfte im Pflanzenreich
Gruppen-Geister und Ordnungs-Wesen im Pflanzenreich
Das Gemüse, der mysteriöse Schlüssel im Pflanzenreich
Peryt Shou
Über das Essen
Das brennende Zündholz
Die alte Steinbrücke
Der alte Drechslermeister und seine Bibel
Hirsche auf dem Gahns-Gebirge
Das Gewitter
Der Mythos des Blitzes
Die Dämonen der Tiefe: die Wasseradern
Bei meinem Freund in der Lüneburger Heide
Warum die Mondfahrt unmöglich ist
Vor der Ernte
Schwemmreiten
Kornschnitt
Gott segnet das Brot
Aus der Herrgotts-Apotheke
Pflanzen-Essenz und Pendel
Zwei Lichtanbeter
Alpenglühen
Lil Dagover
Sonnenblume
Ernte-Einfuhr
Unserer lieben Frau Kräuterweihe
Mein lieber Leser, ich bitte dich, spring in diesem Buch nicht kreuz und quer wie ein munteres Zicklein durch die Wiese, sondern geh Schritt für Schritt durch dasselbe. Denn so wie der Sommer draußen ein organisch Wachsendes ist, ebenso ist auch dieses Buch gebaut – trotz seiner scheinbar losen Form – und ein streng organisches Ganzes, wie im Sommer ein Tag in den anderen greift, der Abend nicht vor dem Morgen kommt, die Blüte nicht vor der Knospe, das Vöglein nicht vor der Liebe der brütenden Vogelmutter.
Sei gegrüßt von mir aus meinem stillen, österreichischen Gebirgsdorf!
Gloggnitz am Semmering Hans Sterneder
Im Garten ist es atemstill.
Ich bin aus meinem Arbeitszimmer hinausgegangen in die laue Sommernacht; es hat mich etwas drinnen gesucht und gefunden und hinausgeholt, nein, hinausgezogen, hinausgedrängt, und nun stehe ich mitten zwischen meinen vielen Rosen und bin ganz Lauschen, ganz Hingabe.
Hingabe an etwas, das ich nicht sehe, das ich nicht höre und das doch voll einer Lebendigkeit um mich ist, dass ich begreife, dass es mich drinnen in der Stube treffen und zwingen konnte, und das mich nun bis in das Innerste meines Seins durchdringt. Das fühlbarlich sich auf den ganzen Körper schmiegt, durch jede Pore in das Inwendigste meines Wesens will und das so stark wird, dass mir wie einem Mädchen zumut ist, auf dem die heißen Blicke des zärtlich Geliebten ruhn.
Ich spüre, es wellt mir entgegen von jedem Baum, jedem Strauch, von jeder hauchenden Rose, jeder atmenden Blüte in den Beeten; jedem Käferchen – ja, mir ist, es strömt von der Erde, von jeder Scholle und es rieselt aus der Luft.
Und ich hebe den Kopf und schaue in den funkelnden Sternenhimmel, der prangend über mir steht in schier sinnverwirrender Überfülle, und mir ist es, als flösse dieses unsichtbare Etwas von all den Himmelsblüten und -knospen glitzernd nieder zur Erde, herein in meinen regungslosen Garten, nieder auf mich. Und mir wird plötzlich mit Erschauern bewusst, dass eine ganze Erde und ein ganzer, noch millionenfach gewaltigerer Himmel mich mit diesem seinem geheimnisvollen, urgewaltigen Etwas umfangen halten, es auf mich strömen, immerzu, immerzu – und es wird mit einem Mal unertragbar für mich – Gott, wie soll ich auch eine Erde und einen ganzen Himmel tragen! – Mir schwindelt vor den Augen, und ich muss die Lider schließen. Und ich erkenne, dass hier Wehren, Sich-Schließen Wahnsinn wäre, dass ich erdrückt werden müsste von der unaufhaltsamen, unentrinnbaren Urgewalt, die hier aus Erde und Himmel bricht, und ich folge mehr mechanisch, ohne Gedanken, einem Müssen und reiße meine Brust auf, sprenge jede Faser meines Leibes, öffne jedes Blutkörperchen und gebe so diesem unsichtbaren, unhörbaren und doch so gegenwärtigen Etwas Millionen Eintrittspforten in mein Sein und spüre, wie es in mich flutet, und ich verliere immer mehr meine geschlossene Ichheit und werde selber immer mehr zu dem, was da auf mich zukommt, um mich ist, durch mich schießt.
Und mit einem Mal wird es gegenständlich, gewinnt Festigkeit, wird Geruch, und nun ist es erkennbar und wellt um mich so betörend wie der quellende, süße Duft des aufblühenden Leibes eines jungen, liebesdrangvollen Erdenweibes. Und ich erlebe mit Schauern und Andacht dieses Letzte, Höchste auf allen Flecken und an allen Enden der Erde und der Gestirne in allen Weltenräumen: diese unbezwingbare Sehnsucht im ganzen Weltenrund: – Liebe, Liebe, Liebe!
Und ich schaue mit bebender Ehrfurcht, dass es nichts Höheres gibt als diese jauchzende Hingabe des eigenen Seins, um das Leben weitertragen zu dürfen, das durch Äonen rinnt.
Und ich schaue, wie Erdenmädchen und -frauen in diesen Nächten der hohen Sonne eins werden in ihrem großen, göttlichen Urdrang mit den Müttern alles Getiers, der Wonne jedes Blütenkelches, der Lust jedes Gestirns.
Und wie noch nie fühle ich weltenstark in dieser hohen Nacht die große Allmutterschaft, den ewig uralten Liebesdrang, seinen Leib aufopfern zu dürfen dem heiligen Leben!
Und ich muss etwas tun und nehme eine Rose ehrfürchtig zwischen meine beiden Hände; und wie ich mich niederbeuge auf die Blüte, diesen heiligen Schoß einer großen Sehnsucht, und den jungen, starken Duft in mich sauge, sehe ich unten im goldenen Schrein, der die Verwandlung des ewigen Lebens vollzieht, eine große, leise im Sternenlicht aufblinkende Tauperle. Da überwältigt es mich so stark, dass es wie ein Schluchzen in meine Kehle steigt.
Ich sinke zur Erde und ziehe mit beiden Händen Nelken, Levkojen und Reseda an meine Brust, und ihre Kelche sind feucht vor Liebe und Hingabe. Und ich wende mich zu anderen Schwestern, und ihr Duft ist verhaltener, herber, denn schon tragen sie in ihrem Schoß das Wissen der Mütter.
Und ich finde einen großen Käfer mit funkelndem, opalisierendem Rücken, und sein Schild glänzt zwiefach, denn er ist feucht.
Da biege ich rasch all die zierlichen, atmenden, feinste Öle verströmenden Leiber auseinander und dränge meine Hände ungestüm zur Erde – und die Erde war feucht vom göttlichen Samen des Taus!
Und in dem Augenblick, als meine Fingerspitzen den lauwarmen Leib der großen Mutter berührten, fuhr das Erleben des Mysteriums dieser Stunde wie eine wilde Schau in mich.
Wie lange ich in dem gewaltigen Bann dieser Nacht verweilt, ich weiß es nicht.
Ich habe wohl den Kopf gehoben; vielleicht wollte meine Seele den Großen, Gütigen treffen, der hinter diesem allgewaltigen Gesetze stand mit Seinem weisen Willen.
Ich sah's wohl nicht gleich, es wurde mir wohl nicht gleich bewusst, dass ein Neues, Rätselhaftes um mich war. Aber nun wurde es deutlich, hinten, im Rosengarten, zwischen den hohen Stämmen und den breiten Kronen der Obstbäume.
War die Sehnsucht und Hingabe der Stunde so groß, dass die Sterne zur Erde niederstiegen?
Das konnte nicht sein! Es müsste ja donnern und toben. Die Erde müsste in Brand stehen! ... Stand sie nicht auch in Brand? Ja, doch – aber dies war ein Anderes!
Und ich sah, dass die magisch schwebenden Sternchen friedlich waren und voll eines ganz anderen, milderen Lichtes, als die in Weißglut sich verzehrenden Schwestern oben am überhellten Firmament.
Seltsam grünlichblau und so weich wie ein Märchentraum war ihr Schimmern, und so wie ihr Licht, war ihre Bahn. Und ich achtete auf diese Bahnen und fand sie unsäglich glückhaft, weil sie dieses in Gänze in sich hatten, was die Sterne dort oben nimmer kennen, deren Schritt schwer und gemessen ist von der Last und Bürde all der unendlichen Not, Sehnsucht und Liebe, die über ihr großes, flutendes Herz strömt: – entbundene Sorglosigkeit.
Ich gehe zagenden Schritts durch die Beete und nähere mich fast scheu. Und ich gebe mich lange hin diesem seligen, jeder Schwere entrückten Schweben, das keinen anderen Sinn zu haben scheint, als in Gänze nur das zu sein, was all die schimmernden, flimmernden Lichtbahnen weisen: – Schweben!
Und ich stehe und staune. Und durch mein Hingegebensein zieht der Gedanke: vielleicht erträgt die Erde all die namenlose Lust ihrer Geschöpfe nimmer, vielleicht bin ich ein Begnadeter, der erleben darf, wie die nimmer zu haltenden Brände ihrer eigenen Liebessehnsucht aus ihrem Herzen steigen!
Und weil der Gedanke zu groß ist, als dass ihn eine Menschenseele ertrüge, hilft Gottes Stimme in mir: Die Schemenwelt, das Reich des Astralen hat sich aufgetan, anzubeten in überirdischen Tempeltänzen das Mysterium der großen Wandlung, die auf aller Erde geschieht.
Und der Gedanke ist glückhaft und befreiend, und ich gebe mich ganz hin dem Geheimnis dieser Nächte, dessen sichtbarlicher Ausdruck diese magischen Flämmchen mir irgendwie sind.
Da, mit einem Male, flammt es unten im Grase auf, so heiß, so ungestüm und stark, so voll einer übermächtigen Sehnsucht, eines wilden Verlangens, wie es all die tanzenden Lichtlein oben nicht zu äußern vermögen! Ich weiß es sofort: oben ist Spiel, oben ist Selbstzweck, hier unten im kühlen, feuchten Grase aber, das unirdisch erhellt wurde in seinem Dunkel von einem rätselhaft fahlgrünen Schimmer, der Halme und Schäfte aus dem Schweigen der Nacht hob, so dass eine ganze Lichtglocke, ein Tempel sich bildete – hier unten ist Ruh, ist Ungestüm des Dienens, ist der Fanatismus des Opfers!
Ich kann meinen Blick nicht wenden, er ist gebannt an diesen Kelch, der aufbrach mit großer Macht.
Und wieder raunt die Stimme leise, kaum vernehmlich durch mich: O sieh das Mysterium!
Und während die Worte verzittern, löst sich ein Licht aus dem Reigen der Funken und senkt sich in ekstatischen Drehungen, wie ein Tänzer, der voll ist vom Rausche der Gottheit, nieder zur sehnsüchtig harrenden Ampel.
Und ich schaue den letzten Sinn der Welt, die Urangel des Seins – wie Zweiheit Eins wird! Einheit die besiegte Erde in den Himmel reißt!
Und während mir diese Offenbarung wird, erlischt das groß gewordene Liebesfanal und in Starre und Staunen gefangen haftet mein Auge auf der Stelle, die eben noch flammte. Und um mich strömen die Rosen, duften tausend glutende, feuchte Kelche, die voll sind bis zum Rande von bräutlicher Sehnsucht, wellt es mir wiederum machtvoll entgegen von jedem Baum, aus jedem Vogelgefieder, von der Erde.
Und ich erlebe in diesen keusch verlöschenden Funken: Die ganze Welt, alle Himmel und Erden sind ein einziger Schoß, ein einziger harrender, tragender Schoß, überströmend vor Liebeshingabe und Mutterglück!
Und ich schleiche ganz klein in meine Stube. Und sitze hier, durchschauert bis in die Urklüfte meines Seins, denn ich weiß: Draußen steht über jedem lohenden Kelch, jedem lebenden Tier, jedem liebenden Menschen der große, gewaltige Gott mit seinem feinsten, verklärtesten Lächeln.
*
Ich kann keine Ruhe finden in diesen Tagen. Mein Gott, was sind das für Tage! Mein Gott, was sind das für Nächte!
Der Ewige ist auf die Erde gestiegen in Myriaden Gestalten und die Menschen sehen es nicht!
Sie sehen nicht, dass die Erde anders gelockert ist in ihrer Struktur, sehen nicht, dass das Wasser des Baches anders nach den Ufern greift und sie netzt und die Luft voll ist von jenem Drang, der so stark und verwirrend in ihr wogt.
Sie sehen nur blühende Blumen und lebensprühendes Getier. Doch wenn ich in der Wiese liege, sehe ich das Begehren all der Blüten, das so stark nach dem Golde der Pollen ist, dass es die Bienen im Fluge irr macht und verreißt und die Schmetterlinge manchmal emporwirft von einem Kelch, als bliese sie ein heißer Odem in die Luft; ich sehe das Gebaren der Vögel, die plötzlich das Insekt oder den Halm aus dem Schnabel loslassen und überfallen werden wie von einem Krampf, der sie durchstößt.
Doch das seltsamste sind die Rosen!
Die Rosen scheinen am meisten erfasst von dieser heimlichen Glut. Diese Liebeskraft! – es ist unaussprechbar! Stundenlang stehe ich eingewurzelt und kann den Blick nicht wenden von dem Wunder ihrer Weibwerdung.
Wie junge, starke, blonde Frauen sind sie, deren gesunde, frische Leiber plötzlich ganz anders sich dehnen und von denen ein Duft weggeht, der vorher nicht an ihnen war.
Und während ich ganz in das Blütenwunder versunken bin, haben sich heimlich Worte in mir aufgestellt, so wie die Geliebte uns unauffällig einen Strauß duftender Blumen auf den Arbeitstisch stellt, und meine Seele nimmt Blume um Blume des großen persischen Weisen und Dichters Dschelalledin und fügt sie liebevoll zu leuchtendem Rund:
Heute ist das Fest der Freude;
dieses Jahr ist Jahr der Rose!
Huldreich ist für uns der Himmel;
sei er's immerdar der Rose!
Höh'rer Welt entsprießt die Rose,
dieser Welt gehört sie nimmer:
Wie in ihr, die nur kann träumen,
würd' das Traumbild wahr der Rose?
Und während der Duft dieser Worte durch meine Seele zieht, erschließt sich mir sanft wie ein gleitendes Hochsommerwölkchen der tiefe Sinn des Liedes und das Rosengeheimnis. Und ich weiß nicht, ob es meine Seele oder der Geist der Rose ist, die in mir raunen: „Siehe meinen Stamm, sieh meine Krone! Holzig sind sie und hart wie der Leib eines kämpfenden, ringenden Menschen. Sieh meine Blätter: fest sind sie und herb, wie das zäh errungene und trotzig gehaltene Wissen eines Lebens.
Aber zwischen Zweigen und Blättern: – Dornen, immerzu Dornen. Weißt du, was diese Dornen sind? ... Das bittere Leid und all die Not der Erfahrungen eines heißen Strebens!
Aber Bruder, wer strebt, wer nicht da ist wie alle meine Tausende lieblicher Geschwister im Gras, um seiner selbst willen – sondern wer strebt in Leid und Rastlosigkeit aus dem hoffenden Glauben heraus, dass über der bloßen Freude des Lebens ein Höheres sein muss, siehe, dem geschieht es eines Tages wie uns, dass aus hartem Holz und Dorn die Lichtsehnsucht seines Geistes bricht. Verschlossen sind dem Knospendrang noch die Wunder des Kommenden, aber ein himmlisches Ahnen bricht durch das erste, scheue Tastendes Seele und rieselt in heftigen Glücksschauern durch den gestählten Leib. Der aber, den die Seligkeit einer höheren Welt traf, kann nimmer Einhalt tun auf seinem Weg und wenn sein Leib mit Narben überdeckt wird! Hast du die fünf langen, feinziselierten Zacken des Kelches gesehen? Liegen sie nicht wie eine Krone um das Lichthaupt der Knospe? Siehe, so legt sich jedem deiner Menschenbrüder eine edle, noch viel tausendmal glanzvollere Krone ums Haupt, sobald er zum Bejaher des höheren, geistigen Lichtes wird!
Und ich schaue erschrocken von der Knospe weg zur aufgebrochenen Blüte, die über ihr auf steilem, über und über mit Dornen bedecktem Holze steht, sieghaft und leuchtend in blutendstem Rot, durch das die warmen, gleißenden Strahlen der Sonne fluten wie durch Rubin eines edlen Glases. Und während ich ganz benommen bin von dem tiefen Geheimnis des mönchisch herben Rosenstrauches, dessen dornenumstandenes Haupt eine einzige sieghafte Verklärung ist von Reinheit, Überwindung und Glanz, und während ich wie berauscht die Durchgeistigung jedes seiner Blütenblätter schaue und der wundersamen Vermählung von erdentwundenem Geist und Himmel mich ganz hingebe, wandeln sich mir dunkler Stamm und unirdisch durchglühte Rose und ich schaue das Mirakel des durch den göttlichen Geist königlicher Überwindung Herr des Lebens gewordenen Menschen. Und während ich im Grunde des immer mehr vom Gott-Geist der Sonne durchglühten Rosenhauptes das aufleuchtende Gold der heimlich gehüteten Meisterschaft schaue, lösen sich unwillkürlich die Worte des uralten, tiefbedeutungsvollen Rosenkreuzergusses von meinem Munde:
„Mögen die Rosen auf deinem Kreuze blühen!“ –
Lange sann ich, von Schau und Wort ganz erfüllt, in das urtiefe Symbol des letzten Menschheitssinnes hinein. Mir war im Herzen seltsam schwer und beklommen, denn ich kenne die Menschen und kenne den Weg!
Und ich sehe plötzlich statt des Rosenstocks einen nackten Menschen, die Beine weit gespreitet auf der Erde, die Arme ebenso weit gereckt zum Himmel, das Haupt in den Nacken geworfen in ekstatischer Verzückung: – das große, heilige Pentagramm, den Menschen, der Erde und Himmel bewusst in sich vermählt, den Geistmenschen, den voll tiefster Seinserkenntnis in steter Harmonie lebenden – Gottmenschen!
Wie lange ich in dieser Schau gestanden, weiß ich nicht. Ich weiß nur:
An diesem Tage habe ich keine Rose zu brechen gewagt.
*
Nach dem Abendbrot: Heute habe ich hoch oben in den Bergen etwas gesehen, das mich unablässig beschäftigt.
Ich war auf dem Sonnwendstein, dem die Talbewohner dereinst, vielleicht schon in germanischen Vortagen, diesen Namen gegeben, da sie sahen, dass die immer schwächer werdende Wintersonne genau hinter dem Gipfel dieses Berges das große Mysterium ihres Sterbens und Auferstehens in den zwölf heiligen Raunächten vollzog.
Der Tag war so heiß, dass mir beim Abstieg im flachen Waldstück – dort, wo die schöne Kapelle steht, die in mir, so oft ich sie sehe, das liebliche Bild des im Schatten rastenden Bauernmädchens von Moritz von Schwind wachruft – ordentliche Backofenwellen vom Boden entgegenschlugen. So trieb mich denn der ausgetrocknete Gaumen beim ersten der Gehöfte, die hier seitab des Bergdorfes Raach im Walde liegen, zwischen Schafen, Hühnern und schmutzüberkrusteten Schweinen der Haustür zu. Die Bäuerin, ein noch junges, handfestes Weib, schaffte am offenen Feuerherd, von den hellen Flammen köstlich umtanzt.
Während sie mir einen Trunk Wasser vom Brunnen holte, fiel mein Blick durch die offene Tür in die Schlafstube – und dort sah ich „es“!
Schwerfällig und groß war es mit dickem Kreidestrich über das ganze Kopfende des einen Ehebettes gemalt: – das Pentagramm! Der hochmagische, heilige Fünfstern!
Ich muss sagen, dass es mich seltsam durchfuhr.
Vor kaum zwei Tagen die geistige Schau bei der tiefen Betrachtung meiner Rosenstöcke – und nun stand es vor mir, körperhaft und hell herausleuchtend aus dem ersten Dämmer der Schlafstube. Ich war derart gepackt von diesem mir so unerwartet sichtbarlichen Entgegentreten jener Gedanken, dass ich das Zurückkommen der Frau ganz überhörte.
Aus der Verlegenheit, mit der sie mir das Glas reichte, sah ich, wie zuwider es ihr war, dass ich dieses heimliche, heidnische Zeichen in ihrem christlichen Hause gesehen hatte.
Und so wies ich denn kurz entschlossen darauf hin und sagte: „Das ist klug von Ihrem Mann, dass er den Drudenfuß auf sein Bett machte!“
Da merkte das Weib, woran es mit mir war, ein Wort gab das andere, und bald hatte sie mir erzählt, dass ihr Mann seit dem Frühjahr Nacht um Nacht arg von der Drud, dem unheimlichen Nachtmahr, geplagt worden sei, denn die habe sich so schwer auf seine Brust gehockt und, wie der Bauer sich einbilde, von ihm gesogen, dass ihm jedes Mal der Atem ausgegangen sei. Da ihr Mann aber in den besten Jahren wäre, gesund, und nichts trinke, so habe sie sich doch zur Ansicht der alten Base bekehren lassen und ihm den Drudenfuß auf das Bettholz gezeichnet. Umso mehr, als auch der Großvater ihr in der Kindheit oft davon erzählt hätte.
Eigentümlich sei immerhin, dass ihr Mann wie durch ein Wunder schon die erste Nacht darauf Ruhe gehabt hätte.
Und da sie nun einmal warm geworden und es ihr förmlich eine Erlösung war, dass ein studierter Mensch so ernst mit ihr über ihre Hexerei sprach und ihr sogar noch riet, mit Wacholder zu räuchern, rückte sie mir denn auch ganz treuherzig mit den Worten an den Leib, sie sähe wohl, dass die Base und ich recht hätten, denn der schreckliche Hockauf bliebe seither weg, aber sie könne es absolut nicht verstehen, wie das die fünf Kreidestriche vermöchten, die obendrein doch nur ein so dummes Weib gemacht habe – das sei ihr alles ein vollkommenes Rätsel.
Da stand ich vor einer schweren Aufgabe, und da ich wenigstens im Augenblick nicht wusste, wie ich es dem Weib verständlich machen sollte, erzählte ich ihm von uralten Zeiten und dass es ein großes Geheimnis wäre, welches aber die Priester alter Völker, wie der Chinesen, Inder, Ägypter, wohl gekannt; und ob sie es glaube oder nicht, so liege die gewaltige Kraft des Zeichens über die bösen Geister nicht in drei, fünf oder neun Strichen, sondern darin, wie diese zusammengefügt seien.
Und es gelang mir, das Um und Auf, das eben gerade in der Linienführung dieses Fünfsterns liege, so gruselig zu bringen, dass die Augen des Weibes ganz groß wurden. Ich tat dies mit Absicht, denn ich war glücklich, dem heiligen Pentagramm noch als lebendigen Besitz in diesem waldverborgenen Bauernhof begegnet zu sein, und ich wollte, dass das Wissen darum nicht nur nicht erlösche, sondern in neu erstehender Frische durch das weltvergessene Bergdorf raune.
Den ganzen Heimweg aber ließ mich das seltsame Erlebnis nicht los, und ich musste immerzu nachsinnen, welch ein Abgrund doch war zwischen diesen primitiven Bergbauersleuten und jenen gewaltigen Sehern längst versunkener Jahrtausende, die in tiefstem, kosmischen Erkennen das heilige Urzeichen fanden und zum ersten Mal mit zuckender Hand wohl auf goldene Tafel rissen.
Wer wohl der Erste gewesen, der die Erde an den Himmel band? Den Himmel herunterzwang mit gewaltiger, unerschrockener Faust zur Erde? Ob es ein Chinese war, ein Chaldäer, ein Antlantier? ... Ob die Erde nicht bebte und durch die ganze Menschheit nicht ein heftiger Schlag ging, als dieses hohe Zeichen zum ersten Mal von Menschenhand hingeworfen wurde! Dieses gewaltige Gott-Zeichen, dieses mächtige, königliche Siegel, das den Weg wies der Menschheit und aller Kreatur, so dass alles Gespenst und unheimliche Gewese des Niedren-Astralen davor erstarren und in die Finsternis weichen musste, was sich nicht auf dem Pfade des das ganze All durchdringenden Fünfsterns befand.
Und ich sah hohe, königliche Priester aller Völker und aller Zeiten, sah Weihrauchdurchwallte Tempel mit funkelndem Goldgeschmeid; sah Magier mit glutfiebernden Augen machtvoll an das Tor des Himmels hämmern, nicht fürchtend die Gewalt Gottes, gemessen an ihrer Nichtigkeit, die sie jedoch sieghaft erkannten, da ihre Brust voll war von der heiligen Lohe des Suchens nach IHM; ich sah Faust, Nostradamus, Paracelsus – sah Schatzgräber und Gelichter niederster Gesinnung, das sich dreist des göttlichen Zeichens zu bedienen wagte im Kampf gegen die Dämonen, die ihre unlautere Absicht selber rief.
Und vor mir stand der prunkvolle Bibliotheksraum meines Berliner Gastfreundes und auf seinem Renaissance-Schreibtisch funkelte in prachtvoller Arbeit das lebensprühende Pentagramm: – erloschen, gestorben und tot. Ein Ding, ein kurioses Pentakel aus dem Mittelalter, „in welchem es noch von absonderlichstem Aberglauben wimmelte“.
Königlicher Tempel vor Jahrtausenden, kluger Mann in kluger „aufgeklärter“ Welt, und schwerfälliges Bergbauernhirn – o Zeit, o Weg!
Und doch und doch: – Wie war ich glücklich, dem tiefen, gewaltigen Erkennen lichtvoller Jahrtausende im Kreisen der Äonen wiederzubegegnen! Zu begegnen, wenn auch nicht dem königlichen Wissen, so doch dem lebenden, von der ewig unverdorbenen, großen Mutter Natur heimlich durch die Täler und die Kindergemüter getragenen Pentagramm!
*
Und wieder hocken die Tauben wie alle Morgen auf dem Dach, trippeln, ziehen die schillernden Federn durch die Schnäbel und harren auf das Futter; die große Esche steht regungslos hinter dem Giebel und badet ihr zerfittetes Blattwerk in den warmen Strahlen der Morgensonne – alles ist frisch und voll Tatendrang und auch mich reißt es an solchem Tag nur so zu meinem Werk, aber ich kann heute nicht arbeiten, ich bin zu erfüllt von den gestrigen Gedanken und ich weiß, ich habe nicht eher Ruh, bevor ich sie mir nicht von der Seele geschrieben habe.
So lass dich denn ehrfürchtig aufzeichnen, du heilig gewaltiges Zeichen, höchstes Zeichen des sieghaft gewordenen Menschen:
Wie oft habe ich mich in dich versenkt, wie oft ich mich um dein Geheimnis bemüht, das in dir ruhen muss, denn wäre es sonst möglich, dass du die Kraft gehabt hättest, bestehen zu bleiben hinweg über den Wechsel von Kulturen, das Sterben von Völkern, hinweg über erdenverschlingende Sintfluten.
Die durch den Mondfraß der Erde in die kühlen, brodelnden Wasserfluten versinkende Atlantis hat dich mit auf den Grund des Meeres genommen, doch die Kinder der Osterinseln und die Azteken haben dich gehalten und in ihren Tempeln gehütet; der Atlantier geistige Erben, die alten Ägypter, haben dich vor sechs und mehr Jahrtausenden in die Porphyr- und Granitsäulen ihrer Tempel gemeißelt neben den Siegelzeichen ihrer Könige, und die göttlichen Pharaonen trugen dich stets an ihrem schmalen Handgelenk.
Und ich muss den uralten, wüstensandzerfressenen Granitstein in die Hand nehmen, der neben der chinesischen Elfenbeinpagode vor mir auf dem Schreibtisch liegt, und den mir der Magdeburger Domprediger Ernst Martin in einer hohen, beschwingten Stunde in seinem Heime schenkte.
Der Pastor hat ihn zwischen den Pyramiden von Sakkara gefunden, das Eckstück von einem Tempel, den der göttliche Pharao Amenophis zur Verherrlichung seines Ruhmes dereinst brauchte.
Ich möchte den Bau des Tempels gesehen haben, wie Granit- auf Granitblock sich türmte; wie die Steinmetze die malerischen Hieroglyphen aus dem blanken Fels schlugen! Und möchte den gekannt haben, der diese Zeichen meißelte. Und wie so oft versenke ich mich wieder in die zwei königlichen Sperbervögel, aufrecht stehend, lugend, ganz zusammengerafft in schönster Kontur – sehe auf der rechten Seite in langgezogener Kreislinie das Siegel des Königs, Bögen und sternförmige Ornamente daneben; dann eine aufspringende Schlange und über ihr das Zeichen, das ich so liebe, das Schwesterzeichen des arischen Fünfsterns: – das uralt-heilige Symbol der Menschheit: das Henkelkreuz:
Und meine Augen gehen nach langem Sinnen wieder auf dich, du Stern:
Rätselhafter Stern, geheimnisschwerer Stern, wie viel Jahre vergingen, bis du mir, der du schon in meiner Bubenzeit vor mich getreten und immerzu durch mich geistertest – denn der Schmied unseres Ortes wusste dich noch zu handhaben –, dein Geheimnis gabst! Ich war längst aus dem Dorf in die Lateinschule gegangen, da ließ uns dich der Lehrer einmal zeichnen – als Ornament! Mir aber warst du, ich weiß nicht recht warum – war es der schwarzbärtige, ewig verrußte Schmied unseres Dorfes, war es das Gemunkel meiner Urahne –, mir warst du ein unheimlich Lebendiges, so dass meine Hand wie elektrisiert fieberte und zweimal der Pinsel mit der Goldfarbe über den Rand zuckte, was sonst nie geschah.
Und später hab ich dich wiedergefunden in den unsterblichen Kupferstichen Albrecht Dürers und dann, als ich längst nicht mehr auf der Schule war: – Je mehr du mir durch den Kopf gingst, umso öfter bist du mir irgendwie begegnet!
Und wie oft habe ich deine schöne Linie gezogen aus Freude an der Form und der Bewegung!
Doch eines Tages, da sagte etwas laut und entschieden in mir, so dass gar kein Zweifel möglich war: Es ist ja keine Linie, es sind zwei übereinander gelegte Keile! Und von diesem Augenblick an sah ich immer diese beiden Keile:
Aber dies machte meine Unruhe nur noch größer! Die Zeichen erinnerten mich wohl an altbabylonische Schriftkeile, doch das war keine Lösung, höchstfalls wurde mir dadurch aufregend bewusst, dass der für mich bis dahin „deutsche“ Fünfstern plötzlich eine uralte, morgenländische Heimat wies!
Aber wie es unter solchen Umständen immer ist: Wenn man sich mit einer Sache leidenschaftlich beschäftigt, dann kommt die Antwort ganz bestimmt auf irgendeine Form!
Ich saß eines Tages in Hannover tief nach Mitternacht im Wartesaal des Bahnhofes und harrte ein wenig ungeduldig auf den Anschluss in die Lüneburger Heide. Neben mir saß ein alter, weißbärtiger Herr am Tisch, dessen Augen etwas leise Mongolisches hatten und dessen Gesicht von einer faszinierenden Durchgeistigtheit war.
Ich hatte vor mir eine Zeitung liegen, und wie das schon immer so sein muss, wenn die Stunde reif ist, kritzelte ich in meiner Ungeduld mehrmals, ohne etwas zu denken, das Pentagramm auf den weißen Rand.
Da lag mit einem Mal der Zeigefinger des alten Herrn auf dem Fünfstern, und mit Augen, die funkelten, fragte er mich: „Wissen Sie, was das ist?“
„Ja, zwei Keile!“, stieß mir etwas die Worte aus der Brust.
Mein Nachbar nickte überrascht.
„Und wissen Sie, dass es dieses Zeichen im Chinesischen gibt?“
Ich war verblüfft und verneinte.
Und der greise Mann fuhr eifrig fort: „Also dieses Zeichen stammt aus dem Chinesischen, oder sagen wir besser, es findet sich in der chinesischen Bilderschrift. Aber es war schon den Ägyptern und den arisch-indischen Stämmen bekannt, sowie in allerfrühester Zeit den im Meer versunkenen Lemuriern und Atlantiern.“
„Doch dass ich es Ihnen zeige!“ Er nahm mir dabei meinen Bleistift aus der Hand: „Im Chinesischen finden sich die Keile in dieser Form:
Der aufrechtstehende Keil symbolisiert den Menschen, und der wie ein Himmel darüberliegende drückt Gott aus!“
Bei diesen Worten gab es mir ordentlich einen Riss! Im selben Moment, wo der rätselhafte fremde Mann, von dem ich weder Herkunft noch Ziel wusste und zu dem mich die heimlich, aber stets so liebend webende Macht des Schicksals gewirbelt hatte, dies sagte, fiel es wie ein Schleier von mir, war mir das mysteriöse, so viele Jahre heiß umbuhlte Pentagramm bis in seinen Urgrund klar!
„Ich sehe, Sie verstehen jetzt ganz, was Sie da eben zuvor gezeichnet haben! Dies ist das höchste und weiseste Zeichen der Welt, weiser und königlicher noch als das Henkelkreuz, denn dieses zeigt nur den Weg des göttlichen Geistes aus dem aufrecht zum Licht strebenden Pflanzenreich durch das seine Wirbelsäule waagerecht zur Erde tragende Tierreich hinein in das Reich des Menschen – jenes aber offenbart die Überwindung dieser Bahn und dieses Lebens durch Eins-Werdung mit Gott – strahlt triumphierend von sich den Siegesglanz des Gott-Menschen!“ Und nach einer ernsten Pause: „Darum ist es das machtvollste! ... Hüten Sie es, junger Freund, und suchen Sie es bis in seine letzte Tiefe in sich zu erfüllen! ... Dann sind Sie eingetreten und aufgenommen in unseren Kreis – und dann sehen wir uns auch einmal wieder!“
Da schellte die Glocke, gellte der Ruf des Bahnsteigwärters; der geheimnisvolle Fremde erhob sich, nahm seinen Mantel, schüttelte mir herzlich die Hand und sah mir mit einem Blick in die Augen, wie mich noch kein Erdenmensch angesehen hat, mit einem Blick, der all dieses war: Liebe, Fürsorge, Mahnung und Vermächtnis.
Taumelnd erhob ich mich; ich wollte etwas sagen, ich konnte nicht – die Kehle war mir zugewürgt. Wie gelähmt starrte ich ihm nach. Bei der Tür wandte er sich noch einmal um, winkte, und sein Auge war nun in Gänze nur Liebe ... Und verschwunden war er.
In meinem Herzen aber war ein Weh, eine plötzlich heftig aufbrechende, wilde Verlassenheit.
Ein unklarer, aber brennender Schmerz ließ mich fühlen, dass hier ein Mensch von mir gegangen, der mir näher war als Hunderte, die ich kannte, seit Jahren kannte; zu dem – der aus dem Rätsel gestiegen und ins Rätsel versunken war – ich mehr gehörte als zu all den vielen andern; mit dem mich Etwas verband, das von dem Anbeginn meines Lebens stammte, ein Etwas, von dem ich das dunkle Gefühl hatte, dass ich ihm zustreben müsse mein Leben lang, und als dessen offensichtlicher Zeuge, Helfer und Mahner mir wohl dieser geheimnisvolle Bote geschickt worden war. Und da die Erschütterung so stark war, wusste ich auch, dass dieses unklare Etwas von mir verlange, ihm mein Herz, mein Gefühl, meine Vernunft hinzugeben.
... „So du dieses in heiligem Streben tust, wirst du in unseren Kreis treten“, klang es leise in mir, „und wirst du mich wiedersehen!“
Halb verloren stieg ich um die vierte Morgenstunde in den Zug nach Celle, und während ich in meinem Abteil im Fensterwinkel kauerte und die Kleinbahn mich rüttelte, sah ich keinen Nebel, keine Fuhre, keine bizarren Machangel – hatte ich in mir immer nur Eines: – diese wunderbare Gestalt und die große, riesengroße Frage: Wer war dies? – und: Wiederbegegnen? Ja, ja, wiederbegegnen!
Doch vor mir klaffte das ganze Weltenrund! – – –
So oft ich aber seither die so innig-harmonisch verschlungenen beiden Keile betrachtete, tritt das Bild des alten Mannes aus ihnen hervor und sieht mich an mit dem Blick beim Abschied.
Viel Zeit ist seither über mich gegangen, Zeit voll Lust und Leid, voll Not und Ekstase, und ich weiß seit Langem, was der Geheimnisvolle mir sagen wollte: dass nur der in jenen „heimlichen Kreis“ eintreten kann, der das heilige Pentagramm in seinem Herzen aufgerichtet hat! Nur der hat wie die schweigsam-starren Pharaonen in ihrem Jahrtausende-Schlaf den verwandelten, mysteriösen „Schlüssel“ in der Hand!
Denn wer den Weg des göttlichen Geistes genugsam erkannt hat, dem wandelt sich das Henkelkreuz in das Pentagramm und wird ihm zum Schlüssel des ewigen Lebens.
O zärtlich, o mönchisch-bräutlich geliebtes und angebetetes Zeichen! Lass mich dir leben, lass mich deinen Sinn und strengen, fordernden Willen stets erfüllen, lass mich deinem heiligen, das ganze Weltall erfüllenden Symbol immer mehr eins werden: – der ewigen Harmonie mit Gott!
Aufrecht hat der Kosmos den Menschen gestellt, das Haupt aufrecht gekehrt zum Himmel! Doch der Mensch sieht die Sonne, sieht die Unzahl von Sternen, und Sterne und Sonne predigen immerzu für ihn – doch er versteht in heutigen Tagen nimmer, warum er „das königliche Angesicht den Sternen weist“!
Der Erkennende aber und der, welchem es in heißem, rastlosen Sich-Mühen gelingt, sich in Gott zu drängen und den Himmel dauernd in sich zu ziehen – oder mit anderen Worten: der Mensch, der den Sinn des Lebens erfasst: der Gott mit sich und sich mit Gott verschmilzt, über dem liegt der obere Keil nicht mehr wuchtig als wehrende Grenze –, dem ist die Vereinigung der beiden Keile gelungen, der hat den Sinn der Schöpfung erschaut, der ist vom Stoff-Wesen aufgestiegen zum Geist-Wesen, ist zum höchsten geworden, was es auf Erden gibt: – zum in voller Harmonie lebenden Gott-Menschen!
Der hat das heilige, magische Pentagramm in sich geboren!
Wie sollte vor diesem Menschen, der sich bewusst mit Gott vereint, Böses und Dunkles je bestehen können, aus welchem Geklüft der Hölle es immer auch stiege! Dieses „Gott in mir!“ schleudert es mit verbrennender Gewalt in den tiefsten Schlund der Finsternis!
Ungeheuerlich ist die Kraft, welche Gott in es gelegt und für ewige Zeiten darin gebunden hat!
Ja, so ungeheuer, dass es auch dem primitiven Menschen wenigstens zu Teilen von seiner ewigen Kraft geben muss, ebenso wie die Kraft der Sonne über den Bösen wie über den Guten scheint.
Das ist das Geheimnis des heiligen Pentagramms. Und es wäre von hohem Segen für die Menschheit, wenn es als ewige Mahnung und letztes Strebens-Ziel leuchtend neben dem Kreuz Christi über dem Eingang aller Gotteshäuser der Erde stünde! Wenn Priester und Lehrer aller Völker es zutiefst in Herz und Hirn der Jugend brennten, in seiner weltenschweren Bedeutung!
Wo aber ist Schule und Kirche zumindest in unseren Landen hingeraten? Wo die erste es bestenfalls gedankenlos als Ornament benützt und die zweite es als abergläubischen Hexenkram verschreit!?
Und solch eine Zeit wagt es – mit solch einer grausigen Armut kosmischen Wissens! – von Weltbrüderschaft zu faseln!?
Dereinst aber einmal im Lauf der Jahrhunderttausende, wenn die Menschheit aufgestiegen zum letzten Erkennen ihres Seins, wird das heilige Pentagramm auch das große Liebeszeichen der geistigen Weltbruderschaft werden, das hoch über Sekten und Konfessionen über die ganze Menschheit strahlt und sie heimführt in das Eine Licht!
Tapp, tapp, tapp über die alte Eichentreppe herauf, vorbei an der in der Nische stehenden geschnitzten Madonna mit dem blauen Sternenmantel und dem Jesuskind, das in der Hand die großmächtige Birne hält! Wie kenne ich den Schritt!
*
Als ich zuvor zum Kaufmann hinunterging, um mir Löschpapier zu holen, kam der Tagelöhner Rehdantz an mir vorbei, die Schaufel auf der Achsel, barfuß. Es war köstlich, den lautlosen Schritt seiner staubigen Füße zu betrachten und zu sehen, wie die kleinen Steinkörnchen von seinen Sohlen fielen.
Diese lautlosen Füße, die dunkel waren vom Acker, auf dem er gegraben, haben mich mit einer Lust erfüllt, die der Anblick des edelsten Schuhwerks nie auslösen kann. Denn sie haben mir vom Segenhaftesten gekündet, das dem Menschen werden kann: – von gnadenvoller Erdverbundenheit!
Und ich hörte die Worte der Bergpredigt in mir: „Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen.“
Wie hart, protzig und rechthaberisch setzt sich dagegen der Schuh auf die Erde!
Er ist tot und hat kein Fühlen für die Ströme der Liebe und des warmen Lebens, die aus der Erde fließen und ist darum feindselig. Die Sohlen nackter Füße aber sind lebendig und spüren das Lebendige ihrer Mutter und tauschen die Kräfte in Liebe.
Sie sind wie die Wurzeln der Pflanzen, welche die Kraft aus dem Boden ziehen, in dem sie stehen.
Dieses Einströmen des Magnetismus der Erde in die bloßen Füße ist den Indern heute noch wohlbekannt; sie haben eine eigene Rhythmik des Schreitens ausgebildet, durch welche die Sohle den meisten Magnetismus zu saugen vermag.
Das ist eines der Geheimnisse, weshalb die Naturvölker so gesund sind: – Sie werden dauernd von der Erde gespeist.
Und während der reiche Schlemmer nach allen Dingen der Erde greift und seines Lebens doch nicht froh wird, nährt Mutter Natur den Armen, der oft kaum das nötige Brot hat, mit ihren unsichtbaren Kräften. Ich muss an meine Ahne denken, welcher ihr Geschick das Brot ein Leben lang karg auf den Tisch gesetzt hat, deren Gesundheit aber nicht unterzukriegen war – neunzig Jahre lang. Sie läuft heute noch, sowie der erste Bub den Winterschuh von Füßen streift, um die Wette barfuß mit ihm und sie wird ordentlich böse, wenn man ihr sagt, sie könnte sich verkühlen und möge doch Schuhe anziehen.
Ich glaube, dass das sommerliche Schuhtragen überhaupt erst aufkam, als die Völker die bewusste Naturverbundenheit verloren haben.
Wie sehr das Barfußgehen dem Gesetz des Lebens entspricht, sieht man ja an der Glückseligkeit und dem Wieder-Kindhaftwerden des Stadtmenschen, wenn er sommers durch den heißen Sand der Seebäder läuft.
Und warum bin ich in meine Schuhe geschlüpft, als ich eben zuvor zum Krämer ging?
Na ja, – na ja, weil der dicke Bürger Hinz und der brave Bürger Kunz über meine Närrischheit hinter ihren Schaufenster schmunzeln könnten!
Wie schwer hat es doch der Mensch mit der Welt und – mit sich selbst!
*
Ich ruhe still im hohen, grünen Gras.Und sende lange meinen Blick nach oben,
Von Grillen rings umschwirrt ohn Unterlass,
Von Himmelsbläue wundersam umwoben.
Die schönen, weißen Wolken ziehn dahin
Durchs tiefe Blau, wie schöne, stille Träume;
Mir ist, als ob ich längst gestorben bin
Und ziehe selig mit durch ew'ge Räume.
Ja, ich liege wieder mitten in meiner Hangwiese, oberhalb des Germanenhügels, auf dem die fünf Eichen stehen, wie ich das so oft schon tat, seit Gott Baldur die volle duftende Rose vom Himmel auf die Erde fallen ließ.
Es ist am frühen Nachmittag, die Sonne scheint fast noch senkrecht in die Blütenkelche; was Wunder, dass sie duften und strömen, dass es beinah den Sinn verwirrt! Ich liege ganz tief im Grase und schaue durch all die regungslosen Halme, Rispen, Blätter und bunten Blüten den Hang hinab ins Tal. Und dann wieder mache ich es wie Hunde und Katzen um diese Stunden: Ich liege ganz entspannt, die Augen geschlossen; döse und lasse mir die bratende Sonne wohlig aufs Fell scheinen. Und es kommen dann immer Augenblicke zwischen Schlafen und Halbwachen, wo mein Innwendigstes so stark aus meinem Körper geht, dass ich für Sekunden nicht weiß, wer ich bin und was ich war – ein Baum, ein Vogel, Schmetterling oder Wiese selber –, und ich mich aufrappeln muss wie als Bub, wenn ich beim Baden zu lange unter Wasser blieb. Und meine Seele drängt in diesen Stunden oft so sehr in die Allseele zurück, dass ich mich eine geraume Weile mühen muss, bis es mir gelingt, sie aus dem holden Netz der Urheimat zu lösen und meinem Körper wiederzugeben.
Und ich verstehe Hunde so gut, wenn sie plötzlich aus ihrem Mittagsschlummer auffahren, ganz ausdruckslos um sich glotzen, aufspringen und sich ordentlich erst zurechtschütteln müssen, ehe sie sich ihr verfliegen wollendes Ichsein wieder zurückgerettet haben.
Ich habe vorher lange mit schweren Augenlidern aus ganz schmalen Schlitzen eine Salbeipflanze vor mir betrachtet: den vierkantigen Schaft, die quirlförmig stehenden haarigen Blätter, die dunkelvioletten Blüten, die wie aufgeklaffte, wilde Schlangenköpfe, aus denen zwei tödliche, blitzweiße Giftzähne springen, mir entgegenstarrten. Und ich war von den weit aufgesperrten Rachen so gebannt, dass ich am Schlusse nicht wusste, ob ich Pflanze oder Schlange sei. Und ich ließ mich wohlig treiben im Blutreich der Geschwister und habe, wie oft schon im Leben, viel in diesen Träumerstunden von ihrem Leben und Wissen erfühlen dürfen. Aber dann kam eine Biene geschwirrt und hatte den Mut, in meinen offenen Schlund zu fliegen, und ich fühlte das Krabbeln und Wühlen in mir, dass es hinunterlief bis in meine Wurzeln tief in der warmen Erde. Und hier, zwischen dieser Lustempfindung des Tieres und der Pflanze, zuckte der Gedanke auf, den Rachen zu schließen und die emsige Schwester meinerseits zu kosen. Und ich presste die Lippen behutsam aufeinander. Und es freute sich etwas in der Schlange, dass nun die Schwester fühlen müsste, wie sehr sie geliebt würde. Unwillkürlich schlossen sich die Kiefer noch fester ... Da aber flog die kleine Biene aus dem Rachen, der weit offen stand. Und es war doch die Druckempfindung da! Über diesen Zwiespalt bin ich zu mir gekommen, und als ich den regungslosen Salbei darauf betrachtete, stand plötzlich eine große Trauer in mir, dass ich doch keine Blume war, sondern ein so großer, plumper Mensch! Es war ein Schmerz, wie wenn ich das Köstlichste im Leben verloren hätte.
Aber Mutter Natur ist gut! Sie fühlte meinen Kummer, dazu stand die Sonne glutheiß am Himmel, so gebot sie einer Glockenblume, die schräg von meinem Herzen hing – und bald war meine Seele wieder eingefangen. Ich sah zuerst den Glockenstuhl im Kirchturm meines Heimatdorfes, sah den Schneidermeister Haiderer und seinen Buben, mit dem ich allabendlich hinaufstieg, wenn im Gebälk und Gesparr das leise Dämmern schon hockte – und ich weiß nicht, wie es geschah, ich hatte die Glocken noch im Ohr –, da war ich schon in der Blume und fühlte durch meine Gefäße die Säfte steigen; wohlig und leise krampften sich die Wurzeln um Steinchen und Erdkrümchen, denn mein ganzes Sein war in einer einzigen, ekstatischen Anbetung vor der flammenden, lebengebenden Gottheit. Und trotz der Hitze konnte ich nicht anders – zu groß war meine Seligkeit! –, mit einem Ruck öffnete ich weit alle Poren meines Pflanzenleibes. Da aber brach ein Flammen in mich, dass es fast mein Inneres verdörrte; schreckhaft schloss ich rasch wieder alle Türen und neigte tiefer in Ehrfurcht und Bangnis meine Kelche zur Erde vor der Größe und Herrlichkeit des himmlischen Gestirns
Diesmal ist es ein leiser Wind, der mich wieder in mich selber zurückbringt. Und während ich dem wundervollen Tanz zusehe, der wie ganz zarte, feine Musik ist, steht das Gleichnis des großen Chinesen Dschuang-Dsi von diesem Eins-Werden mit der Schöpfung in mir, und es ist so schön, dass ich es nicht mit eigenen kärglichen Worten hersetzen, sondern daheim wörtlich einschreiben will.
Der Wind aber, der so leise ist, dass ich nicht weiß, woher er kommt, wer ihn geboren und geschickt, ob der kleine Laubbusch drüben vom Gutshof, ob der kleine Hartwald oben, oder ob er von der großen, weißballigen Wolke schräg über mir gefallen ist, streift weiter über Gräser und Blumen. Und es bricht eine große Sehnsucht auf in den Herzen der Beständigen, denn es ist des Sich-Hingebens und Nacheilens kein Ende bei Gras und Kraut. Besonders die Rispen der Gräser, die in der prallen Sonne wie in Seide stehen, eilen und trippeln den Hang hinunter immerzu, immerzu, wie bebende Bräute, die der Freier gerufen.
Jetzt ist es wie mit einem Handwischer still. Regungslos steht wieder jeder Halm und Kelch wie zuvor, ganz so, wie wenn es nie anders gewesen; und doch spüre ich, dass in der weiten Wiese ein Etwas ist, das vor dem Wind nicht in ihr war: ein Wissen, ein Wachersein – ein Gelockertersein für den großen Ruf, dessen sie alle harren! Ich sehe, wie die Gräser anders ihre Halme straffen, die Blumen anders sich geben und ihre Kelche halten wie junge Weiber, die wissen, dass sie ihre Leiber bald geben müssen, auf dass sich in ihnen vollziehe die höchste Erfüllung des Lebens!
Und ich bin mit einem Mal ganz klein vor dieser leidenschaftlichen Hinopferung, und meine Mannesseele neigt sich tief vor all diesen lieblichen Jungfrauen.
Als ich aus der Anschauung dieser Gnade erwache, sieht die große Mutter des Lebens über den Abendbergen. Stunden sind vergangen; ich habe das Spiel der Schmetterlinge und den Werbetanz der kleinen, silberflügligen Mücken nicht wahrgenommen, habe die Unrast der Käfer, die Müh' der Bienen nicht bemerkt und das Wandern und Ziehen der Wolken kaum gesehen, die nun goldumflammt wie eine starke Verheißung über der großen Liebesbereitschaft und Liebeshingabe der Erde schweben – ich habe nur eines geschaut, eines erlebt, immerzu, mit der ganzen Gewalt ihres Seins, erlebt bis in die letzte Faser der Lust und des Opfers: das MYSTERIUM der MÜTTER!
Und mein Herz ist in großer Erregung; ich muss mich auf die Knie werfen, weit die Arme breiten und mein Antlitz hineinpressen in die schmiegsame, duftende Garbe von Blumen und Gräsern, die vom weichen Strahl der Abendsonne überflossen sind. –
Wie ich das Haupt erhebe, glühen die Wolken über dem Eichberg wie flüssiges Gold im hauchzart grünen Firmament.
Auf der Wiese liegen plötzlich lichte Schatten zwischen Halmen und Schäften. Doch der Abend ist warm, fast schwül, und noch voll bunter, schillernder Schmetterlingsflügel. Nur das Summen fehlt; da sehe ich, dass die Bienen heimgegangen sind. Und während ich nun langsam den Hang hinunterschlendere, ist die Wiese mit einem Mal ein einziges Grillengezirp, und es ist eine Feierstimmung zwischen all den Rispen und Kelchen, wie wenn jemand eine schöne, erbauende Predigt hielte. Und es ist auch so: – Grillenandacht! Und mir wird so heimatlich warm ums Herz, dass ich ganz still vor mich hinlächeln muss.
Da spüre ich unvermittelt den starken Atem der Erde; und während ich die heilige Urkraft allen Lebens andächtig in mich ziehe, denke ich an die Millionen Städter, die um diese Gnadenzeit, gehetzt von Menschen, Autos, Verkehrssignalen und unzähligen anderen Plagen, über Asphalt und Pflaster hasten, durch enge, düstere Steinschluchten, die sie Straßen nennen und in denen um diese friedvollste, leuchtende Stunde längst kein Strahl mehr erquickt; um diese Stund, in der die Sonne ganz weich und mild wird, wie eine emsige, kraftvolle Mutter, die ihre Arbeit getan hat und sich mit den armumfangenden Kindern vor die Haustür setzt und ihnen Geschichten erzählt. Und mir lastet der Wahnsinn dieser Naturabgeschnittenheit so schwer auf der Brust, dass der Wunsch in mir aufsteigt: Es sollte doch keine Stadt größer sein, als dass es jedem Insassen möglich wäre, sich nach dem Tagewerk in der freien Flur zu laben.
*
So, da ist die wundervolle Legende von Dschuang-Dsi: Einst träumte Dschuang Dschou, dass er ein Schmetterling sei, ein flatternder Schmetterling, der sich wohl und glücklich fühlte und nichts wusste von Dschuang Dschou.
Plötzlich wacht er auf: Da war er wieder wirklich und wahrhaftig Dschuang Dschou. Nun weiß ich nicht, ob Dschuang Dschou geträumt hat, dass er ein Schmetterling sei, oder ob der Schmetterling geträumt hat, dass er Dschuang Dschou sei, obwohl doch zwischen Dschuang Dschou und dem Schmetterling sicher ein Unterschied ist.
So ist es mit der Wandlung der Dinge.
*
Noch schnell der Gedanke, bevor ich ins Haus trete: Wenn ich meine nächste Mission mir bestimmen dürfte, dann wüsste ich mir keine höhere Gnade vom Allmächtigen, als dass er mich zum Gott der Tiere und Pflanzen machte.
*
Abendbrot unter dem großen Nussbaum. – Was sind das für Abende, für Feste!
Es gibt nichts Beglückenderes für mich, als nach einem reichen Tag mit Arbeit, Grübeln und Wanderung, nachdem ich den Garten gegossen, einen Gang durch die Obstbäume gemacht und nachgesehen habe, wie weit die Beerensträucher und die Gemüsebeete sind und wie die Blumen stehen, das Abendbrot im Freien einzunehmen!
Der Tisch ist Blütenweiß gedeckt, der alte Nussbaum hängt seine breiten Äste beinah auf den Tisch herab und in den weißglasierten Bauernwasserkrug hinein, so dass die noch immer zarten, gelbgrünen Blätter mit ihrem kraftstarken, ätherischen Öl die Speisen würzen, und der laue Abend ist voll von dem duftenden Atem all der wassergenetzten Blüten und Blätter. Ich schaue durch das Gezweig die hohen, bizarren Ranken meines edlen Weines, der sich an der verwitterten Scheunenmauer hinaufschlingt, funkelnd vor Nässe, und in all dies Glänzen und Freuen flötet hoch oben auf dem Giebel, scharf in den grünen Himmel gezeichnet, eine Amsel ihr Lied. Unsere Hausschwalben schießen hin und her, vom Nest zum Bach, vom Bach zum Nest, und sind unermüdlich; hinten im Obstgarten zetert ein Rotschwanz. –
Die Menschen erzählen mir oft von den vornehmen Restaurants mit Musik und Tanzdiele in der Großstadt; – nein, ich will lieber unter meinem Nussbaum sitzen! Mitten drin im gottgesegneten Abend, mitten zwischen Tieren. Zu meinen Füßen liegt Tristan, mein Hund, noch immer schmal und schlank, die glänzenden Haare noch immer braun wie Schokolade; ein leiser Ruf und er bebt am ganzen Leibe, dankbar vor Glück. Neben ihm hockt Murli, immer ein wenig unnahbar, die kohlrabenschwarze Katze mit den unbeschreiblich welttiefen goldgrünen Augen, die so groß sind, dass sie fast das Drittel des Kopfes einnehmen in denen der ganze Daseinsschmerz der gepeinigten Kreatur liegt. Oh, wenn Murli auf meinem Schoße sitzt und ich mich manchmal in ihre Augen versenke, dann halte ich es plötzlich nimmer aus, so furchtbar ist die Sprache ihrer Augen! Jeder gequälte Baum, jedes jemals verhetzte, geschundene Tier – die ganz große Seele der Kreatur redet und klagt und bittet dann – die ganze, große gekreuzigte Weltenseele!
Und ich weiß dann nicht, wohin ich mich flüchten soll vor diesen Augen. Und ich muss diese Augen verbergen und presse das Tier an mein Herz.
Auf der Bank neben mir hockt ihr Sohn, der junge, ein wenig ungeschlachte, aber unendlich liebebedürftige und stets mit vorzüglichem Appetit gesegnete Tiegerl. Den brauche ich nur anzusehen und schon erhebt er sich, macht einen Buckel, reibt und schmiegt sich an mich und schnurrt, dass es eine helle Freude ist.
Da knistert es schräg über meinem Kopf. Alles in mir lacht! Ja, soll denn da nicht die ganze Sonne ins Herz fallen über so viel Anhänglichkeit, so viel Liebe! Ich weiß, Jakob kann es nicht leiden! Er kann es absolut nicht sehen, wenn ich zu Tristan oder den Katzen gut bin! Ich hab's noch nicht ganz heraußen: will er alle Liebe für sich allein haben und ist es schreckliche Eifersucht, die sein Baumkauzherz plagt, oder will er nur auch geliebt sein? Da das Scharren nun ja doch kein Ende mehr nähme, was ist da selbstverständlicher, als dass ich aufstehe und ihm über das Gefieder streiche.
Nun hockt er wieder regungslos, die Augen unverwandt auf mich gerichtet, auf seinem Ast.
Und auch ich sitze weiter regungslos, den Kopf an die silbergraue Rinde des alten Nussbaumes gelehnt, mit weitem, friedvoll-glücklichen Herzen in meinem stillen Reich und sinne über den Garten hinweg auf die nahen, hohen Berge. Und ich denke mir, wie klug die Berge sind ...
Die Gartenpforte knarrt. Alle Tiere lauschen – nur sie nicht, ihr Kopf mit den goldgrünen Augen bleibt abgewandt. Es ist, als wüsste ihr die Welt nichts mehr zu sagen.
Ein Pfiff, wie immer. Tristan springt auf und empfängt an Stelle seines Herrn.
Und wieder lacht etwas in mir. Gibt es Schöneres auf der Welt als Treue! Ein herzlicher Handschlag und Freund Wagner sitzt essbereit. Minna stellt die Schüssel auf den Tisch; legt einen Riesenlaib dunklen Roggenbrotes dazu.
Ja, wie anders klingt doch, wenn Baum und Tier und Himmel zuhören, das: „Komm Herr Jesus, sei unser Gast, und segne, was du uns bescheret hast!“
Friedlich fließen die Töne des Ave-Glöckchens in die Stille.
Und immer mehr bricht der Abend ein. Samtdunkel steht der Schuppengiebel, auf dem morgens immer die Tauben hocken, im Blausilber der aufziehenden Sommernacht.
Stern um Stern knospt auf. Schräg über dem Haus blüht Venus.
Hat ein Mensch das Recht, undankbar zu sein in solchen Nächten!? Wahrlich, ich bin es nicht, und es ist ja alles so recht wie es ist – aber ich liebe ihn nun schon einmal so besonders – es fehlt mir, dass der königliche Jäger Orion in den Sommernächten nicht über den Himmel stürmt.
Wir sitzen ganz still und lauschen; wir lauschen in die Nacht. Man muss ganz still sein und angespannt horchen, dann hört man sie, dann hört man das Raunen der Mutter Natur. –
Ein Brett in der Scheunenwand knackt: – ja, wir verstehen dich, es war ein heißer Tag! ...
Dies Knacken des alten Brettes genügt uns. Es ist sehr alt, und es hat viel erlebt im Wandel der Jahre. Man muss es nur verstehen.
Ein Gurren im Taubenschlag ...
Wie das warm durchläuft! Oh, es gibt aberhundert Gurrlaute. Man muss sie nur kennen. Es war die Ermahnung der Mutter an eines der Jungen, das den Kopf zu sehr zum Schlag hinaussteckte und von den Silberfluten der Sterne ganz benommen und unruhig war.
In die Nacht träumen, das aber gibt es für Tauben nicht. „Zu groß ist das Geheimnis der Nacht für dich, mein Kleines“, sagt die Mutter.
Ein mächtiger Weberknecht läuft über den Tisch: – die Liebe der Menschen in dich! ... Wir wissen es, ja, ja. Doch nur Zeit lassen, mehr Zeit lassen! Es kommt ja. Grüß uns die Brüder! ... Mutter Natur zum Gruß! – und weg ist er.
Wie leise, leise die alte rissige Rinde des Nussbaums knistert! ... hauchleise! Ich höre, den Kopf am Stamm, das wohlige Dehnen des Holzes.
„Hört ihr die Blätter atmen? Mein Gott, was ist das für eine Lust!“, flüstert Minna.
Und ob wir es hören. Ja, was ist es für eine Lust! Unbeschreiblich! Ähnlich dem Gefühl, wenn man auf dem heiligen Leib eines jungen Weibes das wachsende Leben sich bewegen und regen fühlt. Und wir sind gefangen, ganz gefangen und atmen im Rhythmus des Baumes. –
Ein Vogel fliegt ein in die Krone ...
Ein neuer Stern bricht auf: – O Gott, wie groß bist du! Und nun ist es da! Das große, berauschende, betörende Wunder. Der ganze Hof ist mit einem mal voll! Voll von Strömen und Düften, selig und süß wie Honigseim.
Vom Nachbar fließt es herüber. Dort stehen sie, groß, dunkel und eine einzige Verheißung. Oh, ich kenne sie, kenne jede von ihnen ganz genau, und ich habe gewartet, sei Tagen gewartet wie ein Kind, das auf die Heimkehr des Vaters aus der Stadt wartet – und nun ist es geschehen, nun hat sich die Stunde erfüllt, nun sind die Schoße begehrend geworden mitten in der glitzernden Silbernacht.
Als große, harrende Bräute stehen die Akazienbäume in der verklärten Nacht. Ihr Sein ist ein einziger Duft geworden und fällt uns an mit großer Gewalt.
Und wir werden klein wie Kinder, vergessen unser ganzes Leben mit all seinen Sorgen und Freuden, mit allem, was war, und allem, was im Werke steht, und gehen einzig in dem Wunder dieses Duftes auf. Wir haben keinen Leib, wir haben kein Beschwer, wir wissen nur, dass wir sind, anders sind, ganz, ganz anders – schwebend! Und keines sagt ein Wort, keines stößt einen noch so leisen Laut des Entzückens aus, denn wir sind Laut und Entzücken selbst: – von irgendwo losgelöster, seligschwebender Laut. Wir sind ein Singen: – eine einzige „Hymne an die Nacht“!
Wir sind ein Hauch: – der Atem der Mutter Natur! Wir sind Atem und Lied.
Ach Gott! Wir sind dieses alles und wir sind doch noch ein ganz Anderes! ... Was? ... Eine große Trunkenheit? ... Ein Gebet? ...
O Gott, wir sind das Höchste in dieser Stunde der Erhabenheit – wir sind ein demütiges Nichts!
Wir haben uns mit Jauchzen und mit Preisen aus uns gegeben; wir sind ganz nur das Eine: – Hingabe!
Hingabe an das Große.
Die Fledermaus, die immerzu ihren Bogen durch den Hof zog, flattert nicht mehr; sie tanzt, torkelt, springt wie ein Bock, fällt wie ein Stein, zackt in der Luft herum wie verrückt. Ja, wer soll denn da auch seine Sinne beisammen behalten, wenn Akazienbäume ihren Duft durch die Nacht verstreuen! ...
Wagner rennt plötzlich wie besessen ohne Laut zur Gartentür hinaus. Kommt strahlend zurück mit einem Krug Wein vom „Schwarzen Adler“.
Wir stehen unterm Nussbaum.
Hell funkelt der Wein im klirrenden Glase.
Und wir trinken, trinken das Licht der Sterne, das Duften der Bäume, den Atem der Mutter Erde! – Liebe, Liebe, Liebe!
... Die Katzen sind weg. Wir haben es nicht gesehen; sie jagen. Es ist tief in der Nacht.
Mein Blick geht zu Jakob empor. Der tritt leise scharrend von einem Fuß auf den andern. Um diese Stunden wird er immer unruhig. Durch sein Blut rieselt das Locken der Nacht. Da kommt der Wald jede Nacht und fällt ihn an.
Wir erheben uns.
Tristan springt auf. Ein Kratzen, ein dumpfes Flügelplupfern und Jakob blockt mit schlagenden Schwingen und schwankem Körper auf meine Schulter auf.
So begleite ich Freund Wagner zur Gartentür mit Hund und Vogel.
Handschlag noch über den Gartenzaun. Warme feste Hände.
„Gute Nacht. Schlaf gut!“
„Du auch. Gute Nacht!“
Laut hallt sein Schritt die stille Dorfstraße hinunter.
Ein Köter kläfft kurz.
Ich schaue zum Firmament empor: Wie muss Gott lieben! – Das Weltall steht in Flammen!
*
Gibt es ein göttlicheres Morgenerwachen? Das leise, flötende Gezwitscher der Schwalben hat mich, wie alle Tage jetzt, aus dem Schlaf geweckt. Ich brauche nicht nach der Uhr zu schauen; ich weiß, es ist drei Uhr morgens.
Mir ist so andachtsvoll zumut, ich liege und lausche und schlürfe das trauliche Morgenlied meiner Schwalben in mich. Alles ist so still und so frisch und so stark. Ich spüre die verhaltene Aufbruchsfreude der Natur.
Es ist die Stunde des Harrens, der demütigen Bereitschaft.
Ich weiß es längst: Es geht um diese Stunde ein heimliches Beben durch die ganze Kreatur, das jedes Vogelherz trifft, jeden Grashalm umweht, durch den Stamm der stärksten Eiche rieselt!
Ich habe es beobachtet: Sogar die Melodie des fließenden Wassers ändert mit dieser Stunde ihren Tonfall. Ich weiß, wer es gibt, das Zeichen, den heimlichen Ruf – doch nehme ich gerne an, dass es der Erd-Geist selber ist, der seine ihm noch verbundenen Kinder weckt.