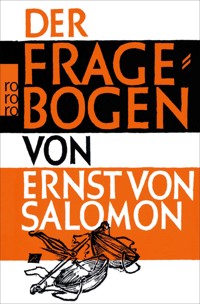
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
«Mit der Wahrheit kann man am besten lügen!» Erschienen 1951, heftig umstritten und einer der größten Bucherfolge der Nachkriegszeit, auch international: Aus der peinlich genauen, provozierend ausführlichen Beantwortung der 131 Fragen des Großen Fragebogens, mit dem die amerikanische Militärregierung Täter und Mitläufer ermitteln wollte, machte Ernst von Salomon einen autobiographischen Roman ohne Vorbild. Es ist ein ironischer, bisweilen zynisch klingender Bericht über ein Leben, dessen Teile – Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Terrororganisation, Liebe zu Frankreich und zu einer jüdischen Frau – nicht zueinander passen wollen; zugleich ein nach wie vor packendes literarisches Zeugnis deutscher Nachkriegsmentalität, die nicht von der Schuld der Besiegten sprechen mochte, ohne zugleich Selbstgerechtigkeit und Siegermentalität der Besatzer anzuprangern. Mit einem Nachwort von Michael Töteberg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1616
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Ernst von Salomon
Der Fragebogen
Mit einem Nachwort von Michael Töteberg
Über dieses Buch
«Mit der Wahrheit kann man am besten lügen!»
Erschienen 1951, heftig umstritten und einer der größten Bucherfolge der Nachkriegszeit, auch international: Aus der peinlich genauen, provozierend ausführlichen Beantwortung der 131 Fragen des Großen Fragebogens, mit dem die amerikanische Militärregierung Täter und Mitläufer ermitteln wollte, machte Ernst von Salomon einen autobiographischen Roman ohne Vorbild. Es ist ein ironischer, bisweilen zynisch klingender Bericht über ein Leben, dessen Teile – Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Terrororganisation, Liebe zu Frankreich und zu einer jüdischen Frau – nicht zueinander passen wollen; zugleich ein nach wie vor packendes literarisches Zeugnis deutscher Nachkriegsmentalität, die nicht von der Schuld der Besiegten sprechen mochte, ohne zugleich Selbstgerechtigkeit und Siegermentalität der Besatzer anzuprangern.
Mit einem Nachwort von Michael Töteberg.
Vita
Ernst von Salomon, 1902 in Kiel geboren, wurde bereits ab 1913 in einer preußischen Kadettenanstalt militärisch erzogen. Nach dem Ersten Weltkrieg kämpfte er als Angehöriger verschiedener Freikorps während des Spartakus-Aufstands in Berlin, im Baltikum und in Oberschlesien. Als Mitglied der rechtsterroristischen Organisation Consul war er an dem Attentat auf den Außenministers Walter Rathenau mitbeteiligt. Wegen Beihilfe zum Mord zu fünf Jahren Zuchthaus und wegen eines weiteren Mordversuchs erneut verurteilt, wurde er bald begnadigt und machte sich in den folgenden Jahren als Schriftsteller wie als Publizist der sog. Konservativen Revolution einen Namen. Sein erster Roman, «Die Geächteten», erschien 1930 bei Rowohlt. Im NS-Staat, zu dem Salomon nicht nur seiner jüdischen Lebensgefährtin wegen ein zwiespältiges Verhältnis pflegte, arbeitete er in der Filmbranche. Nach Kriegsende wurde Salomon seiner politischen Vergangenheit wegen von der amerikanischen Besatzungsmacht in Haft genommen. Die Erlebnisse dieser Zeit hat er in seinem erfolgreichsten Buch «Der Fragebogen» verarbeitet, das in der Bundesrepublik und in Frankreich ein Bestseller wurde. Später engagierte sich Salomon in der internationalen Friedens-Bewegung. Er starb 1972 in Winsen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2013
Copyright © 1951 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Werner Rebhuhn
Coverabbildung Werner Rebhuhn
ISBN 978-3-644-02371-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
MILITARY GOVERNMENT OF GERMANY
Fragebogen
WARNING: Bead the ontire Fragebogen carefully before you start to fill it out. The English language will prevail if discrepancies exist between it and the German translation. Answers must be typewritten or printed clearly in block letters. Every question must be answered precisely and conscientiously and no space is to be left blank. If a question is to be answered by either «yes» or «no», print the word «yes» or «no» in the appropriate space. If the question is inapplicable, so indicate by some approriate word or phrase such as «none» or «not applicable». Add supplementary sheets if there is not enough space in the questionnaire. Omissions of false or incomplete statements are offenses against Military Government and will result in prosecution and punishment.
WARNUNG: Vor Beantwortung ist der gesamte Fragebogen sorgfältig durchzulesen. In Zweifelsfällen ist die englische Fassung maßgebend. Die Antworten müssen mit der Schreibmaschine oder in klaren Blockbuchstaben geschrieben werden. Jede Frage ist genau und gewissenhaft zu beantworten und keine Frage darf unbeantwortet gelassen werden. Das Wort «ja» oder «nein» ist an der jeweilig vorgesehenen Stelle unbedingt einzusetzen. Falls die Frage durch «Ja» oder «Nein» nicht zu beantworten ist, so ist eine entsprechende Antwort, wie z.B. «keine» oder «nicht betreffend» zu geben. In Ermangelung von ausreichendem Platz in dem Fragebogen können Bogen angeheftet werden. Auslassungen sowie falsche oder unvollständige Angaben stellen Vergehen gegen die Verordnungen der Militärregierung dar und werden dementsprechend geahndet.
Ich habe nun den gesamten Fragebogen sorgfältig durchgelesen. Ich habe ihn sogar, ohne dazu besonders aufgerufen zu sein, mehrfach durchgelesen, Wort für Wort, Frage für Frage, die Sätze in deutscher und die in englischer Sprache. Es ist dies nicht der erste Fragebogen, mit dem ich mich beschäftige, ich habe mich schon mit mehreren Fragebogen gleichen Inhaltes und einer großen Reihe ähnlichen Charakters befasst, zu einer Zeit und unter Umständen, über die in der Rubrik «Bemerkungen» dieses Fragebogens noch einiges zu sagen ist. Auch während jener Zeitspanne vom 30. Januar des Jahres 1933 bis zum 6. Mai des Jahres 1945, einer Zeitspanne, die gewöhnlich als die des «Dritten Reiches», billig als die des «Tausendjährigen Reiches», kurz als die des «Nazi-Regimes» und gut als die der nationalsozialistischen Regierung in Deutschland bezeichnet wird, auch während dieser Zeitspanne haben mir zahlreiche Fragebogen vorgelegen, und ich kann versichern, dass ich sie in jedem Falle sorgfältig durchgelesen habe.
Um von vornherein allen Ansprüchen zu genügen, die an mich auch in diesem Falle gestellt werden, möchte ich sogleich mitteilen, dass die Lektüre aller dieser Fragebogen stets die gleiche Wirkung hatte: Sie löste in mir eine Reihe von Gefühlen aus, deren erstes und stärkstes das eines durchdringenden Unbehagens war. Wenn ich mich bemühe, dieses Gefühl genau zu bestimmen, so gelange ich dahin, es ehestens mit dem eines ertappten Schuljungen zu vergleichen, eines sehr jungen Menschen also, der erst zu Beginn seiner Erfahrungen mit jenen großen und drohenden Mächten steht, die sich ihm als Gesetz, Sitte, Ordnung und Moral darstellen. Er kann die Welt in ihrer Berechtigung, so zu sein, wie sie ist, noch nicht kennen, er hat ein gutes Gewissen, wenn er glaubt, mit ihr so weit in Einklang zu sein, und ein schlechtes, wenn dies nicht der Fall ist. Und er kann auch nicht wissen, dass sehr wohl einmal der Augenblick kommen wird, da er das berauschende Glück erfährt, diese Welt mit ihren Einrichtungen vor seinem eigenen Gewissen als schlecht zu empfinden, schlecht und von Grund auf neu zu gründen.
Nun bin ich infolge von Umständen, die in der Antwort auf die Frage 19 dieses Fragebogens behandelt werden müssen, in keiner Weise legitimiert, mich über Fragen des Gewissens gültig auszulassen. Nicht ich bin es, der es wünscht, dies zu tun. Aber wie soll ich die gesamte Einrichtung des Fragebogens anders auffassen als einen modernen Versuch, mich zu einer Gewissenserforschung zu bewegen?
Die bewundernswürdigste Institution dieser Welt, die ich kenne, die katholische Kirche, kennt die Ohrenbeichte. Die Heilseinrichtung des Sakramentes der Beichte kennt nur Sünder, keine Verbrecher, und sie kennt nur eine Sünde, die nicht vergeben werden kann, die Sünde wider den Heiligen Geist. Die katholische Kirche sucht den Heiden, der da trachtet, nach seinen eigenen Maßstäben glücklich zu werden, zu dessen Heil zu bekehren, dem Ketzer aber, der einmal die Botschaft gehört, ihr aber nicht folgen will, vermag sie nicht zu verzeihen. Das ist eine klare und runde Sache, um in einem gängigen Jargon zu reden, eine Angelegenheit voll sublimer Konsequenzen, die das Beichtgeheimnis in sich einschließen wie auch die Möglichkeiten für den Einzelnen, das Maß an Gnade, das er sich erhofft, zu einem guten Teile von der eigenen, innersten Entscheidung abhängig zu machen, und ich könnte mich wohl dazu bekennen, müsste ich nicht befürchten, schon allein die Quintessenz der Lehren der Kirche, die Zehn Gebote, stünden in einem schmerzhaften Widerspruch zu einer Reihe von Gesetzen, die ich neuerdings sehr zu beachten gehalten bin.
Denn nicht die katholische Kirche ist es, die in Fragen der Erforschung meines Gewissens an mich herangetreten ist, sondern eine Institution, weitaus weniger bewundernswürdig, die Alliierte Militärregierung. Sie kennt freilich jene sublimen Konsequenzen nicht. Sie naht mir nicht wie der Geistliche dem armen Sünder in der von der Welt abgeschiedenen Zelle des Beichtstuhles, sie sendet mir den Fragebogen ins Haus und beginnt sofort barschen Tones wie ein Untersuchungsrichter gegenüber dem Verbrecher mit einer Flut von 131 Fragen, sie fordert von mir kalt und knapp nichts weniger als die Wahrheit und droht gleich zweimal, am Anfang und am Ende des Fragebogens mit Strafen, deren Art und Ausmaß ich (siehe auch unter «Bemerkungen») herzlich zu fürchten nicht umhinkann.
Es waren Vertreter der Alliierten Militärregierung, Männer in schmucken Uniformen und mit vielen bunten Auszeichnungen, die mich eindringlich darauf aufmerksam machten, dass, die Frage nach dem Gewissen sich vor jedem Tun nicht zu stellen, eines Mannes unwürdig sei. Sie saßen vor mir, einer nach dem anderen, sympathische und gepflegte junge Leute, und sie sprachen schlicht und selbstverständlich von einer so großen Sache wie dem Gewissen, und ich bewunderte sie wegen ihrer apodiktischen Sicherheit und beneidete sie um die Geschlossenheit ihres Weltbildes.
Wenn ich auch immer versuchte, irgendein beabsichtigtes Tun mit irgendeiner Art von Gewissen in Einklang zu bringen, so stand ich jedes Mal vor der grausamen Alternative, entweder an der Legislative des Gewissens zu zweifeln oder aber jegliches Tun gänzlich zu unterlassen.
Aus Ton und Inhalt des Fragebogens geht nicht hervor, aus welchen Gründen ich gefragt werde. Es ist mir nicht gelungen, von irgendeinem Vertreter irgendeiner Militärregierung zu erfahren, welchen Zwecken etwa die Frage 108 wohl dienen möge. Wenn ich mich gewissenhaft prüfe, ob ich diesen Fragebogen ausfüllen kann, so ist der Gedanke unabweisbar, dass ich zumindest mit Beantwortung solcher Fragen, wie etwa 18 oder 25 oder 99 bis 102 oder 120 oder 126 bis 128, eine flagrante Verletzung der Rechte anderer begehen kann und damit etwas tue, was ich zutiefst für widersittlich halte. Angesichts des gesamten Tenors dieses Fragebogens und in Kenntnis der Tatsache, dass fast jeder Deutsche zumindest der westlichen Teile unseres Landes gehalten ist, ihn auszufüllen, muss ich geschärften Gewissens endlich die Befürchtung hegen, teilzuhaben an einem Akte, der unter seinen nicht kontrollierbaren Umständen doch geeignet sein kann, einem Lande und einem Volke, dem ich unausweichlich angehöre, zu schaden im Auftrag fremder Mächte, die ihre Herrschaft ausüben lediglich durch die historische Tatsache des deutschen Zusammenbruchs und aufgrund einer Abmachung, die geschlossen wurde mit Männern, von denen ihre Partner von vornherein annahmen, dass sie Verbrecher seien, fremder Mächte, die damit jedes Recht zur Herrschaft gewonnen haben – jedes Recht außer dem einen, dem Recht nach dem Gesetz, nach dem sie selber angetreten, und gerade dadurch ein Vakuum entstehen ließen, in welchem uns erlaubt sein möge, uns anzusiedeln, uns, die wir uns jedes Rechtes begeben haben, jedes Rechtes außer dem einen, dem Recht nach dem Gesetz, nach dem wir selber angetreten.
Nur Ruhe, ich werde diesen Fragebogen ausfüllen. Ich habe auch die anderen alle ausgefüllt. Stets war der eigentliche Angelpunkt des Verfahrens der gleiche, wie er sich hier in der Frage 1 ausdrückt, die Spekulation auf den Wunsch des Befragten, sich einfach einer dummen und beschämenden Belästigung zu unterwerfen, um weiterhin eine Tätigkeit ausüben zu können, die ihm sinnvoll dünkt, und auf der sich seine ganze Existenz aufbaut.
Es gehört zu den merkwürdigsten Erscheinungen, dass jede Macht in sich eine eigene Gegenkomponente entwickelt, die einzige Gewalt, durch die sie gestürzt werden kann, wenn es ihr nicht gelingt, sie so lange zur Erhöhung der eigenen Spannkraft einzubauen, bis sie mit ihr erschöpft zu Boden sinkt. Die Gegenkomponente der Mächte unserer Zeit scheint mir der solidarische Akt.
Von diesem Aspekt aus handele ich freilich vorbildlich, wenn ich etwas tue oder mich weigere, etwas zu tun, was zu tun oder sich weigern, zu tun, für alle in der gleichen Lage wie ich verbindlich wäre. Aber das Perfide der oben genannten Spekulation beruht ja gerade darin, den Einzelnen in einer künstlich herbeigeführten Vereinzelung zu schlagen. Nicht alle sollen sich einem Verfahren unterwerfen, welches alle angeht, sondern jeder Einzelne in seinem eigenen Fall. Hier ist jede Art von Heroismus sinnlos, weil er nicht zur Kenntnis anderer gelangt, oder weil er in jedem anderen Falle nicht mehr verbindlich ist. Es bleibt natürlich die Möglichkeit eines Heroismus aus sittlichem Prinzip, und ich zweifle nicht daran, dass es Menschen gibt, die eher sterben wollen als sich einer dummen und beschämenden Belästigung zu unterwerfen. Ich frage mich nur, warum sie es dann nicht vorziehen, sogleich nach ihrer Geburt das Zeitliche zu segnen.
Nein, hier ergibt sich für den Einzelnen nichts als die Pflicht, zu prüfen, ob in seiner Unterwerfung nicht eine andere Möglichkeit beschlossen liegt, verbindlich zu Dingen zu gelangen, die einen solidarischen Akt herbeiführen können. Und da zeigt mir just der Fragebogen, der vor mir liegt, ein versöhnliches Gesicht. Er ist so angenehm umfangreich. Gerade die Fülle seiner Fragen bedingt eine Fülle von Antworten. Und ich halte es für verdienstlich in jedem Falle, mich mit den Möglichkeiten jenes merkwürdigen Dinges zu befassen, welches die allgemeine Skepsis einfach «Wahrheit» zu benennen übereingekommen ist.
Der Erfinder des historischen Idealismus, Friedrich von Schiller, hat einmal festgestellt, dass die Wahrheit in allem nur teilweise steckt, nirgends aber ganz und in ihrer reinen Gestalt vorhanden ist. Um sich ihrer zu bemächtigen, bedarf es einer größtmöglichen Anzahl von Zeugnissen – die Wahrheit in ihrer reinen Gestalt muss also bestimmt sein durch die Quantität der erfassten Beziehungen des Geschehnisses. Nun, das ist nichts anderes als das Ergebnis einer Untersuchung, die der Erfinder des historischen Materialismus, Karl Marx, veranstaltet hat – er fand den Punkt, an dem die Quantität in die Qualität umschlägt. Wenn zwei so verschiedene Geister zu dem gleichen Resultat gelangen, so muss das wohl zu denken geben. Nun gehören beide, Schiller wie Marx, zwar einer Nation an, deren Zeugnisse in der Welt keinen sehr guten Ruf genießen, sie haben die barbaresken Züge eines Volkes, das nun schon seit Tausenden von Jahren hinter den Hügeln lagert und von dem man sich selbst jetzt noch manches gewärtigen muss. Aber wenn ich angesichts des Fragebogens den Forderungen des Gewissens zu folgen gehalten bin, dann doch in den Fragen der Wahrheit, und da bietet sich mir in der Tat keine andere Methode als die von Schiller und Marx.
Ich habe, wie aus der Anführung des Punktes Nummer 24 ersichtlich ist, hinreichend oft Gelegenheit gehabt, die in Deutschland geübte richterliche Verfahrensweise zu studieren. Ich hatte dabei das Glück, immer zu verspüren, wie mir die Qualifikation zur inneren Auflehnung durch eine Maxime genommen wurde, welche sich die Wahrheitserschöpfungspflicht des Richters nannte. Ich vermag um der korrekten Ausübung ebendieser Maxime willen an jeden der präsidierenden Richter nur mit dem Gefühl der größten Hochachtung zurückzudenken. Sie scheuten wahrlich keine Mühe, aus der Anhäufung einer größtmöglichen Anzahl von Fakten das Bild der Wahrheit in ihren zartesten Konturen herauszusublimieren. Ich erkannte sehr bald, dass es durchaus in meinem Vorteil läge, sie in ihrem Vorhaben zu unterstützen, aktiviert durch meinen Verteidiger, dessen Weisheit in der Einsicht kulminierte, dass er seinerseits mit der Wahrheit am besten lügen könne. Das Verfahren, welches sich durch diesen Fragebogen dokumentiert, kennt keinen Verteidiger, aber gerade, weil niemand weiß, welche Absichten es verfolgt, weiß auch niemand, ob in seinen Methoden nicht doch unvermutet die Möglichkeit einer Wahrheitserschöpfung verborgen ist. Dieser Möglichkeit will ich dienen, in der Hoffnung, dass gleich mir noch vielen der gleiche Anreiz lächelt, sodass am Ende doch aus der Quantität der Antworten sich die Qualität eines wenigstens annähernd wahren Bildes extrahiert über das, was in unserem Lande geschah, und wie es eigentlich gewesen ist. Dann aber richten sich die Fragen dieses Fragebogens nicht an mein Gewissen, sondern an mein Gedächtnis!
Unter Frage 131 wird man die Antwort finden, dass meine Kenntnis der englischen Sprache sehr gering ist, lachhaft gering, aber doch nicht so gering, dass mir nicht der fürchterliche Verdacht aufsteigen konnte, gleich die ersten Worte des Fragebogens müssten schon zwei Druckfehler enthalten. Sollte es nicht heißen: Read the entire … statt Bead the ontire …? Und ob es richtig ist, dass es einmal heißt «appropriate» und das andere Mal «approriate»? In Zweifelsfällen ist die englische Fassung maßgebend …
A. Personal / A. Persönliche Angaben
1. List position for which you are under consideration (include agency of firm). – 2. Name (Surname). (Fore Names). – 3. Other names which you have used or which you have been known. – 4. Date of birth. – 5. Place of birth. – 6. Height. – 7. Weight. – 8. Colour of hair. 9. Colour of eyes. – 10. Scars, marks or deformities. – 11. Present address (City, street and house number). – 12. Permanent residence (City, street and house number). – 13. Identity card type and number. – 14. Wehrpass No. – 15. Passport No. – 16. Citizenship. – 17. If a naturalized citizen, give date and place of naturalization. – 18. List any titles of nobility ever held by you or your wife or by the parents or grandparents of either of you. – 19. Religion. – 20. With what church are you affiliated? – 21. Have you ever severed your connection with any church, officially or unofficially? – 22. If so, give particulars and reason. – 23. What religious preference did you give in the senses of 1939? – 24. List any crimes of which you have been convicted, giving dates, locations and nature of the crimes. –
1. Für Sie in Frage kommende Stellung: siehe Anlage.
Zu 1. Es ist wohl bedacht, wenn ich mit dem Hinweis beginne, dass an der entscheidenden Ecke meines Lebens eine Frau gestanden hat. Das mag weder mich noch sonst jemanden wundernehmen, die Statistik weist aus, dass die Zahl der Männer und der Frauen annähernd gleich ist, nach Weltkriegen pflegen die Frauen sogar überall in der Überzahl zu sein, sodass Männer, die ohne Scham zugestehen, sich vorzugsweise in weiblicher Gesellschaft behaglich zu fühlen, nicht eben selten sein mögen. Aber die Frau, die ich meine, gehörte zu einer Art von Frauen, die offenbar für mich eine gewisse Vorliebe hegen, und ich will gleich bekennen, dass ich diese Vorliebe erwidere. Es sind dies nicht die mütterlichen Frauen, ich habe gewiss nichts gegen sie und bin der Letzte, der den Segen bestreitet, den sie unermüdlich um sich streuen, aber ich bin zeit meines Lebens ohne sie ausgekommen. Es sind dies auch nicht die jungen Mädchen, zahllos in ihren Abarten wie die Blumen, die man ja ebenfalls in zunehmendem Alter immer mehr schätzen lernt. Ich meine vielmehr einen Typ Frauen, den jeder Mann unserer Zeit wohl zu beachten Anlass finden sollte. Nun werden Typen bekanntlich in Serien hergestellt, welches Verfahren recht eigentlich eine Erfindung unseres Jahrhunderts ist. Und wirklich ist dieser Typ Frauen auch erst in unserem Jahrhundert entstanden, wobei ich gleich hinzufügen möchte, dass ich noch keinen Typ Mann gefunden habe, von dem ich das Gleiche behaupten könnte.
Es ist dies eine ganze Generation jener jungen Mädchen von damals, die etwa um die Jahrhundertwende, etwa zur Zeit meiner Geburt, sich aufmachten, gegen eine Welt von Vorurteilen die politischen, ökonomischen und sittlichen Rechte ihres Geschlechtes durchzusetzen, und heute grauhaarig und derbsohlig, in schlichtem Kleid, nur um den Hals noch ein bisschen was Freundliches, und mit einem formlosen, aber eigenwillig aufgestülpten Filz auf dem klugen Kopf, unerschütterlich dahinstapfen und nach wie vor unsichtbar das Banner unseres Jahrhunderts schwingen. Sie sind just die rechten Personen, um an den Kreuzwegen des Lebens zu stehen und die armen, fahrenden Ritter unserer Zeit an den Rockschößen zu packen und ins rechte Gleis zu bringen.
Allen diesen Frauen ist gemeinsam, dass sie einmal unvermutet aus ihrer gesitteten und gesicherten bürgerlichen Umwelt aufbrachen, weil sie, die Nase kühn im Wind, gerochen hatten, dass sich unter der Kruste der Gesellschaft Dinge anbahnten, denen es galt, einmal gewachsen zu sein. Manchmal war der Absprung abstrus, oft warfen sie zuerst das Herz über die Hürden, zugebend, dass der Kopf dabei bedenklich wackelte, aber fast alle landeten sie sicher vermöge ihrer ausgezeichneten Eigenschaft, mit Entschlossenheit den Zipfel zu fassen, wenn Gottes Mantel vorüberweht, und die Dinge mit Humor zu betrachten, wenn weit und breit von Gott und seinem Mantel nicht die Rede ist.
Eine von ihnen war Fräulein Dr. Querfeldt. Ich weiß nicht, was sie bewogen haben mochte, seinerzeit nach Paris zu gehen, um dort auf Leinewände, ebenso jungfräulich wie sie selber, mit teueren Farben Blumen und ein Stück Käse nebst einem Hummer neben einem Weinglas aufzutragen. So harmlos auch die Auswirkungen ihres Tuns gewesen sein mögen, deren Beginn stand sicherlich unter dem Zeichen heftiger häuslicher Wirbel voller Muttertränen und des Vatergedonners: «Was werden die Leute dazu sagen?» Der Umstand, dass Fräulein Querfeldt sich nicht daran kehrte, was die Leute dazu sagten, ist gar nicht hoch genug zu werten. Damals sagten alle Leute das Gleiche, nämlich, dass es kein gutes Ende nehmen werde mit Fräulein Querfeldt; aber die Leute sagten auch, es sei im zwanzigsten Jahrhundert ganz unmöglich, dass ein Krieg ausbrechen könne.
Der Krieg brach aus – nicht der erste im zwanzigsten Jahrhundert und auch nicht der letzte –, und Fräulein Querfeldt beschloss, jede Art von Stillleben aufzugeben, was zweifellos nur als ein gutes Ende zu bezeichnen ist. Sie marschierte von Paris aus, zu Fuß, mitten durch die kämpfenden Armeen und schlug sich zu den deutschen Truppen durch. Gottes Mantel hatte, in vielen Formen flatternd, hier die Gestalt der Zelthülle eines Feldlazarettes. Fräulein Querfeldt diente vier Jahre lang als Hilfsschwester, und als der Krieg zu Ende war, hatte sie andere Verwendungen für Leinewände kennengelernt, als sie in Paris je für möglich gehalten hatte. Sie holte ihr Abitur nach und begann, Medizin zu studieren. Als ich ihr begegnete, war sie Dr. med., Oberärztin, grauhaarig und derbsohlig im schlichten Kleid, nur um den Hals noch ein bisschen was Freundliches, und stand an der Ecke, die für meinen Weg entscheidend war.
Ich hatte keine Ahnung, dass da eine Ecke war. Ich war in diesem Augenblick gerade von dem kleinen Glück erfüllt, vorzufahren. Es war schon immer der Höhepunkt meiner knabenhaften Träume, im Fond eines Wagens, lässig zurückgelehnt, auf einem sorgsam mit Kies bestreuten Parkwege unter hohen Bäumen dahinzufahren, bis der Wagen mit einem kleinen, behaglichen Ruck an der Terrasse hielt.
Der Wagen hielt, und auf der Terrasse stand, grauhaarig und derbsohlig, das Schicksal selbst.
«Guten Morgen», sagte das Schicksal mit rauer Stimme, «Sie wohnen nicht im Haupthaus, sondern in der Arztvilla.»
Ich sprang aus dem Wagen. Da stand ich nun, mager, mittelgroß, sechsundzwanzig Jahre alt und von dem lästigen Bewusstsein erfüllt, nicht richtig angezogen zu sein, und tat alles, was ich mir nicht zu tun vorgenommen hatte. Ich machte eine Verbeugung, die «knapp» war, indem ich die Hacken zusammenschlug, und ich nannte, als ich meinen Namen nannte, meinen vollen Namen mit allem Zubehör.
«Querfeldt», sagte die raue Stimme, «kommen Sie rein!» Ein paar Stufen führten zu einem kleinen, für Landhäuser geeigneten Eingang. Vor der verschlossenen Tür blieb ich stehen und dachte: «Das ist die Arztvilla, nicht das Haupthaus, ich scheine doch kein schwerer Fall zu sein.» Fräulein Dr. Querfeldt kam die Stufen hoch und zögerte, als sie mich zögern sah. Dann sagte sie: «Ach so», nichts weiter als das, sie machte die Tür auf, und ich ging durch die Tür, im gleichen Augenblick bedenkend, dass ich ihr den Vortritt hätte lassen sollen, aber ich kam gar nicht dazu, dem Gedanken, dass ich an diesem Tage verdammt sei, wieder alles falsch zu machen, weiter nachzuhängen, denn ich musste mich in dem kleinen, dämmerigen Vorraum einer verwirrenden Menge von Menschen bekannt machen.
Ich weiß nicht, wie es anderen ergeht, aber mir ist der fatale Augenblick wohlbekannt, an dem ich merke, dass mir trotz der besten Vorsätze alles danebengerät. Ich hätte mich gar nicht schlechter einführen können, als ich es tat, in diesem Hause, in welchem ich den größten Wert darauf legen musste, mich möglichst unauffällig und normal zu benehmen. Ich hatte von einem Sanatorium für Nervenkranke durchaus die landläufige Vorstellung, es sei nichts anderes als eine Art Irrenanstalt für reiche Verrückte, und wenn ich auch sicherlich nicht zu befürchten hatte, ich werde beim geringsten Verstoß gegen Anstand und Sitte in die Zwangsjacke gesteckt und ins «Haupthaus» übergeführt, so war ich mir doch bewusst, als ich beim Mittagessen nicht weniger als drei Gläser hinter meinem Teller stehen sah, wie sehr wichtig es sein musste, das richtige mit dem richtigen Getränk zu füllen. Ich vermochte mir sehr wohl auszumalen, dass es der ärztlichen Gewissenhaftigkeit ganz bedeutend mehr auf Fakten ankommen musste als auf Meinungen. Niemals konnte ich imstande sein, mit Worten begreiflich zu machen, dass ich so weit ganz gesund sei, und wenn ich mit Engelszungen redete; ich konnte es nur immer schlimmer machen. Jeder der Anwesenden musste ja wissen, was mit mir los war, die stattliche, dunkle Dame mit dem resoluten Wesen, die von den anderen mit «Frau Sanitätsrat» angeredet wurde, ihre Tochter, das auffallend hübsche Mädchen mit den gesunden Farben an ihrer Seite, ihr Sohn, der gebräunte junge Mann im Rock aus rauem, flauschigem Stoff, einem wahren Traum von Rock, ganz gewiss Fräulein Dr. Querfeldt, die neben mir saß und mich zuweilen mit einem Blick bedachte, den ich «forschend» zu nennen beschloss, und die anderen Herrschaften, deren Namen ich nicht verstand und die in irgendwelchen vertrackten Beziehungen zu dem Hause standen. Alle waren offenbar sehr vertraut miteinander und sprachen über Dinge, die ihnen vertraut waren: Wenn sie aber mit mir sprachen, etwa über die Eigenschaften des neuen Wagens, der mich hergebracht hatte, hütete ich mich wohl, irgendetwas anderes auszusagen als ganz unverbindlich, dass er sehr hübsch sei, mir gefalle er wenigstens. Ganz sicherlich hätte auch nur der kleinste Hinweis auf den kleinen, behaglichen Ruck nur äußerstes Befremden erregt.
So schwieg ich beharrlich still, und als direkt nach der Suppe ein junges Mädchen eintrat, das ich noch nicht kannte, erhob ich mich, wie es die Sitte erheischt, und stellte mich ihr mit einer Verbeugung vor, die «knapp» war, indem ich die Hacken zusammenschlug und ihr meinen Namen nannte mit allem Zubehör.
«Das ist unsere Louise», sagte Fräulein Dr. Querfeldt unnachsichtlich, indes Fräulein Louise einigermaßen verwirrt sich daran machte, die Suppenteller abzuräumen, und die Frau Sanitätsrat keine Sekunde aufhörte, sich über das Muster eines demnächst zu kaufenden Möbelstoffes auszulassen. Aber ich konnte doch nicht wissen, dass Louise das Serviermädchen war. Ich konnte nicht wissen, auf welch verwirrende Art man Artischocken isst und dass von einem Manne von Kultur verlangt wird, sie sollen ihm auch noch schmecken, ich konnte nicht wissen, dass Petersilie nur zur Garnierung dient, und wenn bei den Gläsern mehrere Teller zugleich dagestanden hätten, wäre weniger Anlass für mich gewesen, mir gleich beim ersten Gericht das Gereichte derart zu häufen. Das alles konnte ich nicht wissen, und ich beschloss unter dem forschenden Blick des Fräulein Dr. Querfeldt, diese Tatsache zum Ausgangspunkt meines Unternehmens gegen sie zu machen.
Später, in der Bibliothek – dort wurde der Kaffee gereicht –, wappnete ich mich, sobald sich die anderen nach einigem Geplauder gewissermaßen unauffällig entfernt hatten, gegen die zu erwartende, verzweiflungsvoll salbige Doktorfrage: «Na, wo fehlt’s denn?», welche den Patienten sofort in die schlechte Position versetzt. Aber Fräulein Dr. Querfeldt saß schweigend am Kamin und rauchte eine Zigarette. Ich reichte ihr den Aschenbecher, und sie sagte: «Das ist eine Sèvres-Schale, ein sehr kostbares Stück und nur zum Ansehen da.»
Ich gedachte sofort, bis zum Mittelpunkt der Angelegenheit vorzudringen, und sagte: «Das kann ich nicht wissen. Ich möchte Ihnen gleich sagen, dass alles, was Ihnen vielleicht aufgefallen sein mag, als Sie mich forschend beobachteten, sehr einfache Gründe hat. Einer davon ist, dass ich das meiste wirklich nicht wissen kann.»
Fräulein Dr. Querfeldt klopfte ihre Zigarette in die Sèvres-Schale ab und sagte: «Bedauern Sie das nicht! Das Ding da als Aschenbecher zu benützen, dünkt mich zum Beispiel ein ganz sinnvoller Gedanke.»
Ich sagte: «Versuchen Sie bitte nicht, hinter allem, was ich tue, besondere Ursachen aufzuspüren. Ich bemühe mich natürlich immer, das Normale zu tun. Aber ich kann einfach nicht immer wissen, was das Normale ist. Artischocken, oder wie die Dinger heißen, wurden an meiner Wiege nicht gesungen, Petersilie habe ich sonst immer klein geschnitten gegessen, wahrscheinlich esse ich überhaupt zu viel für Ihren Geschmack, aber für meinen Geschmack eben nicht. Und wenn ich drei Gläser hinter meinem Teller finde, so ist das für Sie vielleicht selbstverständlich, für mich ist die Wahl das Produkt ernsthafter Überlegungen.»
«Sie haben immer das größte genommen», sagte Fräulein Dr. Querfeldt.
«Ja», sagte ich, «da wären wir bei der Hauptsache. Ich bin hierhergekommen, weil die Leute, die ich für wohlmeinend halte, mir geraten haben, dies zu tun. Sie fürchteten für meine Gesundheit, über deren Zustand ich kein Urteil habe. Da ich nun einmal hier bin, wäre es töricht, mich Ihren Anweisungen zu widersetzen. Heilen Sie mich, wenn Sie mich für krank halten, versuchen Sie alles, was Ihnen dazu richtig dünkt. Aber bitte glauben Sie mir, es hat gar keinen Zweck, mir den Alkohol zu verbieten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass dies ganz sinnlos ist.»
Fräulein Dr. Querfeldt stand auf. «Alkohol ist ein schreckliches Wort», sagte sie. «Wie kann man eine Sache, die mit zu den besten des Lebens gehört, so hässlich benennen!»
Sie ging zu einem Schrank und schloss ihn auf. Sie sagte: «Dies ist der Likörschrank der Frau Sanitätsrat, kommen Sie mal her!»
Im Schrank stand Flasche an Flasche, Flasche stand neben Flasche, schlank stand neben bauchig, eckig neben barock-geschweift.
«Da stehen Gläser», sagte Fräulein Dr. Querfeldt, «mögen Sie einen Kirsch?»
«Natürlich», sagte ich, «ich hatte einen Freund, dessen Großvater ein Schwarzwälder Bauer war. Einmal machte mein Freund eine Fußwanderung durch den winterlichen Schwarzwald. Als er zum Hause seines Großvaters kam, stand der Alte vor der Tür und fragte: ‹Magst’n Kirsch?› – ‹Ja›, sagte mein Freund, mit den Füßen stampfend, ‹es ist kalt heut, Großvater!› Da sagte der Alte: ‹Ha no, mir trinke den Kirsch net wegen der Kält’, mir trinke ihn aus Wolluscht!›»
«Prost auf den alten Schwarzwälder», sagte Fräulein Dr. Querfeldt, «übrigens ist der Marie-Brizard da auch nicht übel!»
Der Marie-Brizard war ausgezeichnet. Es war eine Batterie der edelsten Getränke, reine, wasserklar gebrannte und getönte, würzige aus öligen Kräutern und duftenden Früchten. Wir probierten sie alle durch und waren uns vollkommen darüber einig, dass hintereinander etwas vollkommen anderes sei als durcheinander, dass die neumodische Sitte der Cocktails nichts anderes darstelle als eine bedauernswerte Barbarei, dass der Wermut nicht in die Reihe ernsthafter Getränke gehöre, dass der faulige Geschmack des Genever nicht dazu verleiten dürfe, ihn zu verachten, und dass der Soda dem Whisky gerade das Köstlichste nehme, den leichten, rauchigen Nebel, der die Glut wie die Kälte gleichermaßen überwindet, sodass dies einzigartige Getränk am Nordpol wie am Äquator erfrischend wirke.
«Von diesen Dingen wissen Sie wirklich was», sagte Fräulein Dr. Querfeldt bewundernd.
Ich blickte sie misstrauisch an, aber sie sah keineswegs forschend drein.
Ich sagte: «Sie müssen nicht denken, dass ich trinke, um mich zu besaufen!»
«’türlich nicht», sagte sie, «wir trinken aus Wolluscht.»
«’türlich», sagte ich, «und es bekommt mir sehr gut.»
«Keine Nebenwirkungen?», fragte sie und goss sich einen Cointreau ein.
Aber ich war auf der Hut.
«Nein, Fräulein Doktor», sagte ich, «noch niemals weiße Mäuse gesehen. Keine Spur von Träumen dieser Art.»
«Kenn ich», sagte sie mit plötzlichem Eifer, indem sie mit der einen Hand meinen Arm umklammerte und mit der anderen nach der Ginflasche griff. «Kenn ich», sagte sie bekräftigend, «fallen um wie tot, wie?»
«Im Gegenteil», sagte ich und hielt das Glas, an dem der Hals der Ginflasche klapperte. «Im Gegenteil», sagte ich, «wach wie die Sünde. Kann nachts nicht schlafen, so viel ich auch trinke.»
«Nachts nicht schlafen», rief Fräulein Dr. Querfeldt entsetzt. Sie richtete sich an meinem Arm auf, blickte mich strenge an und sagte eruptiv: «Milch!»
Eilfertig rief ich: «Sofort, Fräulein Doktor, ich hole gleich die Louise.» Aber Fräulein Dr. Querfeldt hielt mich zurück. Sie sagte mühsam: «Milch! Bestes Mittel gegen Schlaflosigkeit!»
Ich sagte beruhigend: «Ja, ja!»
Aber sie schüttelte mich beschwörend: «Bei jedem Aufwachen ein Glas!»
«Ja, ja!», rief ich, «nehmen Sie ein Glas Fernet Branca, bestes Mittel gegen Übelkeit!»
Sie nahm gehorsam einen Fernet Branca, schüttelte sich nach der unvermittelten Bitterkeit dieser köstlichsten aller Medizinen, sah mich forschend an und beharrte: «Nicht vergessen! Nerven in Fett packen! Immer Milch! Können trinken, so viel Sie wollen! Aber immer Milch! Hinter jedem Glas, Wein, Bier oder …» sie machte eine vage, aber umfassende Bewegung über den ganzen Schrank.
Ich drückte ihren Arm und rief: «Ja, ja, aber wollen Sie sich nicht setzen?»
Sie schüttelte den Kopf: «Ärztliche Verordnung!», sagte sie und setzte hinzu, indem sie mit ihrer freien Hand in Richtung meiner Hand tastete:
«Versprochen?»
«Ja doch», rief ich verzweifelt, «versprochen!»
Sie setzte sich augenblicklich und murmelte: «Schmeckt wie … wie … Nuss!»
Fräulein Louise half mir, Fräulein Doktor nach oben zu bringen.
Beim Abendessen erschien Fräulein Doktor nicht. Aber Louise stellte mir neben meine Gläser eine Kanne mit Milch. Ich trank gehorsam nach jedem Glase Wein von der Milch. Die Milch schmeckte wirklich wie Nuss.
«Fräulein Doktor ist unpässlich», erklärte die Frau Sanitätsrat. «Sie lässt sich entschuldigen.»
Ich fragte, ernstlich besorgt: «Ist es ihr nicht bekommen?»
«Was?», fragte Frau Sanitätsrat.
Ich sagte: «Der Schnaps.»
Alle sahen mich an.
Die Frau Sanitätsrat sagte mit ruhiger Bestimmtheit: «Fräulein Doktor Querfeldt trinkt niemals einen Tropfen Alkohol.»
Abends fand ich eine Kanne Milch auf meinem Nachttisch. Ich ging lange hin und her, wie es meine Gewohnheit war, immer sechs Schritt hin und sechs Schritt her. Endlich trank ich Milch und schlief nach langer Zeit zum ersten Male wieder fest.
Wer einmal hinter einer von der Weide in den Stall wandelnden Kuhherde gegangen ist, wird die Gefühle verstehen, die mich die nächsten Wochen erfüllten. Ich war gewissermaßen in Milchdunst eingehüllt. Wo ich ging und stand, war auch Louise, steifgestärkt und mit einem bauchigen Krug voll frischer, schäumender, noch warmer Vollmilch. Ich war der Milch preisgegeben, ohne auch nur die Geste einer Auflehnung zu besitzen, seit Fräulein Dr. Querfeldt, als sie wieder zum Essen erschien, angesichts des Milchglases neben meinem Teller, mit einer noch etwas raueren Stimme als gewöhnlich sagte: «Ich wusste, dass Sie kein Spielverderber sind!»
Ich trug also diese Bemerkung wie eine Auszeichnung, entschlossen, Milch zu trinken, wie jemand, der ein Bändchen an der Brust trägt, nun sein Leben lang ein Held zu sein gehalten ist. Die Milch verhielt sich wirklich zu den scharfen Getränken wie der Ruhm zu den Heldentaten. Sie tötete nicht den Genuss an edleren Flüssigkeiten, sondern nur die Begierde nach ihnen.
Fräulein Dr. Querfeldt hatte hinfort nicht mehr viel Zeit, sich mit mir besonders abzugeben. Sie hatte in jenen Tagen viel im «Haupthaus» zu tun, und ich sah sie eigentlich nur beim Frühstück, wo sie mir gegenübersaß und forschenden Blicks zu beobachten pflegte, wie ich jeden Morgen eine neue Methode ausprobierte, mein Frühstücksei zu verspeisen, ohne dass es kleckerte. Da auch die anderen Bewohner des Hauses sich nicht sonderlich um mich kümmerten, schlenderte ich ziellos umher oder saß in der Bibliothek, wo ich las oder Patiencen legte. Es waren nicht viel Bücher in der Bibliothek, meist nur medizinische Werke und die dicken Bände eines Konversationslexikons, die mir bislang immer noch die erlesenste Lektüre boten. Die Zeitungen las ich Wort für Wort, vom Titel bis zum Impressum, einschließlich des Handels- und Inseratenteils. Ich ging im Park spazieren und auf der Landstraße, die am Park entlangführte. Das Sanatorium lag in der Nähe einer kleinen ostholsteinischen Landstadt, und seine Umgebung bot wenig Gelegenheit zu aufregenden Ausblicken, sodass ich auf meinen Wegen allein mit meinen Gedanken war, was unter den Umständen, denen ich damals unterworfen war, nicht unbedingt eine erfreuliche Gemütsverfassung erzeugte, außer wenn ich mich mit dem kleinen, behaglichen Ruck befasste, der schließlich den einzigen Anteil darstellte, den ich jemals am Besitz hatte.
Natürlich hoffte ich damals, allmählich diesen Anteil etwas zu vergrößern. Wohin ich schaute, alles war Besitz, alles, was ich sah oder anfasste, gehörte jemandem, wenn auch damals schon meist nicht dem, der darauf Anspruch erhob. Ich hingegen wandelte auf leichten Sohlen und mit leichtestem Gepäck, ein Zustand, den zu ändern ich mehr Einsicht als Gelegenheit besaß.
Meine Faulheit hatte die anstrengendste Form angenommen, mit der sie verflucht werden konnte: Ich tat nichts, mit der Sehnsucht, etwas zu tun. Und dies tat ich, wie alles, was ich tat, Essen, Trinken, Rauchen und Patience-Legen, bis zu einem Zustand der Betäubung, der mich weder vor- noch nachdenken ließ und der mich schließlich in die Küche der Arzt-Villa führte, wo Louise, nun über dem steifgestärkten Rock eine blaue Schürze, vor dem Spülbecken stand.
Ich bat sie, ihr beim Geschirrabtrocknen helfen zu dürfen, ein Ansinnen, welches sie so verletzt haben musste, dass sie Fräulein Dr. Querfeldt davon Mitteilung zu machen Veranlassung fand.
Als nach dem Essen in der Bibliothek Fräulein Dr. Querfeldt die Sèvres-Schale zu sich heranzog, um die Asche ihrer Zigarette abzustäuben, war mir klar, dass wieder das Schicksal grauhaarig und derbsohlig an der Ecke lauerte, unentrinnbar wie der Milchkrug, den Louise vorsorglich neben mich auf das Rauchtischchen gestellt hatte. Aber da das, was mich in diesem Falle bedrückte, keinerlei Bezug zum medizinischen Bereich haben konnte, hatte ich keine Hemmungen, Fräulein Dr. Querfeldt meinen Zustand darzulegen, in der leisen Vorfreude, auch dieses so selbstsichere Wesen einmal ratlos zu sehen.
Ich erzählte Fräulein Dr. Querfeldt alles, stellte ihr meine Lage offen dar, berichtete ihr von den kühnen Vortrupps meiner Hoffnungen, der marodierenden Meute meiner Zweifel und scheute mich schließlich sogar nicht, die Sache mit dem kleinen, behaglichen Ruck wenigstens andeutungsweise zu streifen.
Fräulein Dr. Querfeldt sah mich die ganze Zeit über nachdenklich an und sagte endlich mit rauer Stimme:
«Sie sind ein typischer Fall von Beschäftigungsneurose!»
Ich kann gar nicht ausdrücken, wie mich das erleichterte. Was mich beunruhigte, war also gar nichts Besonderes, es war typisch, es war einordbar, medizinisch zu erfassen und also auch medizinisch zu beheben. Die Diagnose leuchtete ein, und ich trank voll Befriedigung ein Glas Milch in Erwartung der Therapie.
Fräulein Dr. Querfeldt zögerte keinen Augenblick. «Haben Sie», fragte sie in einer Art, die mir von Hohn nicht frei zu sein schien, «haben Sie», fragte sie, «schon einmal an die Möglichkeit gedacht, ernsthaft zu arbeiten?»
«Gewiss», sagte ich eilfertig, «aber Louise war dagegen.»
«Seien Sie nicht albern», sagte Fräulein Dr. Querfeldt, «haben Sie überhaupt schon einmal im Leben ernsthaft gearbeitet?»
Aber damit konnte ich dienen. Wenn ich einen Augenblick schwieg, so nur, weil ich gezwungen war, die Fülle der Tätigkeiten, denen ich schon obgelegen, zu sammeln, zu sichten und zu ordnen.
«Ich habe», sagte ich voller Eifer, «Tüten geklebt, Netze gestrickt, Bast geflochten …»
«Das meine ich nicht», sagte Fräulein Dr. Querfeldt.
«Ich habe», sagte ich, um mit wohlgefälligeren Dingen aufzuwarten, «Hammerstiele gehobelt, Filzschuhe genäht, Betttücher gesäumt …»
Fräulein Dr. Querfeldt wiederholte mit rauer Stimme, mich beziehungsreich anblickend, «Betttücher gesäumt!!!», erhob sich und ließ mich in einem Wald voller Ausrufezeichen allein.
Am nächsten Tage bat mich Fräulein Dr. Querfeldt in die Veranda. Die Veranda war ausgeräumt, statt der gewohnten Gegenstände waren sechs Nähmaschinen in einer Reihe untergebracht, an die sich soeben fünf etwas verlegen dreinschauende junge Mädchen aus der kleinen, nahegelegenen Stadt niederließen. An die sechste Maschine führte Fräulein Dr. Querfeldt mich und sagte: «Die Frau Sanitätsrat hat eine Inventur angeordnet. Hier werden Betttücher gesäumt. Sie können doch Betttücher säumen?»
Und ob ich das konnte! Ich säumte acht Tage lang Betttücher. Es waren Betttücher in Mengen, die ich kaum für möglich gehalten hätte, ein ganzes Depot von Betttüchern aus allerfeinstem Leinen, sodass ich es nur als Linnen zu bezeichnen wagte, wie es etwa noch zu unserer Großmütter Zeiten hergestellt wurde, alle nun schon durch den langen Gebrauch ein klein wenig fadenscheinig, immer neue Körbe voll Betttücher, und ich säumte sie, wie ich es gelernt hatte, sorgsam und die Säume in einem Zuge herunterratternd, nicht etwa grob und mit langem Faden, sondern hübsch mit kleinem, regelmäßigem Stich, unter Verschleiß einer großen Anzahl von Nadeln und feinstem 44er Zwirn. Da ich die Gesellschaft junger, hübscher und verlegen kichernder Landmädchen aus begreiflichen Gründen nicht gewohnt war, saß ich schweigsam und verbissen an der Maschine und arbeitete, wie ich es gewohnt war, sozusagen in einem weg, mich nur von Zeit zu Zeit aus dem von der schnippisch blickenden Louise gereichten Milchkrug labend. Nach acht Tagen waren die so unerschöpflich scheinenden Bestände an Betttüchern aufgearbeitet, und die Mädchen sowohl als auch ich wurden mit dem ortsüblichen Lohn ausgezahlt.
Am Abend dieses Tages setzte die Frau Sanitätsrat zur Feier meines ersten selbstverdienten Geldes eine Ananas-Bowle an, die am Kamin getrunken wurde. Fräulein Dr. Querfeldt, die es nicht verabsäumt hatte, meine Säume sachverständig zu prüfen, entband mich für diesen Abend von meinem Versprechen, hinter jedem Glas Bowle ein Glas Milch zu trinken, und ich genoss dies ebenso wie die im Glase zurückbleibenden Früchte, die ich sorgsam auslöffelte. Unter großem, allseitigem Gelächter wurde Fräulein Dr. Querfeldt bewogen, wenigstens ein wenig von der Bowle zu nippen, was sie auch tat, als ich sie aufforderte, kein Spielverderber zu sein. Sie streifte ihre Asche in die Sèvres-Schale, wippte mit den derbbeschuhten Beinen und begann, überaus angeregt, aus ihrem Leben zu erzählen. Auch ich begann, aus meinem Leben zu erzählen, wir erzählten um die Wette, und als ich endlich schwieg, sagte Fräulein Dr. Querfeldt, was sie medizinisch eigentlich am meisten interessiere, sei der erste Zusammenprall eines Menschen, der jahrelang völlig abgeschlossen gelebt habe, mit der freien Welt. Ich sollte doch einmal, sagte sie, den ersten Tag der Freiheit schildern, den ganzen Tag in seinem genauen zeitlichen Ablauf, von der Sekunde des Erwachens bis zum Einschlafen.
«Fünf Jahre lang», sagte ich, «hatte ich jeden Morgen dasselbe Gefühl: Dies ist der trübseligste, hoffnungsloseste und düsterste Tag, den ich erleben kann. Fünf Jahre lang», sagte ich, «hatte jeder Tag nur dadurch seinen Sinn, dass er vorüberging, war jeder Tag nur ein Schritt zum ersten Tage der Freiheit. Fünf Jahre lang kreisten meine Gedanken um diesen ersten Tag, um die ersten vierundzwanzig Stunden und ihren unsagbaren Gehalt an Sonne, Weite und Leben …»
Als ich wieder schwieg, war das Feuer im Kamin niedergebrannt, die Bowle mitsamt den Ananas-Stückchen leer, die Sèvres-Schale voll und Fräulein Dr. Querfeldt übermüdet und wünschte, schlafen zu gehen. Da ich an diesem Abend von der Milch dispensiert war, ging ich in meinem Zimmer noch lange hin und her, immer sechs Schritte, wie ich es gewohnt war, und bedachte voll peinlicher Verlegenheit, dass ich mich wieder einmal zu wichtig genommen hatte. Ich wusste wohl, dass diese beklagenswerte Neigung eine unmittelbare Folge meiner Haft sein musste. Wer jahrelang absoluter Mittelpunkt seiner Welt zu sein gezwungen ist, erfährt an sich andere Wirkungen, als sie der philanthropische Gedanke des modernen Strafvollzuges mit unmodernen Mitteln zum Zwecke der Erziehung in Rechnung gestellt hatte. Ich hatte Gelegenheit, mich jahrelang als Fachmann im Gefängniswesen auszubilden, nicht nur lernend, sondern auch forschend, ich hatte lange Zeit als sogenannter Bibliothekskalfaktor die Beamtenbibliothek zu verwalten und saß von morgens bis abends in dem kleinen, mit langen Reihen der grünen, noch unaufgeschnittenen Hefte des Essener Gefängnisvereins angefüllten Zellenraum und wartete darauf, dass sich ein Beamter eine für sein fachliches Fortkommen wichtige Lektüre entlieh. Es kam aber keiner, wenn ich von dem einen oder anderen absehe, der sich für Wulffens «Sexual-Verbrechen» interessierte. Ich nahm also eine Fülle von Kenntnissen über das Thema der Rückführung des Gefangenen in die geordnete bürgerliche Welt mit ins Leben, nebst dem eisernen Vorsatz, mich von keiner Macht in der Welt bewegen zu lassen, jemals von den Einrichtungen des Essener Gefängnisvereins Gebrauch zu machen.
Allen Koryphäen der menschenfreundlichen Wissenschaft vom Gefängniswesen und der Gefangenenfürsorge war das Axiom gemeinsam, dass der entlassene Gefangene strengstens davor zu behüten sei, mit dem Makel seiner Strafe von der Öffentlichkeit gebrandmarkt zu werden; kein Schatten sollte tunlichst auf seinem weiteren, beschwerlichen Lebensweg lasten, und der Ermahnungen waren viele, von der Tatsache betrüblicher Vorstrafen ein Geheimnis zu machen und dies wohlbehütet den Polizei- und Amtsstuben zu überlassen – sei es nun, dass mein Fall seinerzeit schon etwas zu publik geworden war oder dass ganz allgemein die wohlmeinenden Koryphäen in ihren Ansichten über die moralische Reflexion der anteilnehmenden Umwelt einem Irrtum anheimgefallen waren: Ich wurde jedenfalls verdrießlich oft, hinreichend eindringlich und im Ganzen keineswegs unfreundlich aufgefordert, von meinen Erlebnissen zu berichten, und wenn ich mich allmählich immer mehr scheute, dies zu tun, so geschah dies nicht so sehr, weil ich fürchtete, auf dem Pfade der bürgerlichen Lebensführung einen Schaden zu erleiden, als vielmehr, weil ich sehr wohl wusste, wie wenig ich noch mit den Dingen fertig geworden war, und weil die Gefahr bestand, mich in die Neigung zu verlieren, Mittelpunkt eines Interesses zu sein, das keinesfalls auf mein Verdienst zurückgeführt werden konnte.
Freilich geschah dies alles zu einer Zeit, da es durchaus ungewöhnlich war, sich einer mehrjährigen Haft rühmen zu können. Heute mag die ganze Problematik meiner Lage höchst unverständlich erscheinen, da eine kleine Umfrage in jeder beliebigen Gesellschaft unseres Vaterlandes zu dem erheiternden Resultat führt, dass jedermann, ob Mann oder Frau, jung oder alt, schon einmal gesessen hat – und sollte sich doch der eine oder andere darunter befinden, der dies von sich nicht zu bekennen wüsste, so mag doch ohne Zweifel an seinem verlegenen Gebaren die Scham dieses offensichtlichen Mankos ebenso wohl abzulesen sein wie der feste Wille, ihm baldmöglichst abzuhelfen.
Als mich am nächsten Morgen Fräulein Dr. Querfeldt mit rauer Stimme und anmutiger Beiläufigkeit fragte, ob ich auf der Schreibmaschine schreiben könne, wusste ich sogleich, was die Glocke geschlagen hatte. Ich verneinte, und Fräulein Dr. Querfeldt forderte mich im Zuge ihrer ärztlichen Verordnungen auf, dies zu lernen. Sie zeigte mir, wie ihre kleine Reiseschreibmaschine zu bedienen sei, und sagte, es sei wohl am zweckdienlichsten, wenn ich meinen Übungen einen Text unterlegte. Mit unbeschreiblicher List lenkte sie meine Aufmerksamkeit auf das, was ich am Abend vorher erzählt hatte, und riet mir, es so zu schreiben, wie ich es erzählte. Ich machte mich voll Eifer daran, ein möglichst sauberes Manuskript zu liefern, wobei mir die meiste Beschwer die Notwendigkeit machte, den Umschalthebel zur rechten Zeit und am rechten Ort niederzudrücken. Ich wandte drei Tage an diese Arbeit, bedeutend mehr mit den Schwierigkeiten der Maschine beschäftigt als mit den Schwierigkeiten, mir irgendetwas «von der Seele» zu schreiben, und lieferte das Manuskript mit berechtigtem Stolze an Fräulein Dr. Querfeldt ab, die es ohne weitere Äußerung durchlas und an sich nahm.
Wiederum einige Tage später fand ich auf dem Frühstückstisch einige Zeitungsexemplare im Streifband und einen Brief. Aus der Art, wie die Frau Sanitätsrat ganze Salven beredter Blicke zu Fräulein Dr. Querfeldt hinüberschoss, entnahm ich den ganzen Umfang des medizinischen Komplotts und machte mich daran, anstatt der ersten Regung nachzugeben und mich in hastiger Freude auf meine Post zu stürzen, nunmehr unter kleinen, neckischen Ausrufen, wie «Ei, wer mag mir denn das geschickt haben?» und «Sicherlich ist das ein Irrtum», das Streifband zu entfernen, gleichzeitig vor Furcht fast bebend, dass es tatsächlich ein Irrtum sei. Dann riss ich den Brief auf, las ihn und reichte ihn Fräulein Dr. Querfeldt, indes sich die Frau Sanitätsrat aufgeräumt und heiter der Zeitungen bemächtigte. Es waren Belegexemplare der DAZ mit dem Artikel «Der erste Tag», und der Brief stammte von dem Feuilleton-Redakteur dieser Zeitung, Paul Fechter, der Interesse für weitere Artikel zeigte, nur nicht mehr für solche aus der Zuchthauszeit, und ein Honorar von 150.– Mark ankündigte.
Die Frau Sanitätsrat begann sogleich, nachdem auch sie von dem Brief Kenntnis genommen hatte, zu rechnen: drei Tage hatte ich für den Artikel gebraucht, das machten im Monat zehn Artikel und ein Einkommen von 1500,– Mark: «Reinverdienst», sagte sie voll Begeisterung, «ohne Kapitalinvestition», und fügte träumerisch hinzu: «Das ist ein Beruf!»
Sie war ohne weiteres bereit, abends wieder eine Bowle anzusetzen.
Fräulein Dr. Querfeldt hingegen schaute still forschend zu, wie ich mich, ohne in die fröhliche Rechnung der Frau Sanitätsrat einzustimmen, mit der Zertrümmerung sämtlicher Schalen und Häute meines Frühstückseis beschäftigte, in der Hoffnung, dass es mir einmal gelingen möge, es ohne Kleckerei zu mir zu nehmen, und sagte schließlich: «Ich fürchte, Sie neigen dazu, die leichten Lösungen zu sehr zu verachten!»
Ich sagte: «Selbstverständlich habe ich mich in der Haft auch sehr eingehend mit meinem späteren Leben in der Freiheit befasst, und wenn dies auch vornehmlich mit der Vorstellung von Beefsteak mit Spiegelei und vielen, leicht gebräunten Zwiebeln verbunden war, so lag doch auch stets der Gedanke nahe, die Möglichkeiten zu erforschen, durch die ich ständig in den Genuss dieses auserlesenen Gerichtes gelangen konnte.»
«Lassen Sie die Ironie», sagte Fräulein Dr. Querfeldt.
Etwas im Ton ihrer Stimme ließ mich aufschauen. Sie blickte mich nicht mehr still forschend an, sondern strenge, mit gerunzelter Stirn.
Ich sagte: «Ironie ist für mich das einzige Mittel gegen vorgefasste Meinungen. Sie haben doch eine vorgefasste Meinung?»
«Die habe ich!», sagte Fräulein Dr. Querfeldt.
«Gut», sagte ich, «nehmen Sie es bitte auch als Ironie, wenn ich sage, wie sehr es mich in der Haft beschäftigte, dass die katholische Kirche auf die Frage: ‹Wozu ist der Mensch auf Erden?› in ihrem kleinen Katechismus die Antwort gibt: ‹Um Gott zu lieben, ihm zu dienen und dadurch in den Himmel zu kommen.› Aber wie sehr ich mich auch in die Tiefen dieser schlichten Feststellung zu versenken versuchte, ich konnte doch den an Kasinoabenden eines bekannten Breslauer Reiterregiments oft zitierten Ausspruch nicht vergessen: ‹Was will der Mensch noch werden außer Kaiser, Papst oder Leibkürassier?› Ich wollte früher einmal Leibkürassier werden.»
Fräulein Dr. Querfeldt schnaubte durch die Nase.
Ich fuhr eilends fort: «Bitte, die Spanne zwischen der äußersten Demut und dem äußersten Hochmut ist groß. Im Aspekt der Zelle aber schränken sich die Möglichkeiten innerhalb dieser Spanne erheblich ein. Für jeden, der die Ordnung liebt, ist das Gefängnis ein durchaus möglicher Ort. Die Ausschließlichkeit der vier nackten Wände zwingt zu einer gewissen Unbedingtheit der Forderungen an sich selber. Zugleich zwingt sie, mit ihren Realitäten fertig zu werden.»
«Sie sind frei!», erinnerte mich Fräulein Dr. Querfeldt.
«Ich bin frei», sagte ich, «und ich habe am ersten Tage in der Freiheit gleich auch die ganze Problematik der Freiheit gespürt. Wenn die Bilanz der Haft mit einem Plus abschließt, dann kann es nur die Konsequenz sein, dass es notwendig ist, in der Welt der Freiheit zu bestehen, ohne sich aufzugeben.»
«Der reine Tor!», sagte Fräulein Dr. Querfeldt.
«Der reine Tor», sagte ich, «unwissend, aber voll der besten Vorsätze, das Gesetz in sich und den gestirnten Himmel über sich und jedenfalls entschlossen, stets so zu handeln, dass die Maximen seines Handelns zu einer allgemeinen Gesetzgebung taugen.»
«Gott bewahre!», rief Fräulein Dr. Querfeldt aus, «das wird doch gar nicht von Ihnen verlangt!»
«Doch, das wird von mir verlangt», sagte ich, «oder Sie verlangen von mir, dass ich das einzige Plus meines Lebens abschreibe. Ich habe nichts weiter gelernt, als Betttücher säumen und Hammerstiele hobeln und, verstehen Sie mich recht, ich habe nichts dagegen, zeit meines Lebens Betttücher zu säumen und Hammerstiele zu hobeln, wenngleich im letzteren Falle schon bei Anwendung von Akazienholz die Grenzen meines Könnens deutlich werden. Betttücher säumen und Hammerstiele hobeln ist eine sehr produktive und notwendige Tätigkeit. Es ist eine wirkliche Funktion, und ich kann es mir nicht vorstellen, dass es eine höhere Forderung gibt, als seine Funktion richtig zu erfüllen.»
«Sehr löblich», erwiderte Fräulein Dr. Querfeldt. «Nur haben Sie eine andere Funktion zu erfüllen!», und setzte verbissen fort: «Schreiben!»
«Das ist eben keine!», rief ich verzweifelt aus. Meine Vorstellung von einem Schriftsteller, so versuchte ich ihr zu erklären, entsprach bislang der von einem besseren älteren Herrn mit Schuppen auf dem Rockkragen und etwas ausgefransten Manschetten, sie war weit entfernt von irgendeiner Ähnlichkeit mit einem Leibkürassier. Das konnte, sagte ich, natürlich kein Einwand sein. Was mich aber bedenklich stimme, sei die schöne Selbstverständlichkeit, mit der die Frau Sanitätsrat und Fräulein Dr. Querfeldt die Schriftstellerei als eine Möglichkeit für jemanden ansehe, der dazu nichts weiter mitbringe als die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können. Lesen und Schreiben hatte ich, wie jedermann, in der Schule gelernt, ohne dass ich etwa im deutschen Aufsatz geradezu atemberaubend brillierte. In der Haft nutzte ich einmal eine günstige Gelegenheit, als mir Papier und Bleistift zur Verfügung stand, ein Tagebuch zu führen, in der Absicht, sogleich zu fixieren, was mich bewegte, in dem Wahn, dies sei der richtige Weg, die wirkliche und wahrhaftige Wahrheit festzunageln. Dies Tagebuch erwies sich später als völlig unlesbar, es war wirr, voller Ressentiments und Überheblichkeiten, es hatte mich noch während der Haft selber dieser Kunstgattung auf ewig entfremdet. Sicherlich konnte jeder, der in der Schule Lesen und Schreiben gelernt hatte, bei dem ungeheuerlichen Bedarf der ständig laufenden Rotationsmaschinen damit rechnen, sich einmal gedruckt zu sehen, wenn er etwas Interessantes zu berichten hatte. Aber was hatte ich denn Interessantes zu berichten? Ich hatte ja nichts erlebt außer der Haft, und hier empfand ich die beiläufige und einschränkende Bemerkung in dem Briefe Paul Fechters als durchaus zu Recht bestehend. Es gab noch die Möglichkeit, ein Leben lang Seite für Seite gegen die Publikationen des Essener Gefängnisvereins zu polemisieren, eine Sache, die durchaus geeignet war, ihren Mann zu ernähren, allein schon der Gedanke daran erweckte in mir die Vorstellung, wie sich Immanuel Kant im Sarge herumdrehe.
«Der erste Tag», rief Fräulein Dr. Querfeldt aus, indes sich die Frau Sanitätsrat indigniert und geräuschvoll entfernte.
Der erste Tag, sagte ich, sei typisch ein Produkt, bei dem sich der Stoff stärker erwiese als der Autor.
Dann solle ich Stoffe wählen, bei denen der Autor stärker sei, forderte Fräulein Dr. Querfeldt kurzerhand, und ich erklärte ihr, dass ich das nicht könne. Sollte ich Memoiren schreiben, trotz Paul Fechter, Memoiren mit sechsundzwanzig Jahren? Auch Memoiren setzten ein langes und tätiges Leben voraus und Dinge in diesem Leben, des Mitteilens wert.
«Die Phantasie!», sagte Fräulein Dr. Querfeldt, und ich sagte, ich besäße keine Phantasie. Das Wenige, was mir davon gegeben war, hätte ich mir in der Zelle abexerziert, als ich merkte, wie sie sich in den entscheidenden Augenblicken in Illusion verwandle. Phantasie, sagte ich verächtlich, sei grundsätzlich ein Ding, das sich vom Leben entferne, und das sei genau das Gegenteil von dem, was ich erwarte.
Fräulein Dr. Querfeldt rang mit mir wie Jakob mit dem Engel. Das Wort «grundsätzlich» könne sie nicht mehr hören, rief sie aus, und wenn ich mir etwas «abzuexerzieren» habe, so sei das der Begriff «abexerzieren». Ich löste, rief sie, mit meiner Auffassung vom Leben das ganze Getriebe der Welt in ein System von unfreundlichen und öden Funktionen auf. Was bleibet aber, rief sie emphatisch, stiften die Dichter!
Das sei möglich, gab ich zu, aber nichts erscheine mir berechtigter als der belustigte Ausdruck eines jeden Hotelportiers, sollte irgendjemand in die Rubrik «Beruf» des Meldezettels die Bezeichnung «Dichter» eintragen, ohne zugleich vor Scham in den Boden zu sinken.
«Das ist ein billiger Einwand», sagte Fräulein Dr. Querfeldt, aber ich meinte, so billig sei er nicht, wenn man bedenke, warum der Ausdruck «Dichter» so kompromittierend sei; stelle er doch einen Anspruch bloß, den jedermann sofort als einen Ausweg erkenne, eine Flucht vor den Wirklichkeiten, die jedermann zu bestehen habe, ein Ausweichen vor dem Leben, in dem Versuch, es zu bespiegeln.
«Das ist absurd», murmelte Fräulein Dr. Querfeldt ermattet. Aber mich hatte das Feuer eines heiligen Zornes gefasst. «Und sie wissen es!», rief ich aus, «sie wissen es, warum versuchen sie es sonst, eine Autokratie des Geistes zu postulieren? Armseliges Surrogat einer Macht für die, welche mit Recht zu anderen Mächten nicht zugelassen sind! Was repräsentieren sie denn», rief ich, «wenn sie sagen, sie repräsentieren die Macht des Geistes? Sie repräsentieren sich selber, weniger als sich selber, das Echo von sich selber! Sie reden von sich selber, sie schreiben von sich selber, sie reden und schreiben für sich selber, alles, was sie reden und schreiben, ist Autobiographie! Von einem aber …», bellte ich und richtete meinen Finger auf Fräulein Dr. Querfeldt, als sei sie an allem schuld, «von einem aber schreiben sie nichts, die sie sonst von allem schreiben, was sie immer nur selber angeht: dass sie kein Recht haben zu dem Anspruch, den sie erheben! Mit all ihrer niederträchtigen Arroganz des Formulieren-Könnens, davon schreiben sie nichts. Aber gerade das müsste einmal geschrieben werden! Gerade das!!»
«So schreiben Sie das doch», schrie Fräulein Dr. Querfeldt verzweifelt.
Sie schlug auf den Tisch und sprang auf. Sie starrte mich erbittert an, schüttelte den Kopf, dass ihre grauen Haare flogen, und stürzte aus dem Zimmer.
Und ich schrieb es. Aber ich hatte die Unschuld des Schreibens verloren. Es war eine einzige Qual. Der Artikel erschien nie, ich vernichtete das Manuskript, nachdem auch die fünfte Fassung verraten hatte, dass ich an Akazienholz geraten war. Fräulein Dr. Querfeldt hat niemals wieder eine Zeile von mir zu Gesicht bekommen. Ich verließ am Tage nach jener Unterhaltung mit ihr das Haus, nachdem das angekündigte Honorar eingetroffen war. Kurze Zeit später starb diese vortreffliche Frau an einer Infektion, die sie sich in ihrem Beruf zugezogen hatte.
Ich bin nun seit zwanzig Jahren Schriftsteller. Die hervorragenden Männer mit dem Donnerkeil der strengen Gewissensforderung mögen mir verzeihen, wenn ich bekenne, dass ich seit zwanzig Jahren gegen die Maßstäbe meiner Einsicht gehandelt habe. Ich habe mir gewisslich in dieser langen Zeit manches «abexerziert», ich stehe zu dem Wort «grundsätzlich» nunmehr ganz ähnlich wie Fräulein Dr. Querfeldt, und ich will ohne weiteres annehmen, dass die Welt nicht nur aus «Funktionen» besteht, wenngleich ich immer noch nicht weiß, aus was sie sich sonst zusammensetzt; jedenfalls lebe ich ohne Funktion. Ich weiß nicht, wie ich damals zu der Formulierung «Autokratie des Geistes» gelangte, wahrscheinlich hatte ich diesen Ausdruck kurz vorher gelesen, und er hatte mir imponiert, womit der verderbliche Charakter der Literatur auch in diesem Punkt deutlich wird. Ich weiß auch nicht mehr, welches Gebaren mich damals verstimmt haben mochte, das feierliche Dichtergehabe unserer trunkenen Künder des Worts oder das verzweifelte Gegacker des schreibenden Hühnervolkes, das hierzulande auf allen Misthaufen scharrt.
Genug, ich bin Schriftsteller geworden. Ich habe unterdessen viele tausend Seiten vollgeschrieben, von denen jede einzelne so oder so autobiographisch war. Wenn ich aber hinter den Sinn meines Tuns zu kommen versuche, so will ich gerne zugeben, dass es mir im Ganzen einen richtigen Spaß gemacht hat – ich lebe davon, dass ich lebe (und je schlechter ich manchmal lebe, desto besser lebe ich dann davon) –, dass es mir aber bislang immer noch nicht gelungen ist, die tiefere Bedeutung meines Tuns zu erfassen; es sei denn, Erbsen gegen eine Wand zu werfen, sei ein bedeutungsvoller Akt. Ich bin ein Kind meiner Zeit und sehe mit Achtung der Möglichkeit ins Auge, dass es auch heute noch erlesene Geister zu geben vermöchte, die wie seinerzeit der Staatsminister Goethe oder der Universitätsprofessor Schiller noch einiges zu sagen haben, was bislang noch nicht gesagt wurde. Mit Achtung auch verfolge ich den zappelnden Eifer meiner Kollegen in Apoll und in Minerva auf den Jahrmärkten der Eitelkeiten unserer Zeit, auf Kongressen und Tagungen das kostbare Gut der Freiheit des Geistes zu verteidigen, und halte mich bereit, mich von diesbezüglichen Resultaten erschüttern zu lassen. Mit Achtung endlich sehe ich dem Zeitpunkt entgegen, da die wirklichen Mächte unserer Welt aufhören, den Jargon zu reden, auf den sie sich geeinigt haben, und antreten, ihr Konzept zu verwirklichen. Da wird es freilich auch dem Schriftsteller interessant genug sein, zu erfahren, welche Stellung für ihn in Frage kommt.
So lebe ich denn also still dahin, für jeden, der meine Bücher gelesen hat, notwendig eine Enttäuschung, ein besserer älterer Herr mit Schuppen auf dem Rockkragen und leicht ausgefransten Manschetten. Die Leibkürassiere gibt es nicht mehr, die Kaiser auch nicht, und nur der Papst liest noch täglich seine Messe, und der Tag, an dem er seine letzte Messe liest, ist der Tag des Jüngsten Gerichts, ein Tag, an dem ich nur die kleine Freude zu erwarten habe, die hervorragenden Männer mit dem Donnerkeil sich in meiner Nähe drängen zu sehen.
2. Namevon Salomon,ErnstZu-(Familien-)nameVor-(Tauf-)namesiehe Anlage
Zu 2. «Salomo (hebr. Schelomeh, d.h. Friedemann), jüngerer Sohn Davids von der Bathseba und auf deren Antrieb, mit Zurücksetzung seines älteren Bruders Adonia, von dem altersschwachen David zum Thronerben ernannt, regierte nach herkömmlicher Rechnung von 1015 bis 975 vor Chr., begann seine Regierung mit der Ermordung Adonias und des Feldherrn Joab, der auf Adonias Seite gestanden hatte. Die durch die Tapferkeit und Klugheit seines Vaters erreichte Machtstufe ging unter S. wieder verloren. Die Aramäer befreiten sich, ohne dass es S. gelang, sie wieder zu unterwerfen. Auch die Edomiter rissen sich los und behaupteten wenigstens in einem Teil ihres Landes die Unabhängigkeit. S. war ein prachtliebender König. Die Burg Davids genügte ihm nicht, und so baute er mit Unterstützung des Königs Hiram von Tyrus, der ihm das dazu nötige Holz lieferte und ihm die in Israel fehlenden Bauhandwerker überließ, nördlich davon eine neue Burg, die außer den Wohn-, Regierungs- und Repräsentationsgebäuden auch einen Tempel enthielt. Dieser ist mit der weiteren Entwicklung der Religion Israels untrennbar verknüpft. Von geringer Bedeutung wird es gewesen sein, dass er gemeinsam mit Hiram von Ezion-Geber aus Schifffahrt nach dem Goldland Ophir betrieben hat. Große Schätze kann er sich damit nicht erworben haben, denn er war nach der Vollendung des Burgbaus dem Hiram so verschuldet, dass er diesem 20 im Norden des Landes gelegene Orte abtreten musste. S. hat für seine Bauten und seine Hofhaltung die Steuerkraft und die Frone seines verhältnismäßig armen Volkes stark in Anspruch genommen und dadurch den nach seinem Tode eintretenden Zerfall des Reiches Davids verschuldet. Schon bei seinen Lebzeiten brach deshalb ein Aufstand aus.





























