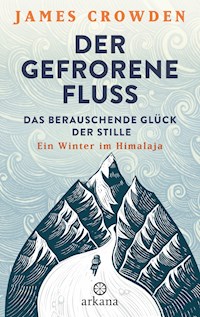
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arkana
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach Stille und Abenteuer bricht der junge Engländer James Crowden 1976 auf nach Zanskar, ein abgelegenes Himalaya-Hochtal, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Er ist erst der zweite Fremde, der jemals seinen Fuß in diese harsche Welt der Zanskaris gesetzt hat. Über die Wintermonate taucht er tief ein in ihre entbehrungsreiche Existenz: Einsamkeit und Schnee, Feste und Gebete, Ofenfeuer und Butterherstellung. Inspirierend und fesselnd zugleich, entfaltet der Autor das faszinierende Panorama einer längst untergegangenen Welt aus Abgeschiedenheit, innerer Einkehr und purer Stille. Zugleich erinnert er an die Bedrohung unserer einzigartigen Natur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
James Crowden
DER GEFRORENE FLUSS
DAS BERAUSCHENDE GLÜCK DER STILLE
Ein Winter im Himalaja
Aus dem Englischen von Elisabeth Liebl
Die englische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »The Frozen River – Seeking Silence in the Himalaya« bei William Collins, einem
Imprint von Harper Collins Publishers, in Großbritannien.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, a wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe
© 2021 Arkana, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright der Originalausgabe: © James Crowden, 2020
Lektorat: Diane Zilliges
Umschlaggestaltung: ki 36 Editorial Design, München, Daniela Hofner, nach einer Umschlagidee für William Collins / Harper CollinsDesigns: © Joe Maclaren
Umschlagmotiv: © Joe MacLaren
Karte: © Sabine Timmann nach einer Vorlage der Originalausgabe
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-26942-5V002
www.arkana-verlag.de
Besuchen Sie den Arkana Verlag im Netz
Inhalt
Prolog Die Suche nach Stille
Eins Die Straße nach Zanskar
Zwei Dorfleben – Padum
Drei Schnee und Neujahr
Vier Chadar – der gefrorene Fluss
Fünf Das Kloster von Karsha
Sechs Wölfe und Lawinen
Nachwort
Danksagung
Anmerkungen
Bibliografie
Das Tal des Zanskar-Flusses ist mehr oder weniger unpassierbar, außer zur Winterszeit, wenn sich infolge des Frosts eine Straße über die Wasser des Flusses bildet.
Frederick Drew Englischer Geologe und Erforscher der Kaschmirregion, 1875
Prolog Die Suche nach Stille
Das Tal
Stille, Schnee und Alleinsein haben von mir Besitz ergriffen und wollen mich nicht mehr loslassen. Ich bin besessen von den Bergen, der Kälte und dem Eis. Der Winter hat mit harter Hand meine Seele fest im Griff. Es ist wie eine Krankheit, eine Art spiritueller Besessenheit, das Bergfieber. Es gibt kein Entkommen. Ich sitze hier für die nächste Zeit fest, gefangen in einem kaum bekannten tibetisch-buddhistischen Hochtal, eingekeilt zwischen der Hauptkette des Himalaja und dem Karakorum.
Einer nach dem anderen haben sich die Hochpässe hinter mir geschlossen, und sie werden erst in sechs oder sieben Monaten wieder begehbar sein. Die einheimische Bevölkerung, die Zanskari, verbringen ihr halbes Leben um kleine Öfen geschart, in denen sie Yak-Dung und Tamariskenholz verheizen, um sich warm zu halten. Es ist dunkel in ihren Häusern. Wie sie, umgeben von diesen Unmengen an Schnee und Eis, überleben und über den Winter kommen, ist nach wie vor ein Rätsel. Der einzige andere Mensch aus einer westlichen Kultur, der einmal einen ganzen Winter in Zanskar verbracht hat, war ein exzentrischer ungarischer Sprachwissenschaftler namens Alexander Csoma de Kőrös. Doch das ist gut einhundertfünfzig Jahre her, und er hat keine Aufzeichnungen über den Winter dort hinterlassen.
Stellen Sie sich vor, Ihre Vorfahren lebten schon seit tausend Jahren oder mehr in den Bergen. Welche Auswirkung würde das auf Ihren Geist, auf Ihr Denken haben, auf Ihr Bewusstsein und Ihre Art, die Dinge zu sehen? Stellen Sie sich vor, wie viel Schweigen Ihre Vorfahren in dieser Zeit aufgesogen und verinnerlicht haben. Die Menschen von Zanskar versuchen, die Lehren der Stille zu bewahren, die zwischen den Worten aufkeimt. Diese Lehren, mitunter sehr formal, aber auch sehr subtil, lassen den Raum anklingen, der sich auftut, wenn Worte ihr Ende erreichen. Und dann ist da auch noch das Schweigen des Dzogchen und der Berge, das nicht gelehrt, sondern nur vom Lehrer auf den Schüler übertragen werden kann. Die Sprache der buddhistischen Lehren, die Sprache des Mitgefühls durchzieht das Alltagsleben der Zanskari wie ein unsichtbarer Faden.
Nach Süden hin liegt der pulsierende, farbenfrohe indische Subkontinent. Nach Norden die trockenen Sandwüsten Zentralasiens. Im Westen Kaschmir, die schartige Grenzlinie zu Pakistan. Im Osten erhebt sich endlos das einsame, von Nomaden bevölkerte tibetische Hochland. Ein Land der Meditation, der Mönchsdebatten und der monastischen Gelehrsamkeit. Selbst für die Verhältnisse im Himalaja ist Zanskar ein weltabgeschiedener Ort.
Tiefes Schweigen, tiefer Schnee und tiefe Einsamkeit. Das sind die inneren Koordinaten, die mir am meisten bedeuten. Es gab mehrere Gründe, warum ich diese Abgeschiedenheit, diesen Rückzug von der Welt gesucht habe. Absoluter Frieden und Ruhe. Abgeschiedenheit ist ein Geisteszustand – entweder hat man ihn, oder man zieht los und sucht ihn. Doch wenn man diese besondere Form von Einsamkeit einmal gefunden und von ihren Früchten gekostet hat, dann kehrt man immer wieder dorthin zurück, um sich mit der Wildheit und der blanken Leere der Berge zu verbinden. Die Sehnsucht nach diesen Bergen ist vielleicht ein zentraler Teil des Menschseins.
Die Vorstellung, den zugefrorenen Zanskar abwärtszureisen, lockte mich mindestens ebenso sehr wie die Stille des Winters. Schlafen unter freiem Himmel, in Höhlen, im Schnee – sich irgendwie durchschlagen. Ein falscher Tritt, ein Sprung im Eis, ein fataler Ausrutscher in Richtung des offenen Wassers, und man ist verloren. Der Fluss ist reißend, tief und eisig kalt. Der schwere Rucksack zieht einen im Nu in die Tiefe. Ein schnelles Ende. Zanskar im Winter ist reine Gefahr.
Diese Reise den gefrorenen Fluss hinab wollte ich unbedingt machen, mehr als alles andere auf der Welt. Soweit ich wusste, hatte noch nie ein Mensch aus dem westlichen Kulturkreis die Freuden und die Gefahren gekostet, die er aufbot. Auch wenn ich diese Herausforderung begrüßte, so hatte ich doch viel zu lernen. Die Berge riefen mich in ihrer stillen Sprache, die ich noch zu entschlüsseln hatte. Ich sehnte mich nach Eis und Einsamkeit, aber die Berge halten so manche Tücke bereit.
Die Straße aus Eis
Manchmal, wenn das Eis klar war, konnte ich durch die Eisdecke hinuntersehen bis auf den Grund des Flussbetts, in dem sich Kiesel in vielen Farben tummelten: graue, rostbraune, schwarze, orangefarbene und sogar welche in zartem Lila. Das Wasser selbst hatte einen berauschenden Türkiston. Dann wieder war die Eisdecke so dick, fest und undurchsichtig, dass man sie wohl mit einem Panzer hätte befahren können. Wo die Eisdecke dünn wurde, war der Fluss gefährlich. Eine hauchdünne Schicht, unter der unsichtbare Wirbel leise dahinstrudelten. Eine Falle für den Schritt dessen, der nicht auf der Hut war.
Sobald man seinen Fuß darauf setzte, hinterließ der gefrorene Fluss unauslöschlich sein Mal im Geist. Er wurde zum Spiegel der Seele. Er prägte mir eine innere Stärke, eine Zuversicht ein, die mich für den Rest meines Lebens nicht mehr loslassen würde. Eine Art inneren Kompass. Es war ein Initiationsritus. Eine Einweihung. Die Menschen in Zanskar nennen den gefrorenen Fluss chadar: »Eisplatte«, »Eisstraße«, »Eisdecke« oder einfach »der Vereiste«. Sie zollen ihm Respekt. Im Winter spielt er in ihrem Leben die Hauptrolle.
Man lernt schnell, das Eis zu lesen, erfasst mit einem Blick alte Bruchstellen und Risse, scannt es auf Unebenheiten, welche die Absichten und Tricks des Flusses verraten. Fließrichtung und Geschwindigkeit ändern sich in einem schwer durchschaubaren, quirligen Wechselspiel. Massive Strömungen, verwoben zu komplexen Mustern. Ströme eingefangener Luftblasen. Zu langen Schnüren aufgefädelt, als befände sich dort unten ein Taucher. Bogig, spiegelverkehrt und vielfach geschichtet. Hypnotisierend. Das erstarrte Fließen. Eingeschlossen ins Eis. Geliert, verfestigt, stumm.
Das Gefühl, tagelang in der Klamm festzuhängen, hat überhaupt nichts Unangenehmes. Es ist sogar tröstlich, so als würden die Berge einen willkommen heißen. Ein Gefühl der Erwartung, ein gewisser Nervenkitzel, als würde man sich auf verbotenes Gelände vorwagen. Ein Schaudern in der kalten, schneidenden Frühmorgenluft. Man fühlt sich durch und durch lebendig. Das Adrenalin zeigt Wirkung. Deine Atmung verändert sich, man ist sich jedes einzelnen Geräusches gewahr. Man lotet die Tiefen der Stille aus. Man hängt nicht einfach in der Klamm fest, man folgt einem Mäandern, das sich um einen mächtigen Gebirgszug windet und ihn schließlich durchschneidet. Erdgeschichte im Querschnitt, bloßgelegt. Sedimentgestein aus Millionen Jahren, gewunden, verdreht, stellenweise fast senkrecht aufragend, buddhistische und geologische Zeit gleichauf. Man rutscht, schlittert und schlurft, als schleife der Fluss einen vor sich her. Diese Reise hat ihre ganz eigene Dynamik, wie ein silberner Ariadnefaden.
Ist man einmal auf dem Chadar unterwegs, dem gefrorenen Fluss, wird alles anders. Das Leben folgt anderen Richtwerten. Die Welt schrumpft zusammen auf diese Klamm. Man wird sehr fokussiert, wie jeder Kletterer es sein muss. Man misst sich am Fels, am Eis, am gefrorenen Fluss selbst. Man reckt sich in die Höhe, voll Zuversicht, das Ohr geeicht auf die Stimme des Flusses. Man lernt, seinen Tonfall zu deuten, wenn man mit dem Bergstock das Eis abklopft und geduldig auf das Echo horcht und dann auf das Echo des Echos. Um abzuschätzen, wie tragfähig das Eis ist. Man taucht ein in die Energie des Flusses. Man liest seinen Geist, wie er sich dreht und wendet, wie der Geist eines wilden Tieres. Man berechnet seinen Lauf, wie er unter dem Eis und über dem Eis fließt. Man wartet darauf, wie er das Signal zurückwirft wie ein Echolot. Worauf es ankommt, ist die Art des Widerhalls, die Höhe des Tons. Klopf, klopf, klopf. Man lauscht, was er einem antwortet. In jeder Schwingung liegt eine Unsicherheit. Daher liest man das Eis auch mit den Augen. Jede Unregelmäßigkeit wird registriert und protokolliert, nur für den Fall, dass sich die Klangfarbe ändert. Man orientiert sich an dem seltsam verwachsenen Wacholderbaum, den kleinen nallahs an den Seiten: Felskanälen, Seitentälern oder steilen Schluchten und Wasserläufen, die häufig ausgetrocknet sind. An Höhlen, hohen vereisten Wasserfällen, alten Lawinenkegeln, bestimmten Felsvorsprüngen, seltsamen Mustern im Schichtgestein, am Wechsel der Farben und des Lichts.
Man lernt, dass die Eisbildung bei Flüssen zu verschiedenen Zeiten ganz unterschiedlich verläuft. Manchmal bricht sich der vereiste Fluss Bahn, bäumt sich drei oder mehr Meter auf in die Luft, wuchtig und wild, sodass sich massige Schollen von Packeis übereinandertürmen. Manchmal dröhnt der sich vorwärtsschiebende, berstende Eisfluss laut wie Artilleriefeuer, ein scharfes Krachen, das die schmalen Wände der Klamm hindurchhallt. Und einen auf Trab hält. Weil das Krachen näher kommt. Manchmal aber schweigt der eisige Fluss auch. Dann wieder spricht er in Rätseln. Und man muss seine Orakel deuten. Lernen von den Alten. Auch von ihrem Schweigen. Der Geist ist immer wachsam.
Als ich mit den Zanskari den gefrorenen Fluss hinabwanderte, war ich mir aber nicht nur seiner Gefahren bewusst, sondern auch seiner überwältigenden Schönheit. Zeit war bedeutungslos. Als würden wir im Kosmos kreisen, losgelöst von der Sicherheit der Welt, wie wir sie kannten. Die Zeit, in der wir uns bewegten, war nur geliehen. Wir befanden uns auf einer abenteuerlichen Reise, die größer war als wir. Die Bande, die uns mit Fels und Bergen verknüpften, waren ebenso so stark wie die zwischen uns.
Manchmal fühlte ich mich sehr sicher, dann wieder war ich in größter Gefahr. An gewissen Stellen hörte das Eis einfach auf. Dann musste ich aus der Klamm heraus über die steilen Wände nach oben klettern, bis ich irgendwo einen waagerecht verlaufenden Vorsprung im Gestein fand. Nie war man dem Fels so nah wie in solchen Augenblicken, wenn man sich fünfzehn Meter oder mehr über dem offenen Wasser ohne Seil oder sonstige Sicherung vorsichtig schmale Felsvorsprünge entlangtastete. Meine Finger wurden taub und steif. Ich klammerte mich verzweifelt an meinem Wanderstock fest, während ich mich gleichzeitig mit schwerem Gepäck auf einem Felsvorsprung entlangschob. Manchmal hatte ich dabei das Gestein so nah vor dem Gesicht, dass ich mit der Nase daran vorbeischrammte. Dann nahm ich seinen Geruch wahr: innig, erdig, scharf, fast metallisch.
Ich folgte den Zanskari, die so behände wie ein Steinbock und so gewieft wie ein Schneeleopard waren. Sie handelten mit Butter, und jeder von ihnen trug mehrere Kilo dieses kostbaren Gutes auf dem Rücken, das für den Verkauf in den Basaren von Leh bestimmt war, der Hauptstadt Ladakhs. Feine gelbe Butter aus der Milch der Yak-Kühe auf den Hochweiden, die die Zanskari für den Transport in Beutel aus Ziegenleder und in getrocknete Schafsmägen verpackt hatten. Diese Butter war sehr begehrt, weil man daraus den salzigen tibetischen Buttertee herstellte – im Winter hochgeschätzt. In der kältesten Jahreszeit war der Verkauf von Butter die einzige Einkommensquelle der Zanskari.
Doch der Winter in Zanskar war nicht einfach nur ein Winter. Es war die Erinnerung an viele Winter, die sich in einen verflechten. Eine Geschichte über den Kampf ums Überleben nicht eines, sondern vieler Dörfer – ein kollektives Gedächtnis, so groß wie das Tal selbst. Es waren wohl um die zehntausend Seelen, Mönche, Nonnen, Yaks, Schafe und Ziegen mitgerechnet, die im Zanskar-Tal Jahr für Jahr von der Außenwelt abgeschnitten waren. Der Winter ist die Selbsterhaltungsstrategie der Natur. Nur der Mensch kann die Stille zerstören. Und nur der Mensch kann sie wertschätzen.
Die Zeiten auf dem gefrorenen Fluss überschritten eine Grenze. Sie reichten weit über das Dorfleben mit seinen Alltagspflichten hinaus. Ein eigenartiges Rendezvous mitten in den Bergen. Nur ein oder zwei Monate im Winter konnte der gefrorene Fluss sicher als Verkehrsweg genutzt werden. Der Chadar war eine Welt für sich. Einige Zanskari machten diese Reise jedes Jahr, andere sogar zwei- oder dreimal in einem Winter. Es war ein zentraler Bestandteil ihres Lebens. Ein gefährlicher Wirtschaftszweig. Man tauschte die Berge gegen Weisheit, die Butter gegen Rupien und wichtige Vorratsgüter. Jeder nahm in den Tiefen seines Geistes mit, was er konnte. Mehr konnte man aus dem Tal auch nicht mitnehmen, aber es würde einen ein Leben lang begleiten. Diese Stille war wie ein Juwel in den Tiefen der Berge. Eine Art des Daseins, das sich von selbst im Bewusstsein verwurzelte.
Sehr selten stürzten Männer in den Fluss und wurden samt ihrer Last unter das Eis gezogen. Andere wurden Opfer von Lawinen, die schnell und mit unkalkulierbarer Macht zuschlugen. Meine Reise auf den Chadar sollte ein Vorstoß ins Unbekannte werden. In absolutes Neuland. Eine echte Herausforderung. Ich würde sie hin und wieder zurück machen.
Die Menschen von Zanskar sprechen einen eigenen Dialekt, der, wie manche sagen, eine ältere Spielart des Tibetischen darstellt. Buchstaben, die im Tibetischen mittlerweile verstummt sind, werden dort noch ausgesprochen. Tenzin heißt dort Stenzin, und Padum wird als Spadum gesprochen. Doch was ich erforschen wollte, war der unausgesprochene Ausdruck des Winters, die stumme Sprache der Berge und des Kampfes ums Überleben.
Die Berge hier sind Hüter der Stille, und der lange Winter spielt in dieser Gleichung eine zentrale Rolle. Die unsichtbare Kraft des Winters hat keinen Namen und lässt sich nicht leicht in Worte fassen, dennoch ist sie höchst real und überwältigend. Sie besitzt ihre ganz eigene Weisheit. Sie wird in kleinen Höhlen und Klöstern weitergegeben. Ein paar Menschen nennen sie »Buddhismus«.
Weiße Berge
Die Bezeichnung »Himalaja« kommt aus dem Sanskrit und setzt sich zusammen aus hima, »Schnee«, und alaya, »Ort«, »Wohnsitz«, bedeutet also so viel wie »Wohnsitz des Schnees«. Im Tibetischen beziehungsweise im Ladakhi werden seine Gipfel schlicht Pabu Riga oder »weiße Berge« genannt. Tatsächlich aber sind sie ein weitläufiges, verworrenes Labyrinth aus schroffen, ehrfurchtgebietenden Gipfeln, reißenden Flüssen, reichen Weiden und langgezogenen, breiten Gletschern – ein Gebiet, das Schneeleoparden, Bären, Steinböcke, Wölfe, Murmeltiere und der mythologische tibetische Schneelöwe durchstreifen, ein bis zu dreihundertfünfzig Kilometer breiter Gebirgszug, der sich über eine Länge von dreitausend Kilometern an Indiens Nordgrenzen entlangzieht. Eine der am schwersten zu bezwingenden natürlichen Barrieren der Welt.
Der Himalaja besteht nicht aus einer Bergkette, sondern setzt sich aus mehreren zusammen. Im Westen liegen das Dhauladhar-Gebirge, der Pir Panjal, dann die Hauptkette des Himalaja, die Zanskar- und die Ladakh-Range und schließlich der Karakorum, dessen Name aus einer Turksprache kommt und so viel bedeutet wie »schwarzes Geröll« oder »schwarzer Sand«. Der Himalaja hat sich gebildet, weil sich der indische Subkontinent Jahr für Jahr weiter nach Norden vorschiebt. Die Folge: eine gigantische Kollision in Zeitlupe. Das Gebirge ist jung, ungebärdig und unberechenbar, seine Gipfel wachsen immer noch weiter in die Höhe. Bergrutsche sind häufig. Dieses Gebirge ist eine Welt für sich – ein spirituelles Sammelbecken, eine Pilgerstätte und ein Ort frommer Hingabe. Für Indien ist es die Quelle, der alles entspringt: Wasser und Leben.
Zanskar besteht aus zwei Hochtälern, die von zwei eisigen, reißenden Flüssen entwässert werden: dem Stod und dem Lungnak, die sich in der zentralen Ebene zum Zanskar-Fluss vereinigen. Der Zanskar fließt weiter nach Norden durch eine steile, einhundertfünfzig Kilometer lange Felsenschlucht, windet sich bald hierhin und bald dorthin, eine Bergkette durchquerend, bis er sich schließlich mit dem Indus vereinigt. Seine Mündung ist gleichzeitig das nördliche Ende des Chadar, der Eisstraße, die Zanskar mit Zentral-Ladakh und der alten Handelsstadt Leh mit ihren bröckelnden Basaren und verfallenen Karawansereien verbindet. Von Leh aus liefen einst, gleich einem Spinnennetz, Verbindungswege über den Karakorum zu den alten Stadtstaaten von Kaschgar, Yarkant und Hotan sowie Richtung Osten zur Oasenstadt Dunhuang, bekannt für ihre reich geschmückten buddhistischen Höhlentempel. In Zentralasien begegnen einander viele verschiedene Ideen und Religionen. Die Seidenstraße, eigentlich ein Netz von schmalen Handelswegen, wand sich durch die Berge, und an ihr entlang spielte sich das Leben der Menschen ab. Leh und seine Kaufleute haben viele Geschichten zu erzählen.
Ladakh, das manchmal auch »Klein-Tibet« genannt wird, war einst ein Königreich. Das abgeschiedene Land ist etwa anderthalbmal so groß wie die Schweiz. Die vier großen Bergketten, die Ladakh durchschneiden, teilen es in kleine, abgeschlossene Täler. Das Land ist eine der höchstgelegenen, von Menschen bewohnten Landschaften der Welt, eine ungewöhnliche Enklave, deren Bewohner ganz offensichtlich einiges leisten. Die Berge sind es, die die Abgeschiedenheit und Eigenart von Zanskar ausmachen. Der niedrigste Pass, der von Westen in das Land führt, liegt auf einer Höhe von viertausendvierhundert Metern, der höchste Pass von Süden führt über die Hauptkette des Himalaja und liegt auf fünftausendfünfhundert Metern Höhe. Er ist nur ein oder zwei Monate im Sommer gangbar. Die höhergelegenen Routen führen nicht selten über spaltendurchfurchte Gletscher. Es gibt keinen einfachen Weg nach Zanskar und auch keinen heraus.
Das Tal ist weitgehend autark, doch gegen Ende des Winters können die Nahrungsvorräte für Mensch und Tier gefährlich knapp werden. Einsamkeit und Isolation, aber von der besten Art. Abgeschiedenheit. Heutzutage ein seltenes Gut.
Trockenheit, die staubige, unerbittliche Trockenheit Zentralasiens. In Ladakh herrscht ein Bergwüstenklima, da das Land im Regenschatten der Berge liegt. Man ist daher auf Gletscher, Schmelzwasser und künstliche Bewässerung angewiesen. Kalte Winter, heiße Sommer.
Das Zimmer
Den Winter und den größten Teil des nachfolgenden Sommers verlebte ich mitten in Zanskar in einem kleinen, zugigen Zimmer mit Lehmziegelwänden. Ich war in Padum, der Hauptstadt von Zanskar, die in ihrer Glanzzeit eine eigene siebenstöckige Palastfestung besessen hatte. Sie war mittlerweile verfallen, und das Dorf hatte definitiv schon bessere Tage gesehen.
Meine kleine Kammer ragte über das Hausdach hinaus – weswegen es dort ungeheuer zugig war. Sie wurde nur im Sommer benutzt und war von allen vier Seiten den Elementen ausgesetzt. Heizung gab es keine. Trotzdem war dieses Zimmer für mich unentbehrlich. Es war meine Einsiedlerklause. Ein Ort des Rückzugs und der Kontemplation. Mein Basislager, in dem ich meine Lebensmittelvorräte und meine gesamten Habseligkeiten aufbewahrte.
Zum Kochen hatte ich einen kleinen blauen Benzinkocher, der super funktionierte. Außerdem besaß ich einen Kocher der bei Trekkern und Campern beliebten Marke Primus, der mit Petroleum befeuert wurde. Allerdings verstopften bei ihm häufig die Düsen, sodass ich sie immer wieder freipiksen musste. Ich hatte nur minderwertiges Petroleum zur Verfügung, das beim Verbrennen reichlich dunkle Rauchschwaden, ja sogar Wasserdampf produzierte. Meist zischte es erst mal eine ganze Weile, bis der Kocher wirklich betriebsbereit war.
Meine gesamten Habseligkeiten einschließlich der Expeditionsausrüstung lagen über den Boden verstreut, immer noch kreuz und quer, wie man sie beim Abladen deponiert hatte. Vier kräftige Lasttiere hatten die Sachen von Panikar im Suru-Tal hierhergebracht. Dort endete die Straße. Es war ein Marsch von gut einhundertfünfzig Kilometern über den Pense La (La ist tibetisch für »Bergpass«) zu bewältigen, im Sommer ein relativ leicht zu überquerender Pass. Doch wir schrieben Mitte November, und es hätte jederzeit schneien können.
Der Marsch nach Zanskar hatte sechs Tage gedauert, und die Temperaturen waren manchmal bis auf minus zwanzig Grad Celsius gefallen. Damals führte noch keine Autostraße nach Zanskar, deshalb war dem Tal das Dröhnen von Motoren fremd. Von der Welt vergessen zu sein hatte eindeutig Vorteile. Eine so tiefe, durch nichts unterbrochene Stille war ein großer Vorteil. Ein seltenes Gut, das Meditierende, die wahren Freunde der Stille, zu schätzen wussten.
Neben vielen anderen Dingen wollte ich hier untersuchen, welche Auswirkungen die Straße haben würde, die man ins Tal vortreiben wollte. Mit den Arbeiten hatte man in den 1960er-Jahren begonnen, doch man war nur sehr langsam vorangekommen. Es war, als hätte man die Uhr fünfhundert Jahre zurückgedreht. Zanskar war damals wie das alte Ladakh – das »kleine Tibet« – eine Welt für sich. Ein seltenes Relikt. Ein spirituelles Juwel. Eine Pferde-und-Schafe-Ökonomie. Ein klösterliches Reich von Mönchen und Nonnen, in dem sich das Leben der Menschen ganz um Gerste und Yaks drehte.
Mir wurde bewusst, dass die Studien, die ich im Tal anstellen wollte, möglicherweise die weitere Entwicklung dort – zumindest in gewissem Umfang – beeinflussen könnten. In der Quantenphysik nennt man das den Beobachtereffekt. Ich war schließlich ein Außenstehender. Außerdem hatte ich so ein Gefühl, dass in den kommenden Jahrzehnten sehr viel mehr Leute hierherkommen und so das fragile Gleichgewicht, das sich ohne jede moderne Technik entwickelt hatte, gefährden würden. In Zukunft wären der Friede und die Stille Zanskars einer sehr realen Bedrohung ausgesetzt. Sobald die Straße fertig war, würde sich die Welt dieser Menschen dramatisch und auf nicht vorhersehbare Weise verändern. Die jüngeren Leute schienen den Bau und die Verbindung mit dem modernen Indien zu begrüßen, andere waren da skeptischer. Dies war ein ganz entscheidendes Jahr. Ein Zurück würde es danach nicht mehr geben.
Eisfarne
Beim ersten Tageslicht streckte ich, einen Ellbogen aufgestützt, meinen rechten Arm aus und kratzte mit den Fingernägeln das Eis vom Fenster, um den Berg hinter dem Dorf besser sehen zu können. Das Fenster, zwei kleine Glasscheiben, jeweils in einem einfachen Holzrahmen, war knapp über dem Boden eingelassen. Nacht für Nacht kroch der Frost langsam zurück in meine Kammer und ließ seine Silbermuskeln spielen, um einmal mehr zu zeigen, wer hier der Herr war. Auf der Innenseite der Scheiben schlug sich die Feuchte meiner nächtlichen Atemzüge nieder, eine Feuchte, die in der ausgesprochen trockenen Luft ohne Eile ihre eigene kleine Bildersammlung anlegte, zu Farnen aus Eis wurde. Langgeschwungene, filigrane Farnwedel, die aus den Ecken und Leisten des Fensterrahmens herauswuchsen und sich wieder einrollten. Diese Formen waren mir ein ständiger Quell der Verzauberung, wie sie sich so lautlos über meinem Kopf auswickelten und jeder Kristallbogen in der Dunkelheit seine eigene, Unterwasserströmungen gleiche, wirbelnde Bahn zog. Jeden Morgen entstand so auf jeder Scheibe ein Mikrokosmos, der bei genauerer Betrachtung genau so aussah wie eine Karte der Gebirgskette, in der ich festsaß, mit all ihren samt und sonders unerforschten, verlockenden Höhenrücken und Seitentälern, verborgenen nallahs und tiefen Schluchten.
Dieser wundersame Wald aus Reif und Frost malte, wie aus einer Laune heraus, jede Nacht seine geheimen Muster, seine Karten aus Eis, die es mich mit eigenen Augen zu erkunden und zu durchqueren verlangte, als flöge oder schwebte ich in einem Heißluftballon über ihnen dahin, als schaute ich durch ein umgedrehtes Fernrohr auf sie, als blickte ich durch den Tubus eines Mikroskops in die Substrate einer kaum bekannten kristallinen Welt oder in das Innere einer neuen, dem bloßen Auge unsichtbaren Spezies. Diese Karten aus Eis erinnerten mich an Fraktale und Mandelbrot-Bäumchen, deren Muster sich auf jeder Vergrößerungsstufe wiederholen. Sogar die Spitzen rollten sich ein wie Farne. Es schien, als würden diese geheimnisvollen Karten irgendwie meinen eigenen Geist spiegeln und topografisch erfassen. Ein intimes Schaubild unbekannter Konstellationen, aus denen ganz nach Belieben Gedanken und geistige Reisen erblühten, Aufmerksamkeit und Raum begehrten, nur um dann auf ebenso geheimnisvolle Weise zu verschwinden, wie sie entstanden waren.
Als wäre der Geist, statt einfach nur Fenster zu sein, durch das wir die Welt und andere Menschen beobachten, urplötzlich in etwas viel Spannenderes verwandelt worden, etwas, bei dem über Nacht aus einer einfachen Glasscheibe ein Wunderding wurde, ein Glasnegativ, eine lichtempfindliche Platte, wie sie die ersten Fotografen verwendet haben. Und auf der belichteten Platte befände sich eine dicke, deckende Schicht, in die sich unsere nächtlichen Gedanken, unsere Hoffnungen und Ängste, unsere vergangenen und künftigen Wanderungen, unsere tiefsten Geheimnisse und unsere unverhüllten Sehnsüchte, einschreiben konnten. Eine Schicht, die dieses geistige Sammelsurium, wenigstens ein paar kostbare Stunden lang, bewahren und für uns sichtbar machen würde. Als wäre jeder Eisfarn ein Traum, der rückwärts in die Zeit wuchs, hinaus über den schlichten hölzernen Fensterrahmen, der seine Form sicher bewahrte. Zurück zur wahren Quelle der Dinge, dorthin, wo die Sprache eine andere Dimension hat und selbst das leichteste Kerzenflackern bedeutungsvoll ist. Eis ist einfach nur Wasser, das innehält, dessen Fluss angehalten wurde. Ein Reich der Kristalle mit eigenen Gesetzmäßigkeiten.
Und so verfolgte ich jeden Morgen meine eigene Reise durch immer neue Gebirgsketten zurück. Es schien, als könne der Geist endlich zu sich selbst aufschließen, während ich hier Wochen und Monate in größter Stille ausharrte. Und in diesen filigranen Farnen und Eiskristallen würde ich meine eigene innere Reise wiedererkennen, wenn ich die lange Bergkette von einem Ende zum anderen verfolgte. So als wäre jeder Gipfel mit dem nächsten verbunden und würde im Rhythmus der Täler und Flüsse mit den Jahreszeiten vergehen und seine Gedanken wie Schmelzwasser verströmen. Bergdenken. Eine üppige, abwechslungsreiche Landschaft, die meine Seele labte. Doch der Winter zog sich lange hin.
Winter, Winter. Eine Zeit, um Einkehr zu halten, bei sich zu bleiben, alles Überflüssige abzustellen, stillzuhalten, die Winterruhe sich entfalten zu lassen. Eine entgrenzte Zeit, die auf ihre ganz eigene Art und Weise einen inneren Reichtum und eine Empfindsamkeit zutage förderte, die lange in mir verschüttet gewesen waren und die mir das Gefühl gaben, zu mir selbst zurückzukehren und endlich heimzukommen. Ich war von aller Welt abgeschnitten, aber völlig im Frieden mit mir selbst.
Diese zart aufs Fenster gravierten Farne und Formen aus Eis in jener Kammer wurden zu meinen Freunden und Verwandten. Ich pflegte ihre Gestalt nachzuzeichnen und in sie alle möglichen Fahrten und Gedanken hineinzulesen, aber dennoch war es nicht möglich, Punkte zu entdecken oder vorherzusagen, an denen eine Geschichte vielleicht ihren Verlauf ändern oder eine Idee konkrete Gestalt annehmen könnte. Viele dieser Geschichten erstreckten sich weit zurück in die Vergangenheit, andere eilten dagegen voraus in die Zukunft. Diese Geschichten waren ein Ort des Aufkeimens, aber auch des Grübelns, waren wie ein Barometer, das selbst die geringsten Veränderungen anzeigte. Eine Zwiesprache mit sich selbst und der Welt da draußen. Doch es bestand keine wirkliche Notwendigkeit zum Rückzug. Die Welt da draußen war vollkommen still und die Kultur von Zanskar der Spiegel, in den ich schaute.
Dennoch musste ich jeden Tag wieder einen Teil dieser zarten, so komplexen Welt zerstören, Schneisen durch die Karte aus Eisfarnen pflügen, die filigranen Spitzen aus Eis zerreißen, um ein Naturwunder von ganz anderem Maßstab sehen zu können, welches das ganze Tal überragte. Während ich die Scheiben freikratzte, spürte ich die Kälte der Eiskristalle, die sich unter meinen Fingernägeln sammelten. Ich horchte auf das kratzende Geräusch, drehte meinen Kopf, streckte den Nacken ein wenig und ließ meinen Blick nach oben gehen, während ich immer noch auf dem Boden lag. Dann erhaschte ich einen ersten Blick auf die heraufziehende Morgendämmerung, wenn unvermittelt ein rosafarbener Lichtschein sanft über den nach Süden gelegenen Berggipfel streifte. Ohne jede Hast beobachtete ich, wie das Licht die Bergflanke herunterfloss und erst das Kloster, dann das Dorf erreichte. So harrte ich reglos aus, bis seine warmen Strahlen in meine Kammer fielen – natürlich nur, wenn es nicht schneite. Einmal schneite es ganze zehn Tage lang.
Ich hatte kein Bett, keine Matratze, keine Decke, nicht einmal eine Pritsche. Mein einziger Luxus war ein Schlafsack, den ich auf einem abgetretenen Teppich ausgerollt hatte. Unter dem Teppich lag ein Rest von einem alten Rupfensack, wie sie als Decke unter den Holzsätteln der Lasttiere dienten. So hatte ich wenigstens ein bisschen Isoliermaterial. Doch der gestampfte Lehmboden war uneben und staubig, ein wenig bucklig, aber zumindest zog es nicht sonderlich in meiner Kuhle. Die Eiskristalle unter meinen Fingernägeln waren unglaublich kalt. Das Leben war sehr einfach. Aber genauso mochte ich es. Ich schlief immer auf dem Boden, so war es wärmer.
Das Fenster
Dieses Fenster war der Mittelpunkt meines Daseins. Es war mein Auge auf die Welt, eine Linse, durch die ich wie durch ein Bullauge hinausspähen konnte – und es befand sich direkt über meinem Schlafplatz. Diese zwei Glasscheiben waren mein Ein und Alles. Sie maßen nur dreiundzwanzig mal dreiundzwanzig Zentimeter, und doch waren sie, eingewickelt in Stroh und Sackleinen, damit sie nur ja nicht brachen, auf hölzernen Tragegestellen wie auf einer Staffelei, behutsam einhundertfünfzig Kilometer oder mehr auf dem Rücken eines Mannes über unzählige Bergpässe hierhergeschafft worden. Glas war in diesem Tal immer noch so etwas wie ein Novum, das seinen Zauber nicht verloren hatte. Man ging damit fast ehrfürchtig um, und der gefährliche Weg, den es genommen hatte, verdoppelte, ja verdreifachte seinen Wert. Die Dorfleute hatten in ihren Winterquartieren häufig nur ein Brett, das sie einen Spalt öffneten, um den Rauch des offenen Küchenfeuers abziehen zu lassen. Oft war es im Winter einfach zu kalt für Glasfenster. Licht kam entweder von Kerzen oder Lämpchen, in denen Senföl verbrannte. Manche hatten auch althergebrachte Sturmlaternen. Einer oder zwei hier im Tal besaßen eine dieser neumodischen Tilleylampen, die mit Petroleum betrieben wurden. Man musste zuerst die Pumpe abschrauben, Petroleum einfüllen, die Pumpe wieder anschrauben, vorheizen, dann mit mehreren Pumpstößen Druck aufbauen, bis der Glühstrumpf weiß glühte. Diese Lampen sorgten stets für großes Hallo und schenkten ihrem Besitzer Stolz und Status.
Selbst das Holz für den Fensterrahmen war mehrere Hundert Kilometer durch gewundene Täler von Kaschmir hier heraufgeschafft worden. Dieses Bauholz war auf dem Rücken von Pferden und Yaks über dieselben Pässe gekommen, die auch ich überquert hatte: Zoji La und Pense La. Ein Teil des Bauholzes kam von Süden, von der anderen Seite der Hauptkette des Himalaja. Es wurde über Gletscher gezogen, wobei Männer und Pferde manchmal in Eisspalten rutschten, sodass man sie mit Seilen wieder herausholen musste. Das Ende der ausgebauten Straße nach Suru war einhundertfünfzig Kilometer entfernt. Von dort war ich Mitte November mit vier Tragetieren aufgebrochen, zu einem keineswegs problemlosen Marsch.
Wie bei den meisten Fenstern in diesem Tal war unterhalb des Rahmens ein Gitter eingesetzt, das Luft hereinließ. Meine Kammer wurde eigentlich nur im Sommer benutzt, und da war ein frischer, kühler Luftzug höchst willkommen. Im Winter freilich sah die Sache anders aus. Die Winde aus den Bergen waren häufig erbarmungslose Staubstürme. Diese wirbelnden Derwische, Sandteufel, Dschinns – man kann sie nennen, wie man will – waren an der Tagesordnung, wenn der Wind über die zentrale Hochebene fegte. Die Kälte der Eiswinde von den Gletschern kroch einem dann bis ins Mark.
Das Gitter unter dem Fenster und die Spalten zwischen den Fensterrahmen hatte jemand behelfsmäßig mit Seiten aus einem Schulheft zugestopft. Ich drückte mit meinem Taschenmesser Watte in die Ritzen und versuchte dann, die Fugen mit Streifen kostbaren Heftpflasters zu versiegeln, damit Wind und Staub draußen blieben. Trotzdem drückte es häufig feine Schneepartikel herein, die sich dann über alles legten.
Oft war ich beim Aufwachen von einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Die schmolz nicht einmal auf meinem Schlafsack, denn zwischen Innen- und Außentemperatur war kein großer Unterschied. Ich hatte zwei Plastikthermometer, sodass ich die Temperatur immer kontrollieren konnte. Und so stellte ich fest, dass minus zwanzig Grad Celsius draußen etwa minus zehn Grad drinnen entsprachen. Hatte es draußen minus dreißig Grad, dann lag die Innentemperatur bei etwa minus fünfzehn. Höchst wissenschaftliche Beobachtungen also, die ihr Ende fanden, als ein junger Bursche mir ein Thermometer klaute. Nach ein oder zwei Tagen bekam ich es zwar wieder zurück, es war aber leider kaputt.
Nach einer gewissen Zeit wurde die Frage nach den Kältegraden zu einer rein akademischen Angelegenheit. Trockene Kälte kann sehr trügerisch sein. Sobald man aber draußen weite Strecken allein unterwegs war, ging es dabei um Leben, Tod und Durchhaltevermögen. Das Wichtigste war, darauf zu achten, dass man nicht ins Schwitzen kam, weil dann der Schweiß auf der Kleidung gefror. Und darauf, dass man sich keine Erfrierungen an Fingern, Zehen, Nase und Ohren holte. Beim Langlaufen band ich mir manchmal wie ein Bandit ein blau-weiß getupftes Taschentuch vor den Mund, um meine Lunge vor der eiskalten Luft zu schützen. Die Hauptsache war, immer in Bewegung zu bleiben und nur wenige Minuten zu rasten, außer die Sonne guckte gerade hervor. Ich musste mich auf den gefrorenen Fluss vorbereiten.
Zum Schlafen zog ich mir eine dunkelblaue wollene Skimütze über den Kopf. Meine Hände steckten in Fäustlingen, die vorn offen waren – für den Fall, dass ich mir eine Erfrierung holen sollte. Dann drei Paar Socken, lange Unterhose, zwei Pullover, davon einer aus leicht geölter Wolle, was sie wasserabweisend macht, ein klassischer Guernsey-Fischerpullover. Gerade richtig also für die Berge und sehr strapazierfähig. Selbst drinnen musste man vorsichtig sein.
Von hier oben sah das Dorf für alle Welt aus wie ein kleiner Konvoi von Frachtdampfern mit beladenen Decks. Seine flachen Dächer schubsten und drängelten sich und trugen Stapel von Brennholz, Kleinholz zum Feuermachen, dünne Äste, Wurzeln, Tamarisken und Heu. Die Schotten alle dicht wegen Sturm, während seltsame graublaue Rauchschwaden von Holzfeuern in der frühen Morgenluft waberten. Vor allem war es immer still. War das Wetter gut, dann ließ man die Tiere hinaus an die frische Luft, wo sie sich selbst überlassen blieben. Doch liefen sie selten weit, sondern trieben sich eher in der Nähe herum. Sie waren sehr gesellig und hatten ihre eigene Hackordnung. Sie mochten die Nähe zum Menschen und standen fast gleichberechtigt neben den Dorfbewohnern. Wenn sie Durst hatten, fraßen sie Schnee.
Auf halber Höhe der Außenmauer gab es noch eine dritte Glasscheibe. Diese war grün und matt. Wenn die Sonnenstrahlen am Ende auch sie erfassten, wurde meine Kammer in ein grandioses grünliches Licht getaucht, das ihr die Anmutung einer Klosterkapelle oder einer Einsiedlerklause verlieh. Solche farblichen Wonnen müssen die Seelen der Mönche vor langer Zeit erhoben und sie im Glauben an die Heiligkeit des Lichts und der für das Auge sichtbaren Farbigkeit der Natur bestärkt haben. Kleine Freuden wie diese ließen das Leben hier nicht nur erträglich sein, sondern reich. Der Winter machte das Licht zu einem kostbaren Gut, und anders als in den Polarregionen musste man hier nicht mit endlosen Stunden der Dunkelheit fertigwerden. Man nutzte jedes bisschen Sonne, um sich zu wärmen, und wann immer es ging, setzten die Leute sich zum Spinnen und Weben auf die Dächer ihrer Häuser.
Als ich meine Kammer bezog, habe ich sie als Erstes mit einem alten hölzernen Skistock vermessen. Der hatte oben eine Lederschlaufe, unten einen Teller aus Peddigrohr und mehr Ähnlichkeit mit den Stöcken, die ein Shackleton oder ein Scott auf ihren Expeditionen mitgeführt haben mochten, als mit denen, die man heute in den schicken alpinen Wintersportorten sieht. Der Raum war zwei Meter fünfundachtzig breit und vier Meter fünfundzwanzig Zentimeter lang. Der Grundriss war aber kein exaktes Rechteck. Von den gegenüberliegenden Seiten war eine etwa dreißig Zentimeter länger als die andere, was der Kammer eine interessante Perspektive gab. Hier war nichts im rechten Winkel oder gerade. Und das war mir gerade recht. Raute oder nur rautenförmig? Keine Parallelen. Keine Geraden. Keine Senkrechten. Selbst die Wände waren nicht im Lot und trafen eher im Achtzig-Grad- als im Neunzig-Grad-Winkel auf den Boden. Vielleicht war das hier ja ein buddhistisches Paralleluniversum. Hier war alles leicht schräg. Genau wie der griechische Lyriker Konstantinos Kavafis (er lebte und starb im ägyptischen Alexandria) es sich gewünscht hätte.
Das Loch in der Mauer
Bei gutem Wetter konnte ich zusehen, wie das Sonnenlicht allmählich den Berg herunterwanderte, während ich im Bett lag und las. Für mich war dieser Berg wie ein ganz spezieller Freund. Sein gekrümmter Rücken glich dem Bug eines alten Kriegsschiffes. Vom Gipfel aus konnte man den K2 und den gesamten Karakorum überblicken, über zweihundert Kilometer nach Norden. Dazwischen lag ein weites Meer von Bergen. Im Westen das Nun-Kun-Massiv, im Osten Changthangs ausgedehnte Hochlandsteppen; nach Süden hin die Gipfel von Kishtwar. Ein unvergesslicher Anblick. Einer Erstbesteigung gleich. Einen Berg zum allerersten Mal zu besteigen ist eine eigentümliche und berauschende Erfahrung zugleich. Alles ist frisch, sogar der Blick. Ein stilles Gefühl der Euphorie. Man hat es geschafft. Fühlt sich erhoben. Zwanzig Minuten auf dem Gipfel, das ist alles. Gerade genug, um ein kleines Steinmännchen aufzuschichten. Eine Tasse Tee aus einer Thermoskanne. Dann wieder hinunter, ehe es dunkel wird.
Jeden Morgen machte sich das Sonnenlicht auf seinen langen Abstieg herab vom Gipfel über die Kämme und steilen Abhänge. Manchmal quälend langsam, dann wieder hüpfend und springend. Mein Stundenglas, mit dem ich den Lauf der Sonne vorzeichnen konnte, bis sie auf die weiß gekalkten Mauern des buddhistischen Klosters traf. Von da glitt die Sonne über abgeerntete Terrassenfelder herunter bis ins Dorf, das zwischen allerlei Geröll lag, den Überresten einer riesigen Endmoräne.
Schließlich kam die Sonne in meine Kammer, aber nicht zum Fenster herein, wie man vielleicht meinen möchte, sondern durch ein Loch in der Stirnwand, wo die Tür war. Die Tür bestand aus drei mit der Axt behauenen, zusammengedübelten Holzbrettern. Wie alle Türen hier in Zanskar war sie nur etwa neunzig Zentimeter hoch, die Schwelle, über die man steigen musste, maß wenigstens dreißig Zentimeter. Das sparte Holz und schützte vor Zugluft. Das Holz hatte Risse, darum hatte ich auch über die Tür einen Rupfensack gespannt, um Wind und Schnee abzuwehren. Das hereinfallende Licht war scheckig, die Angeln aus Leder. Einzig ein krummer Nagel hielt die Tür zu, darum hatte ich alte Holzski dagegen gelehnt. So konnte der Wind nicht herein und auch nicht die Hunde, die draußen auf den Dächern herumstreunten.
In die Stirnwand neben der Tür hatte man ein paar Holzstifte versenkt, an denen sonst die Familie ihre selbst gesponnenen Umhänge aufhing. Diese waren von dunkelroter oder rotbrauner Farbe, die fast ins Purpurrote ging. Sie waren aus Wolle und sehr warm. Als ich die Kammer bezog, hatte man die Umhänge entfernt. Dabei war aber ein Holzstift aus der Wand geflogen und hatte ein kleines Loch hinterlassen. Und durch dieses Loch zeigte sich seither die Sonne zuerst und schickte einen Pfeil von silbernem Licht herein, der diagonal durch den tanzenden Staub schnitt, ehe er direkt über meiner Schulter auf der gegenüberliegenden Wand auftraf und sich auf dem grünen Chintz-Wandbehang mit seinem Blumenmuster niederließ. Dann hörte ich für gewöhnlich auf zu lesen und beobachtete, wie der Strahl langsam wanderte, während die Sonne aufstieg. Es war, als wäre ich ein Häftling, aber ein williger. Dieser feine Lichtstrahl war wahrhaft ergötzlich.
Gewöhnlich kramte ich dann Streichhölzer hervor, um ein Räucherstäbchen anzuzünden, was mit vor Kälte steifen Fingern gar nicht so einfach war. Ich beobachtete den blauen Rauch, wie er träge durch meine Kammer trieb. Ein weiterer kleiner Teil eines Rituals, eine Opfergabe an die lokalen Gottheiten. Und die Götter hielt man sich besser gewogen. Wenn sich die Luft nicht regte, stieg der Rauch des Räucherstäbchens als dünne Säule auf, die sich ganz wie ein Seidenstrumpf langsam weitete, sich einen halben Meter in die Höhe hob und dabei höchst anmutige Kräusel bildete, die langsam immer breiter wurden. Sie krümmten sich, kehrten sich um, als wollten sie einander einholen, ehe sie in einen Wirbel von ganz eigenem Zauber ausbrachen, geradeso als wollten sie die Winde, die um die Gipfel fegten, nachahmen. Tatsächlich war der Geruch von Weihrauch ein unverzichtbares Element aller Rituale, die hier im Tal geübt wurden. Opferungen an die lokalen Gottheiten waren vor Reisen und anderen bedeutenden Anlässen unerlässlich. Diese Gottheiten waren wie die Berge, in denen sie ihren Sitz hatten, so viel größer als man selbst. Ihnen gebührte Respekt. Weihrauch rief Demut und Achtung vor der natürlichen Welt hervor.
Dieser erste Sonnenstrahl des Tages war für mich so wichtig, dass ich das Loch nie verschloss, obwohl es hinaus in die bittere Kälte ging. Irgendwie war es eine direkte Verbindung zu der Welt, die zu erforschen ich gekommen war. Jeder Tag hatte seinen eigenen Rhythmus, seine ureigensten Einsichten. Langsam wurde mein Geist dabei sehr ruhig und wach. Ich wurde zum stillen Beobachter und machte Bilder in meinem Geist. Eine Sprache der Bilder.
Erst wenn die Sonnenstrahlen direkt auf das Fenster fielen, begannen die Eisfarne zu schwinden. Nur wenige Minuten später war es, als hätten sie nie existiert. Die silberne Bildergalerie wurde zu Dunst, aber ich wusste, dass sie am Abend wieder da sein würde wie ein guter Freund oder eine geheime Geliebte. Sie würden wieder- und wiederkehren. Nacht für Nacht. Ein sichtbares Zeichen, ein Talisman, gleich der Kerzenflamme, in deren einzigem Licht ich las, bis die Sterne sich zeigten. Ich war im harten Griff des Winters, aber auch hingerissen von der großen Schönheit und der tiefen Stille. Der Zauber des Winters legte sich nicht nur über das Dorf, sondern über das ganze Tal.
Zeit und Einsamkeit
Den Winter über war ich ohne Uhr oder irgendwelchen Kontakt zur Außenwelt, es gab also keinen Grund, im herkömmlichen Sinn die Zeit zu messen. Zeit existierte nicht wirklich. Von ihr war nur ein Fragment ihrer selbst geblieben. Zeit bemaß sich hier nach Schneefällen und Sommerweiden, nach Futter für die Tiere und ihrem Zustand, an den Augen der Menschen und der Laune der Kinder, daran, wie lange es dauerte, ein Feuer zu machen, eine Kuh zu melken oder ein Schaf zu scheren, ein kleines Feld zu pflügen oder einen Topf voll Bier zu brauen. Das waren reale Zeitmaße, und darüber hinaus gab es noch die Zeit, die es brauchte, um mit einer Herde von Schafen oder mit ein paar Yaks ins nächste Tal zu ziehen. Man fragte die Leute nicht: »Wie alt bist du?«, sondern schlicht: »Wie viele Weiden hast du gesehen?« Eine so wichtige Rolle spielte die Wanderung zu den üppigen Sommerweiden. Genauso gut könnten sie auch gefragt werden: »Wie viele Winter hast du gesehen?« Oder: »Wie viele Yaks besitzt du?«
Und dann war da noch die buddhistische Zeit, die monastische Zeit und die Zeit, die es dauerte, einen Leichnam zu verbrennen. Die Zeit, die man brauchte, um nach Lhasa und wieder zurück zu gehen oder um ein Yak zu beladen. Die Zeit, um ein Kloster zu errichten, die Zeit, Gestein zu Farbpigmenten zu vermahlen. Und die Zeit, ein buddhistisches Wandbild anzufertigen, das tausend Jahre überdauern würde. Die Zeit, um Mantras und Sutras zu rezitieren, und die Zeit, die Sterne zu zählen.
Wenn man sich der Zeit nicht bewusst ist, dann hat man auch nicht das Gefühl, dass sie vergeht. In einem gewissen Sinn ist immer jetzt. Entfernung bemaß sich hier nach Tagen, der Winter nach Schneehöhe, die Familie nach Reinkarnationen. Die Reise des Lebens trug sich stets in drei, wenn nicht vier Dimensionen zu. Die Zeit war zyklisch und linear. Eine buddhistische Spirale. Oder war es ein Wirbel? Der Geist kann sich, so scheint es, in zwei, wenn nicht drei unterschiedliche Richtungen gleichzeitig bewegen. Ein schwarzes Loch, das die Gedanken absorbiert. Was bleibt dann noch übrig? Wohin ist der Geist gegangen? Und wo ist der Denker, wenn keine Gedanken mehr da sind? Das Ganze hat seine eigene Logik, wiederholt sich wie ein Mantra, doch je tiefer man sich in das Mantra versenkt – oder in das Schweigen des Schnees –, desto klarer wird es offenbar. Zeit im Buddhismus ist etwas Merkwürdiges. Auf der einen Seite gibt es den tibetischen Kalender, der den Tagesablauf im Kloster, Feste und Gebetszeiten nach den Mondphasen regelt. Auf der anderen Seite gibt es die philosophische und psychologische Dimension der Zeit, die tatsächlich eine sehr dehnbare Angelegenheit sein kann, sodass man irgendwann bei dem ist, was im Buddhismus als »Leerheit« bezeichnet wird, wo Zeit ganz aufhört.
Der Winter war hier eine Zeit des Hungers, besonders dann, wenn noch spät oder sehr viel Schnee fiel. Wölfe waren dann ein alltäglicher Anblick, und sogar Schneeleoparden kamen herunter in die Dörfer, wenn ihr Hunger stark genug war. Oben im Tal fanden sich viele Wolfsfallen. Das Leben hier kreiste um Tiere, die Jahreszeiten und den Fluss. Im Sommer waren die kleinen glitzernden Bewässerungskanäle ganz auf das Schmelzwasser der Gletscher hoch über den Dörfern angewiesen. Die Mönche trugen ihren Teil dazu bei, um den Wechsel der Jahreszeiten im Auge zu behalten, ebenso wie die Astrologen und die Heilkundigen, die amchi. Die landwirtschaftliche Zeit spielte eine wichtige Rolle.
In manchen Dörfern wurde das Wissen um die Zeit vererbt. Es gab Familien, die mit der zerklüfteten Silhouette der Berge so vertraut waren, dass sie daran, wie die Sonne aufging, ablesen konnten, wann die richtige Zeit ist, die Felder zu pflügen. Ein Wissen um die Beschaffenheit des Horizonts, das vom Vater auf den Sohn weitergegeben wurde. Das ganze Dorf hing davon ab, dass die Menschen Zeitpunkte richtig bestimmten. Wenn sie sich irrten, und es gibt starke Schneefälle, dann war die ganze Ernte verloren. Manchmal errichteten sie Steinmännchen auf einem Bergkamm oder orientierten sich an bestimmten Gebäuden als Anhaltspunkt.
Es gab eine Zeit, um zu ernten, und eine Zeit, um zu heiraten, eine Zeit, um Feste zu feiern, und eine Zeit, um wiedergeboren zu werden. Eine Zeit für die Kinder, groß zu werden. Alles war mit allem verknüpft. Jedes Dorf im Tal spielte seine spezielle Rolle, und alle waren auf eine Art und Weise miteinander verbunden, die nicht immer sichtbar war. Über Generationen hat man miteinander Handel getrieben, und Tiere gehörten so selbstverständlich zu ihrem Leben wie Kinder. Es existierten unsichtbare Bande von Handel und Heirat, man tauschte Saatgut und half sich gegenseitig bei der Arbeit. Es bestand eine religiöse Kontinuität, die zirkulär in ihrem eigenen Tempo verlief.
Zeit bemaß sich in Schweigen und Meditation in Jahren. Zeit bekommt im Buddhismus oft eine langfristige Perspektive, ähnlich der geologischen oder sogar der kosmischen Zeit. Vielleicht war es kein Zufall, dass Zanskar immer so viele Yogis beherbergt hat, auch wenn man sie nicht zu Gesicht bekam. Sie lebten in abgelegenen Höhlen, manchmal eingemauert für ein langes Retreat von drei Jahren, drei Monaten, drei Wochen und drei Tagen. Ab und zu konnte man vielleicht hoch oben auf einem Kamm oder in einer Bergwand jemanden sehen, der ihnen Essen brachte, aber mehr auch nicht. Zeit wurde auch in Ehrfurcht und Dankbarkeit gemessen. Jemand, der sich entschloss, in einem Tal wie diesem allein zu leben, war dennoch nie einsam. Denn Berge und Berggeister waren immer zugegen. Hier herrschte absolute Freiheit, auch wenn die Luft dünn war. Dein Leben spannte sich auf zwischen Berg und Fluss. Eine Opfergabe.
Täglich ging ich hinunter zur Brücke, um zu kontrollieren, wie stark der Fluss schon zugefroren war, und sann seinem Lauf nach. Ich musste mich mit dem Fluss und all seine Launen vertraut machen, damit ich all seine Eigenarten, seine eigenwillige Schönheit auch wirklich verstand. Ich inspizierte die ins Eis gehauenen Wasserlöcher, im Winter die einzige Wasserquelle, die das Dorf hatte. Je weiter der Winter fortschritt, desto dicker wurde das Eis und desto tiefer die Löcher. Kleine Kinder mussten dann alte Konservendosen mitnehmen, um beim Füllen der Metallkanister zu helfen. Das war eine langwierige, mühselige Prozedur, der ein Fußmarsch von einigen Hundert Metern hinauf ins Dorf folgte. Sie bekamen ganz aufgesprungene Finger und Hände davon. Flüsse bewegen sich, und das gilt auch für das Eis. Manchmal konnte man nachts hören, wie es kracht.
Abgeschiedenheit aber ist nicht das Gleiche wie Isolation. Abgeschiedenheit ist eine Kraft, eine Art von Zufriedenheit, ein Weg, für den man sich entschieden hat. Isolation ist dagegen ein von außen auferlegtes Alleinsein. Es handelt sich hier um zwei gänzlich verschiedene Seelenzustände, die aber dennoch zusammenhängen. Isoliert zu sein kann Abgeschiedenheit fördern, doch das ist nicht jedermanns Sache. Zeit und Abgeschiedenheit nähren sich beide von Stille. In der Stille liegt eine ganz eigene Kraft, und man muss lernen, sie sich zunutze zu machen. Selbst die Kälte hat ihr eigenes Echo, das Eis seine eigene Musik.
Tief drin wusste ich, dass diese Art der Abgeschiedenheit ein seltenes Gut war, das ich höher als alles andere schätzte. Ich war mir ganz und gar der Tatsache bewusst, dass ich Zeit brauchte, um ich selbst zu werden. Ich hatte zudem das merkwürdige innere Gefühl, an der Schwelle zu etwas Außergewöhnlichem zu stehen. Dies war eine Forschungsexpedition in eine andere Dimension. Abgeschiedenheit. Ich war von weither gekommen, um ihre Früchte zu kosten. Man kann die Stille schmecken, sie einatmen, als würde man guten Wein verkosten, aber in der Stille hat keine Täuschung Bestand. In ihr tritt der Sinn des Lebens völlig klar zutage. Denn absolute Stille ist, wie der absolute Nullpunkt, letztlich ein Geisteszustand.
1 Die Straße nach Zanskar
November 1976
Zoji La
Berge spielten in meinem Leben schon seit vielen Jahren eine wichtige Rolle. Man stattet ihnen ab und an einen Besuch ab, verbringt ein paar Tage mit ihnen, und sie werden zu Freunden. Man denkt an sie, wenn sie nicht da sind. Man spricht über sie voller Zuneigung. Man plant rund um sie Exkursionen. Man legt weite Entfernungen zurück, um sie besuchen zu können. Und langsam werden sie ein Teil von einem selbst. Ganze Gebirge werden zur eigenen Großfamilie.
Doch ein so anspruchsvoller Trip wie der zum gefrorenen Fluss ist nichts, was man mal eben so macht. Solche Reisen verlangen sorgfältige Planung. Bis Mitte November ins Zanskar-Tal zu kommen war ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich hatte weniger als eine Woche für die Anreise und musste drei Pässe überqueren, ehe die Schneefälle einsetzten.
Um drei Uhr früh warf der Zollbeamte am Delhi Airport einen Blick auf mein ganzes Gepäck und schüttelte ungläubig den Kopf. »Wohin wollen Sie, Sahib? Ladakh, Sahib? Sehr kalt, Sahib. Zu viel Schnee.«
Statt mein Gepäck zu kontrollieren, wofür er eine halbe Stunde gebraucht hätte, markierte er nur jede Tasche mit einem Kreidekreuz, wobei er weiter ungläubig den Kopf schüttelte. Dann blickte er mir geradewegs in die Augen. Er hatte mich durchschaut und verkündete stolz seinen Befund: »Zurück zur Natur.«
Von Delhi aus reiste ich dritter Klasse mit dem Frontier Mail1. Zu jener Zeit fuhr der Zug an der Nordwestgrenze Indiens entlang von Bombay bis hinauf nach Peschawar. Von den Lautsprecherdurchsagen verstand ich nur die Stationen auf unserer Strecke. »Bahnsteig vier – Panipat, Karnal, Ambala, Ludhiana, Jalandhar, Amritsar.« Es wimmelte nur so von Typen, die chai verkauften. »Chai, chai, chai.« Ein halbes Dutzend Gepäckträger in rotem Lendenschurz und speckigem Turban balancierten mein Gepäck auf dem Kopf, wuselten durch die Menge der Pendler, die ihrerseits von dürren Bettlern belagert wurden. Eine Zugfahrt dritter Klasse im Punjab ist eine Lektion fürs Leben. Harte Sitze, enger Körperkontakt und überaus bunt.
In Amritsar tauschte ich mein gesamtes Geld bei der Grindlays Bank2 um. Draußen vor der Bank saß ein Wachmann, ein Sikh, in verblichener Uniform, das Gewehr vorsichtig über die Knie gelegt. Drinnen an der Decke rotierten riesige Ventilatoren träge in kreisrunden Bahnen. Berge von Dokumenten in dreifacher Ausfertigung waren mit großen Steinen beschwert. Ich bekam zusammengeklammerte Bündel von Fünf- und Zehn-Rupien-Scheinen, manche zwei, manche vier Finger dick. Ich steckte sie in einen alten Kopfkissenbezug. Es war der Gegenwert von dreihundert britischen Pfund, und sie mussten für den ganzen Winter reichen. Anschließend ging es nachts bei Vollmond auf einer Nebenstrecke per Dampflok weiter nach Pathankot und von dort weiter per Bus. Über das Pir-Panjal-Gebirge und den Banihal-Pass (heute gibt es dort einen Tunnel)3 gelangte ich schließlich nach Kaschmir.
Dort stattete ich der Tyndale Biscoe School4 einen Besuch ab, deren Direktor, Reverend John Ray, mich im Wohnheim der Church Mission School übernachten ließ. Es wurde geleitet von einem gewissen Chandra Pandit, dessen Vater früher als sirdar, als Führer der einheimischen Träger, am K2 tätig gewesen war. Chandra war brahmanischer Christ mit einer Vorliebe für Flaschenbier. Es stand immer eine Kiste hinter dem Sofa. Vom Kaminsims aus hielten Krishna und die Jungfrau Maria gemeinsam ihre schützende Hand über seine Wettgeschäfte.
Im Wohnheim machte ich die Bekanntschaft von zwei sympathischen Jungs aus Ladakh, die sich als die Söhne der Königin von Ladakh5 herausstellten. Zu jener Zeit hätte ich mir das nie vorstellen können, aber schon im folgenden Sommer sollte ich sie beim Wahlkampf um einen Parlamentssitz als Vertreterin für Ladakh unterstützen. Meine Arbeit als Wahlhelfer bestand allerdings nur darin, in einem abgelegenen Dorf auf viertausenddreihundert Meter Höhe (vermutlich das höchstgelegene Wahllokal der Welt) mit Reißnägeln Plakate an einer Stalltür zu befestigen. Die männliche Jugend von Ladakh ist übrigens ausgesprochen findig. Wenn sie im Januar nach Kaschmir hinuntermussten, schlitterten sie auf ihren Schultaschen die verschneiten Abhänge des Zoji La6 hinunter, fast so wie beim Rennrodeln. Mehrere Hundert Meter in einem Rutsch sozusagen. Dazu braucht es Geschick und gute Nerven.
In den Embee Stores auf dem Basar von Srinagar deckte ich mich mit Proviant für sechs Monate ein. So etwas schenkt höchste Konzentration. Reis und atta (Mehl) in Tüten, Tee, Zucker, eine große Dose Kekse, sechs runde Dosen Amul-Schmelzkäse, sechs Dosen Baked Beans, Nescafé, Milchpulver, Seife, Suppen, Marmelade im Glas (in den Ampelfarben rot, gelb und grün), Erdnussbutter, Salz, Vermicelli-Nudeln, Makkaroni, mehrere Gläser Limetten-Pickles, eine Fünf-Kilo-Vorratspackung Tamarindenpaste bekannt als imli (dunkel, bitter und pappig), ein Dutzend Dosen Sardinen aus dem Indischen Ozean, zwölf Päckchen getrocknetes Soja-»Fleisch« (nur für Notfälle, ich hasste das Zeug), drei Dosen Thunfisch (eine für Weihnachten, eine für Neujahr und eine für meinen Geburtstag), drei Dosen Ananas in Scheiben, einen Schottischen Früchtekuchen und einen Christmas-Pudding, Muskat, Garam Masala, Chilipulver, Kurkuma, Pfeffer, Trinkschokolade, eine Tüte Toffees, zwei Dutzend indische Bournville-Schokoriegel sowie eine Flasche extrastarkes Bulldozer-Lagerbier. Auf dessen Etikett prangte ein markiger Bulldozer, bestens geeignet für den Straßenbau. Nur dass es in Zanskar keine Bulldozer gab. Und Straßen schon gar nicht. Zumindest damals.
Doch die Straße würde mit Sicherheit kommen, ja sie schob sich Stück für Stück voran. Nach zehn Jahren hatte sie es bis Panikar geschafft, und nun schlängelte sie sich langsam über den Pense La. Was die Straßenarbeiter hier machten, war mühseligste Handarbeit – zwei Mann, eine Schaufel. Einer am Schaufelstiel, der andere per Seil am Schaufelblatt, bewegten sie sich völlig synchron. Eine durch und durch hemdsärmelige Arbeitsweise. Der eine grub, der andere zog den Aushub zur Seite. Genial. Gelegentlich sah man auch einen Kompressor, der die Energie für die Pressluftbohrer lieferte, mit denen Löcher in große Felsblöcke gebohrt wurden, um sie zu sprengen. Eine langsame und langwierige Angelegenheit. Aber jetzt im Winter waren alle Bauarbeiter zu Hause in Nepal und Bihar.
Schließlich kaufte ich noch eine Flasche Orangen-Gin und in Kargil eine Flasche XXX-Rum, sicher aus Armeebeständen abgezweigt. Dieser Rum war ein Geschenk des Himmels. Aber es war nur eine Flasche, deren wärmender Inhalt sechs Monate reichen musste. Nur in Notfällen zu öffnen. Auch mein Proviant würde sechs Monate reichen müssen, so lange, bis die Pässe im Juni wieder frei sein würden.
Ergänzt wurden meine Essensvorräte durch einige hart gekochte Eier, etwas Kohl und zwei große Kartons mit Obst: sechsunddreißig rote Himachal-Äpfel und ebenso viele Orangen. Ich hatte jede einzelne Frucht in Zeitungspapier eingewickelt, in die Blätter der Times of India und der Hindustan Times von letzter Woche. In den Schlagzeilen ging es um den Ausnahmezustand, den Indira Gandhi verhängt hatte und der noch voll in Kraft war.7 Als Journalist musste man damals aufpassen, was man schrieb. Viele von ihnen saßen noch immer in Gefängnissen, doch die Zeitungen machten weiter. Und auch die Regierungspropaganda lief auf Hochtouren. »Außenminister zurück von Moskaubesuch«; »Premierministerin Gandhi feiert 59. Geburtstag mit Stammesangehörigen in Guwahati«; »Tito übermittelt seine Grüße«.
Mein Obstvorrat gestattete mir also eine Portion Obst täglich über einen Zeitraum von zweiundsiebzig Tagen, womit ich über die erste Winterhälfte kommen würde. Der Versuch einer Skorbut-Abwehrmaßnahme. Als ich den Zoji La überschritten und Ladakh betreten hatte, waren die Äpfel und Orangen alle gefroren, ebenso wie der Kohl. Also taute ich in Padum meine Obstration neben dem Behelfsherd auf, während dem Kohl am besten mit einer kleinen Säge beizukommen war. Selbst hart gekochte Eier wurden schockgefrostet. Ich wärmte sogar alte Batterien auf dem Ofen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Wenn sie allerdings zu heiß wurden, explodierten sie und schleuderten heißes Graphit wie Schrapnellkugeln durch den Raum. Der Geist wird sehr konzentriert, wenn man ein halbes Jahr vorausplanen muss. Es war, als wäre man auf einer einsamen Insel gestrandet. Nur gab es hier weder Palmen noch Korallenbänke, und es war entschieden kälter.
Nachdem ich meinen Proviant zusammenhatte, bestieg ich den letzten Bus des Jahres nach Ladakh. Zuvor hatte ich allerdings dem örtlichen Polizeichef einen Besuch abstatten müssen, um überhaupt einen Sitzplatz zu bekommen. Der Ticketheini hatte mir nämlich erklärt, es gäbe keine Plätze mehr – und er wollte einhundert Rupien extra und im Voraus als Bakschisch … die ich nicht erübrigen konnte. Daran hätte meine ganze Expedition scheitern können, also stieg ich in ein Taxi und ließ mich zum Polizeichef bringen, um mich ganz offiziell zu beschweren. Irgendwie erwähnte ich – so nebenbei – Tyndale Biscoe und Mr Ray, was nicht ohne Wirkung blieb. Allein die Erwähnung des Namens von John Ray machte alles klar. Der Polizeichef griff zum Telefon, stauchte den Mann am anderen Ende der Leitung zusammen, wobei er irgendetwas von »krummen Touren« sagte, für die zu dieser Jahreszeit kein Platz sei. Dann legte er auf und lächelte. Sein Bannspruch hatte Wunder gewirkt. Ich war zutiefst dankbar.
Und ich bekam den besten Sitzplatz im Bus, direkt neben dem Fahrer.
Mein letztes Telegramm schickte ich von einem kleinen, entzückenden Postamt mit Rosenbeeten und Kosmeen, die über die Schutzmauer nickten: »ZOJI LA OFFEN. AUFBRECHE MORGEN.«
Den Zoji La zu überqueren, um in die Grenzstadt Kargil zu kommen, war allerdings nur der Auftakt. Ich musste Zanskar erreichen, ehe die Pässe zu waren. Der Schnee stand schon lange aus. Außerdem musste ich ein paar Männer mit Pferden finden, die bereit waren, den Weg über den Pense La nach Zanskar zu machen – ein Marsch von etwa einer Woche. Die Zeit war also wirklich sehr knapp. Ich durfte nicht eine Minute vergeuden.
Im frühen Morgenlicht zogen wir am Dal-See vorbei und wanden uns durch Zedernwälder hinauf nach Sonamarg. Einer der Mitreisenden erweckte meine Neugier: Armeeuniform, rotes Barett, dem Aussehen nach Tibeter. Er gehörte zu den Khampa8 und war Mitglied der »22er«9, einer halb offiziellen Guerillaeinheit, die in Tibet hinter den chinesischen Linien aktiv war. Eine Zeit lang wurde sie von der CIA unterstützt und operierte vom nepalesischen Mustang aus, doch vor Kurzem hatte die CIA ihre Hilfen eingestellt. Und so hatten sich die 22er unter der Leitung von Ngari Rinpoche, einem jüngeren Bruder des Dalai-Lama, neu formiert. Ich hatte ein Empfehlungsschreiben an Ngari Rinpoche dabei, ihn in Dharamsala aber knapp verpasst.
Um den Zoji La ranken sich viele Geschichten. Oft sprachen die Leute von dem Pass wie von einem lebenden Wesen, das im selben Atemzug Angst und Bewunderung erregt. Manche nannten den Pass auch »Shurji La« nach Shiva, der allmächtigen Hindu-Gottheit, die das Universum erschafft, bewahrt und verwandelt. Shiva der Zerstörer – höchst passend, wenn der fahrbare Untersatz abstürzt.
Im Schritttempo krochen Armeekonvois die steilen Haarnadelkurven hinauf. Man wartete stundenlang, und dann ging es plötzlich zu wie beim Rodeo, wenn quietschbunte Laster und überladene Busse rangierten, um sich Platz zu schaffen. Manchmal blieb ein Laster liegen und wurde einfach an den Straßenrand geschleppt. Wenn die Bremsen versagten, dann war’s das. »Vertrau auf Gott« und die Mechaniker des Militärs. Der Pass war nur ein halbes Jahr lang offen.
Unterhalb der Straße erkannte man den alten Handelsweg, der gerade genug Platz bot, dass zwei beladene Tragetiere aneinander vorbeikamen. Und für eine Fernsprechleitung. Es wurden Geschichten erzählt, wie ganze Karawanen im späten Frühjahr abstürzten. Die Karawanen, die sich bereits zu Jahresanfang auf den Weg machten, konnten unten in Kaschmir die höchsten Preise fordern. Doch Lawinen waren jetzt ebenso häufig wie gefährlich. Jetzt aber waren es die Armeekonvois, die es erwischte. Weit unten im Tal konnte man die Trümmer mehrerer Laster und Busse sehen, die in den Abgrund gestürzt waren. Schneepflüge hielten im Winter den Pass offen, solange es ging. Der Straßenbau war ein gefährliches Geschäft und oblag in grenznahen Orten wie diesen grundsätzlich den Pioniertruppen der Armee. Den ganzen Weg herauf säumten Schreine und Gedenktafeln für verstorbene Soldaten den Straßenrand.
Erste Anzeichen
Während sich der Bus so den Zoji La hinaufschob, geriet mein Geist, halb vor Müdigkeit, halb vor Faszination, ins Träumen, während die Zedernbäume an meinen Augen vorbeihuschten und sich der Blick auf schneebedeckte Berge öffnete. Ich hatte nun Zeit, darüber nachzudenken, wo meine eigene Reise tatsächlich begonnen hatte, wohin ich unterwegs war und wonach ich suchte.
Reisen nehmen ihren Anfang oft viel früher, als uns bewusst ist, und zwar gewöhnlich schon in der Kindheit. Mein Großvater mütterlicherseits war ein ausgezeichneter Navigationsoffizier, der in beiden Kriegen auf Schiffskonvois Dienst getan hatte. Seinem kleinen, dünnen blauen P&O-Notizbuch (von der Peninsular and Oriental Steam Navigation Company) zufolge wurde ich im Januar 1954 zu Beginn einer extremen Kälteperiode geboren. Seine Einträge waren sehr spärlich: »S[ehr] kalt; SS [sehr sehr] kalt«. Mein erster Eindruck von der Außenwelt war daher wohl der einer weiten weißen Landschaft, in der es nur Schnee und Eis gab. Den Fotos zufolge glitzerten die Bäume weiß vom Raureif. Ein magischer Eintritt in eine kalte, schimmernde Winterwelt.





























