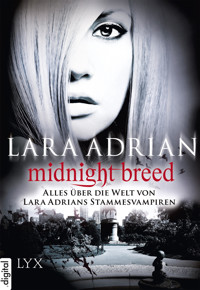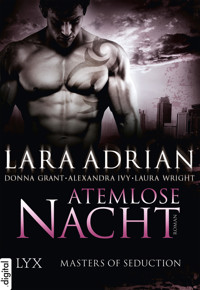9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kelch-von-Anavrin-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Jagd auf den Kelch von Anavrin geht weiter...
Sechs Monate hat der ehemalige Templer Kenrick of Clairmont in einem dunklen Verlies verbracht. Als er endlich wieder frei ist, widmet er sich mit neuem Eifer seiner Suche nach dem magischen Kelch von Anavrin. Eine heiße Spur führt ihn in die Burg Greycliff Castle, die furchtbar verwüstet wurde. Dort findet er die schöne Haven, die ihr Gedächtnis verloren hat. Kenrick glaubt, Haven könnte der Schlüssel zu seiner Suche sein. Und schon bald entbrennt er in heftiger Leidenschaft zu ihr. Doch Havens wiederkehrende Erinnerung fördert ein Geheimnis zutage, das die Liebe zwischen ihr und Kenrick in Gefahr bringt.
Der zweite Band der magischen Serie Der Kelch von Anavrin von Bestseller-Autorin Lara Adrian alias Tina St. John
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
LARA ADRIAN SCHREIBT ALS TINA ST. JOHN
DER KELCH
VON ANAVRIN
Das magische Siegel
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Holger Hanowell
1
Cornwall, England. Mai 1275
Langsam und mit zögernden Schritten trat er über die Schwelle. Er war so lange nicht im Hause des Herrn gewesen, dass er unsicher war, ob er dort überhaupt willkommen sein mochte. Er rechnete kaum damit, dass Gott ihm noch Gehör schenkte. Aber mochte Er ihn nun aufnehmen oder nicht, ihm war das Herz schwer, und er wusste nicht, wo er sich von seinen drückenden Sorgen befreien sollte. Diese Schande hier hatte jedoch er allein zu verantworten; das Geschehen, so glaubte er, werde ihn für den Rest seines Lebens verfolgen.
Edle Sporen aus Silber zierten seine Stiefelabsätze und erzeugten ein leises metallisches Klicken auf dem glatten Steinfußboden, als er den leeren gewölbten Raum durchschritt. Da kein wärmendes Feuer brannte und nicht einmal eine Fackel Licht spendete, herrschte in dem Raum die kühle Stille einer düsteren Gruft. Allein durch das hohe gebogene Fenster fiel trübes Tageslicht. Eine Grabesstille, dachte er voller Grimm, und seine Augen brannten noch von dem Anblick der Verwüstung, der sich ihm bei seiner Ankunft geboten hatte.
Als der Ritter die ganze Länge des Raums durchschritten hatte, verharrte er, die Glieder schwer von den vielen Tagen im Sattel. Seine Kehle war wie ausgetrocknet, sein Gaumen brannte.
Das Haupt mit den blonden Locken in stiller Andacht gesenkt, schloss er die Augen und sank auf die Knie.
»Pater noster, qui es in caelis …«
Das Gebet kam ihm wie selbstverständlich über die Lippen, waren ihm die Zeilen doch so vertraut wie sein eigener Name. Kenrick of Clairmont hatte das Vaterunser unendlich oft wiederholt – wohl hundertmal am Tag, und das eine ganze Woche lang. Denn so gab es die Ordensregel vor, wenn einer der Templer den Tod gefunden hatte. Obwohl er dem Orden nicht mehr angehörte und das Gelübde gebrochen hatte, hoffte er doch, der Glaube möge ihm nicht ganz abhandengekommen sein. Das Vaterunser, das er nun betete, war einem Freund und dessen Familie zugedacht, denn früher einmal hatte Randwulf of Greycliff zusammen mit seiner Gemahlin und seinem Sohn an diesem Ort gelebt.
Bei jedem Atemzug erschwerte ihm der Geruch von verbranntem Gebälk und kaltem Rauch das Sprechen. Ruß bedeckte den Boden der Kapelle, in der er kniete. Ebenso rußgeschwärzt waren auch die Mauern des kleinen Wohnturms dahinter. Der Ort war verfallen, kalt und leblos, und das schon seit einigen Wochen.
Rand und dessen geliebte Familie … es gab sie nicht mehr.
Kenrick brauchte nicht erst nach dem Warum zu fragen, wusste er doch genau, wer hinter den Untaten steckte. Das ganze Ausmaß der Zerstörung trug die Handschrift von Silas de Mortaine, dem Mann, der ihn fast ein halbes Jahr in einem Verlies in Rouen gefangen gehalten hatte. Der Schurke hätte ihn gewiss getötet, wäre Kenrick nicht vor einigen Monaten auf kühne Weise aus der Haft befreit worden. Doch der Gedanke, davongekommen zu sein, bot ihm nun keine Erleichterung mehr. Während er sich von den Folgen der Folter hatte erholen können, waren Rand und dessen Familie einem fürchterlichen Schicksal ausgeliefert gewesen.
Und dies alles seinetwegen.
Alles nur wegen eines geheimen Schwurs, der ihn mit seinem Freund und Waffengefährten verband. Vor über einem Jahr hatten sie in diesem bescheidenen, befestigten Herrenhaus in Cornwall nicht weit von Land’s End das Gelübde gesprochen.
Bei Gott!
Hätte er geahnt, was Rand dadurch auf sich lud, er hätte den alten Freund niemals um seine Hilfe gebeten.
»… sed libera nos a malo …«
Zu spät, dachte er, verbittert von Kummer und Reue. Vor den bösen Machenschaften de Mortaines war niemand sicher. Der Einfluss dieses Mannes war nicht auf die Grenzen eines Landes beschränkt. Er stellte eine fürchterliche Bedrohung dar, denn er war ein wohlhabender Adliger, der sich der schwarzen Kunst bediente und einen kleinen Trupp gedungener Schergen befehligte, die ihm halfen, seine bösen Ziele zu erreichen. De Mortaine begehrte den Drachenkelch, einen legendären Schatz, dessen Ursprung in mystischer Vorzeit lag. Noch während seiner Ordenszeit war Kenrick auf die Geschichten gestoßen, die sich um den sagenhaften Kelch rankten. Tatsächlich hatte er all diese Erzählungen zunächst als bloße Legenden abgetan, bis er schließlich selbst einen Teil dieses sagenumwobenen Horts in Händen gehalten hatte und Zeuge seiner unermesslichen Macht geworden war.
Es gab den Drachenkelch also wirklich, und das Blutbad, das hier angerichtet worden war, lieferte nur einen weiteren Beweis für Silas de Mortaines Absicht, das wertvolle Gefäß für sich zu beanspruchen. Kenrick of Clairmont – immer noch von den Narben seiner Kerkerhaft gezeichnet – sah sich bei dem Anblick, der sich ihm in Randwulfs Burg bot, nur aufs Neue bestätigt, dass man einen Mann wie de Mortaine bekämpfen musste.
Koste es, was es wolle.
»Amen«, murmelte er düster und erhob sich wieder in der Kapelle, deren Wände vom Brand geschwärzt waren.
Kurze Zeit ließ er die Zerstörung des Ortes auf sich wirken. Sein Blick fiel auf das bescheidene Kruzifix, das noch über dem Altar hing, gottlob unbeschädigt. Kenrick unterdrückte den Fluch, der ihm auf der Zunge lag.
Nicht einmal Gott hatte es vermocht, de Mortaine daran zu hindern, diese edelmütigen Menschen hier mit seinem Zorn zu überziehen.
Der Gedanke war gotteslästerlich, insbesondere an einem so geweihten Ort. Schwerer noch wog, dass dies ein Mann dachte, der sich einst dem Dienst Gottes verschrieben hatte, zunächst als Novize und später als Ordensbruder der Armen Ritter Christi vom Tempel Salomons.
Einen Heiligen hatten ihn Rand und andere Freunde in ihrer Jugendzeit oft scherzhaft genannt, da Kenrick ein so edles Gemüt hatte und schon früh nach Wissen strebte.
Aber diese Tage lagen nun weit zurück. Er wollte seine Zeit weder mit alten Erinnerungen noch mit Trauer vergeuden. Die Stunde würde kommen, in der beides möglich wäre, doch nun galt es vor allem, Dinge zum Abschluss zu bringen.
War er früher am Tag noch ganz erpicht darauf gewesen, die kleine Burg zu erreichen, so wollte er den Ort nun so schnell wie möglich wieder verlassen. Seine Kopfhaut juckte unter dem kurz geschnittenen Haar – was ihn immer wieder an seine Gefangenschaft erinnerte, als Haupt- und Barthaar voller Ungeziefer gewesen waren. Bei der ersten Gelegenheit hatte er sich die Haare geschnitten und sich jeden Tag glatt rasiert. Das dunkelblonde Haar trug er nun kürzer, als es bei Männern seines Standes Sitte war. So reichten ihm die Locken nur bis zum Kragen seiner Tunika und dem des gefütterten Wamses. Er kratzte sich am Nacken und verfluchte die bittere Erinnerung an das Ungeziefer.
Wenn er jedoch genau darüber nachdachte, konnte das Jucken auf der Kopfhaut auch mit dem plötzlichen Gefühl zu tun haben, dass er in dieser verlassenen Burg nicht allein war. Er drehte sich auf dem Absatz herum. Eine plötzliche Bewegung schien die Stille gestört zu haben, als atme da jemand an diesem sonst so leblosen Ort. Draußen im Hof bei Kenricks Pferd wartete aber bloß ein alter Mann aus dem Dorf, der das Blutbad mit angesehen hatte. Doch die Bewegung, die Kenrick verspürt hatte, war keineswegs von dem beleibten Mann mit dem grauen Bart gekommen, denn der hatte sich nicht vom Fleck gerührt.
Dennoch hatte Kenrick das untrügliche Gefühl, aus den Schatten heraus beobachtet zu werden. Lauernde, abwartende Augen …
»Ist da wer?«, rief er. Doch seine Stimme verklang im Gewölbe.
Keine Antwort.
Rasch sah er sich in dem kleinen Gotteshaus um und ließ seinen scharfen Blick in jeden Winkel schweifen. Nichts bewegte sich. Seine blauen Augen nahmen lediglich das kalte Mauerwerk und die schlanken Pfeiler wahr. Es war gespenstisch still. Sowohl die Kapelle als auch der Wohnturm schienen leer zu sein. Er war ganz allein an diesem Ort.
Dass sich nur wenige Leute gezeigt hatten, als er eingetroffen war, und kaum ein Bauer oder Nachbar gewillt gewesen schien, über das zu sprechen, was er womöglich mit eigenen Augen gesehen hatte, wäre an jedem anderen Ort beunruhigend gewesen. Nicht aber in Cornwall. In diesem entlegenen Teil des Königreichs verhielten sich die Leute anders. Sie blieben unter sich, gingen ihrem Tagewerk nach und waren nicht gerade dafür bekannt, Fremde willkommen zu heißen.
Kenrick hatte eine beachtliche Summe aufbieten müssen, um den Mann auf dem Hof dazu zu bringen, ihm zu berichten, was sich vor nunmehr zwei Wochen in dem Herrenhaus abgespielt hatte. Die furchtbaren Einzelheiten hallten noch immer in seinem Kopf nach: Unbekannte hatten den Landsitz in der Nacht überfallen, Frauen und Kinder hatten geschrien, schwarzer Rauch war aufgestiegen, als der Wohnturm in Flammen geriet, die Bewohner darin eingesperrt waren …
Kenrick stieß einen lauten Fluch aus. Er verfluchte sich selbst – und ebenso den Allmächtigen, der dieses Verbrechen zugelassen hatte. Zorn loderte in ihm, als er die Kapelle verließ und den Hof betrat.
Der alte Mann aus dem Dorf blickte ihn ernst an und schüttelte schließlich den Kopf. »Wie ich’s Euch gesagt habe, Mylord. Eine schlimme Sache. Wir können’s kaum glauben, dass jemand Sir Randwulf und den Seinen etwas Böses wollte, so freundlich, wie sie immer waren. Aber wir konnten nichts tun, Herr. Wer auch immer diese Verbrecher waren, sie tauchten in der tiefsten Nacht auf und verschwanden wieder wie Geister. Ich glaube nicht, dass diese armen Seelen überhaupt eine Chance hatten.«
Kenrick erwiderte nichts darauf, sondern schritt durch den Hof, erneut von dem Verlust der Freunde überwältigt. Als er kurz innehielt und den Blick über das versengte Frühlingsgras und den matschigen Boden schweifen ließ, stach ihm der umgestürzte und zerbrochene Spielzeugwagen eines Kindes ins Auge.
Ein Bild aus glücklicheren Tagen stieg in seiner Erinnerung auf. Er glaubte, das entzückte Lachen von Rands Sohn zu hören, und sah den Fünfjährigen so deutlich wie damals vor sich, als der Bursche das kleine bemalte Holzwägelchen hinter sich hergezogen hatte. Auch Elspeth war da gewesen, Rands hübsche Gemahlin; sie hatte ihnen zugewinkt – Rand, Kenrick und dem jauchzenden Todd –, als sie an dem sonnendurchfluteten Garten des Herrenhauses vorbeigekommen waren. Da hatte er Rand und dessen Familie zum letzten Mal gesehen. Er war gekommen, um den alten Freund um Hilfe zu bitten; stattdessen hatte er ihnen allen aber nur den Tod gebracht.
»Bleib hier«, bedeutete Kenrick dem alten Mann, denn er wollte keine weiteren Einzelheiten von dem Leid der Freunde hören. »Ich möchte eine Weile allein sein.«
»Wie es Euch beliebt, Mylord.«
Die Abgeschiedenheit würde ihm bei seiner nächsten Aufgabe entgegenkommen, wie er sich eingestand, als er den Dolch aus dem Gürtel zog. An dem ohnehin grauen Himmel hatten sich nun schwere dunkle Wolken zusammengezogen. Nicht mehr lange, und der kühle Sprühregen, der ihm Gesicht und Hände benetzte, würde sich zu einem wahren Wolkenbruch auswachsen – eine willkommene Ausrede, um rasch die Arbeit zu verrichten und sich dann von diesem Ort zurückzuziehen. Schnellen Schrittes verließ Kenrick den Hof und ging seitlich an der Kapelle vorbei.
Im Schatten der westlichen Burgmauer lag ein kleiner Friedhof. Die Gebeine von Rands Vorfahren – allesamt Diebe, Schurken und Huren, wie Randwulf mit einem durchtriebenen Grinsen zu sagen pflegte – lagen dort begraben, unter Grabmalen aus Granit. Drei frische Erdhügel bezeichneten die Ruhestätten der jüngst bestatteten Familienmitglieder. Die Bediensteten waren in der Nähe des Dorfes beerdigt worden. Mochten Rands Nachbarn den Ort auch meiden, zumindest einer hatte dafür gesorgt, dass die Erschlagenen ihre letzte Ruhe in geweihtem Boden gefunden hatten. Als er wieder an den furchtbaren Vorfall erinnert wurde und sich vor Augen führte, wer dort unter den feuchten Erdhügeln begraben lag, kämpfte Kenrick schwer gegen die Trauer und den Schmerz an.
Ehrfürchtig betrat er die eingefriedete Ruhestätte und richtete den Blick auf eine Stelle, die weiter hinten lag, wo ein alter, verwitterter Grabstein das älteste Grab kennzeichnete. Er hatte kaum zwei Schritte gemacht, da stieß der Sporn seines Stiefels auf ein kleines Stück Metall. Er erkannte gleich, dass es Elspeths Halskette war, die er vom feuchten Boden aufhob. Sie hatte das Schmuckstück immer um den zierlichen Hals getragen. Jetzt war das Kettchen gerissen, der Anhänger von all den Tagen auf dem feuchten Boden schmutzig und angelaufen.
Der Verlust würde sie schmerzen, selbst noch im Tode, denn die Kette war ein Geschenk ihres Gemahls gewesen. Kenrick schloss die Finger um das schlichte Schmuckstück, das kühl in seiner Hand ruhte. Da es zu Rands Gemahlin gehörte, war das Mindeste, was er tun konnte, die gerissene goldene Kette zu reparieren und sie dann wieder hierher zurückzubringen.
Als er die Bänder seines Beutels löste, hörte er ein Rascheln in der Nähe. Vielleicht war es auch nur der Regen gewesen, der mittlerweile ein wenig stärker fiel und die abgerundeten Grabsteine benetzte. Er steckte die Kette in den Beutel und erhob sich. Mit einer raschen Körperdrehung stellte er sicher, dass ihm der alte Mann nicht folgte.
Niemand war zu sehen. Nur drückende Stille umgab ihn, wie schon in der Kapelle. Rhythmisch untermalt von dem eintönigen Regen.
Der Dolch fühlte sich schwer und kühl in der Hand an. Das Schwert in dem Gehenk an seiner Seite gab ihm zusätzliche Sicherheit. In seinem Zorn über das Schicksal seiner Freunde wünschte sich Kenrick, er könne Silas de Mortaine gleich hier auf dem verbrannten Stück Land zum Kampf herausfordern.
Es juckte ihn in den Fingern, unheilige Vergeltung zu üben … doch erst kam die Aufgabe.
Kenrick schritt zu dem alten, von Flechten überzogenen Grabmal am hinteren Ende des Friedhofs und kauerte sich davor. Mit der Dolchspitze fand er den verborgenen Spalt in den gemeißelten Verzierungen, die den Schriftzug umgaben. Das Geheimfach, nicht größer als eine Kinderhand, war von den Schneckenverzierungen und Buchstaben verdeckt, die vor Jahren fachmännisch in den Stein gehauen worden waren. Rand und er waren nicht die Ersten gewesen, die sich dieses Verstecks bedienten. Generationen zuvor hatte eine junge Braut der Greycliffs das Grabmal benutzt, um auf diesem Weg Nachrichten und kleinere Geschenke ihres Geliebten aus königlichem Hause zu erhalten.
Jetzt allerdings enthielt der Stein ein weitaus gefährlicheres Geheimnis.
Kenrick zog die scharfe Klinge so lange durch die Ritzen neben dem Fach, bis der Deckstein sich löste. Zoll um Zoll gab der lose Stein mit schabenden Geräuschen nach. Sowie sich die letzte Ecke bewegte, ließ Kenrick den Stein in seine Hand gleiten und spähte in das kleine Geheimfach im Innern des Grabmals.
»Bei allen Heiligen!«, stieß er atemlos hervor, warf den Dolch zu Boden und war kurz davor, mit der Faust auf den Granitstein einzuschlagen.
Das Fach war leer.
Der in Pergament eingeschlagene Gegenstand, den er selbst vor über einem Jahr in das Geheimversteck gelegt hatte, befand sich nicht mehr dort.
Nun starrte er auf das leere Fach, und abertausend Fragen schwirrten in seinem Kopf herum. Was mochte geschehen sein? Wer – um alles in der Welt – hatte das Versteck gefunden? Wer hatte gewusst, wo er suchen musste? Und wie lange war das Pergament schon nicht mehr hier? Wusste der Dieb, wie er sich das entwendete Gut zunutze machen könnte?
Viel wichtiger war noch die Frage, wie er die Suche, die er einst begonnen hatte, nun zu einem Ende bringen sollte, jetzt, da es offensichtlich war, dass er ein wichtiges Unterpfand verloren hatte.
Wie die Dinge lagen, blieb ihm nicht mehr viel Zeit. Er hatte mehrere Jahre gebraucht, bis er überhaupt begriffen hatte, worum es sich bei seiner Entdeckung handelte und wie wichtig es war, die Erkenntnisse denjenigen vorzuenthalten, die sie für ihre eigenen verbrecherischen Belange benötigten. Zahllose Tage und Nächte hatte er damit verbracht, Bücher durchzuarbeiten und seine Aufzeichnungen zu vervollständigen. Jeden Hinweis hatte er aufgeschrieben, hatte in den Legendensammlungen, die in den uralten Berichten des Ordens zu finden waren, nach dem Fünkchen Wahrheit gesucht.
»Großer Gott, wie ist das möglich?«
Der letzte Schlüssel zu seiner Entdeckung, eingeschlagen in ein einzelnes Stück Pergament, befand sich in diesem Augenblick wahrscheinlich in den Händen seiner Feinde.
Er war nicht so weit gekommen, hatte nicht all die Qualen überstanden, um hier und jetzt einfach so zu versagen. Und er würde es nicht zulassen, dass Rand und dessen Familie ihr Leben umsonst verloren hatten. Rasch schob er den kleinen behauenen Granitblock an seine alte Stelle zurück, ergriff den Dolch und stand wieder auf.
Aus den Augenwinkeln nahm er eine Bewegung wahr. Diesmal war er sich ganz sicher. Ruckartig hob er den Kopf und sah sich mit wachsamen Blicken um.
Verflucht, er wurde tatsächlich beobachtet.
Leuchtende Farbtupfer, hier und da von lichtem Buschwerk verdeckt, bewegten sich an der grauen Mauer der Kapelle entlang. Kenrick erhaschte einen Blick auf weiße Haut und wachsame grüne Augen. Die unbekannte Person zögerte nur einen Moment – aber lange genug für Kenrick, um die ansprechenden Züge einer jungen Frau zu erkennen. Schrecken zeichnete sich auf ihrer Miene ab, als sie nur diesen kurzen Moment lang zu Kenrick zurückblickte. Langes, wallendes Haar von rötlich brauner Farbe umgab ihr Gesicht; im grauen Tageslicht leuchteten die üppigen Locken wie Feuer. Die Frau war schlicht gekleidet und gewiss keine Adlige, was allein die Beschaffenheit von Umhang und Rock belegte. Aber weder ihre Züge noch ihre wohlgeformte Gestalt wirkten unauffällig oder gar gewöhnlich.
Obwohl ihn der Tod seiner Freunde und der Diebstahl noch immer aufwühlten, war Kenrick nicht unempfänglich für die Schönheit des unerwarteten Eindringlings. Tatsächlich starrte er beinahe ungläubig in Richtung der Frau, da er inmitten dieser niedergebrannten Ruinen nicht mit einem so unvergleichlichen Anblick gerechnet hatte. Doch die unbekannte Erscheinung ließ ihm nicht viel Zeit zum Schauen. Ihre Augen huschten zu dem Dolch, den er noch in der Hand hielt, ehe sie wegsprang und gleich darauf um die Ecke der Kapelle verschwand.
»Halt!«, rief er ihr nach, wusste allerdings genau, dass die Frau nicht auf ihn hören würde. Rasch eilte er ihr nach.
Er lief zu der Ecke der kleinen Kirche; tief bohrten sich seine Sporen in den aufgeweichten Boden, das Schwertgehenk rasselte bei jedem schweren Schritt. Die Frau schien leichtfüßiger zu sein, denn sie war genauso flink verschwunden, wie sie aufgetaucht war. Sie musste in die Kapelle gelaufen sein, denn sonst gab es kaum Versteckmöglichkeiten. Weder im Hof noch auf den sanft abfallenden Feldern jenseits des verlassenen Wohnturms sah er ihre schlanke Gestalt.
»Wo ist sie?«
»Wie?« Der alte Mann blickte erschrocken auf, als Kenrick mit lauten Schritten in den Burghof eilte. »Wen meint Ihr, Mylord?«, fragte der Alte und sah Kenrick verwundert über den Kopf des grasenden Pferds hinweg an.
»Die Frau. Wo ist sie hingelaufen?«
Der Graubart schaute sich umständlich um und zuckte schließlich nur die Schultern. »Ich habe niemanden gesehen, Mylord.«
»Das ist doch nicht möglich. Die Frau hat mich auf dem Friedhof beobachtet und lief dann gerade eben hier vorbei. Hast du nicht einmal Schritte gehört?«
»Nein, Herr. Hier ist seit vierzehn Tagen keiner vorbeigekommen, nur Ihr und ich. Ich hab nichts gesehen, das schwöre ich.«
Kenrick stieß einen leisen Fluch aus. Er war überzeugt davon, dass er sich die Gestalt nicht eingebildet hatte. Hinten am Friedhof war eine Frau gewesen, und sie hatte ihn beobachtet. Lautlos hielt er nun auf die offene Flügeltür der Kapelle zu. »Zeig dich«, rief er ins Innere. »Du hast nichts zu befürchten.« Dann betrat er das Gotteshaus. »Komm heraus. Ich möchte nur mit dir sprechen.«
Ein leises, kaum wahrnehmbares Geräusch entwich dem umgestürzten Schränkchen zu seiner Rechten. Die Tür des Möbelstücks hing schief in den Angeln. Eigentlich hätte sich höchstens ein Kind darin verstecken können, und doch bot das Schränkchen das einzige Versteck in der ganzen Kapelle. Plötzlich glaubte Kenrick, im Halbschatten des umgestürzten Schränkchens ein Augenpaar zu sehen, das ihn beobachtete. Er trat näher heran.
»Wer bist du?«, fragte er und blieb nun unmittelbar vor dem Möbelstück stehen. Es war keineswegs seine Absicht, das Kind zu erschrecken, denn niemand anders als ein Kind hätte sich dort verstecken können. Aber er wollte Antworten. Brauchte sie. »Was weißt du über diesen Ort?«
Als er keine Antwort erhielt, öffnete er mit der Stiefelspitze die schief hängende Tür, um die verborgene Gestalt sehen zu können. Jetzt vernahm er ein Winseln, und als er sich hinabbeugte, um besser in den Schrank schauen zu können, drang das Knurren eines Tieres aus dem Innern.
»Bei Gott!«
Dort kauerte nicht der heimliche Eindringling vom Friedhof.
Ein kleiner roter Fuchs starrte ihn an, die Zähne gefletscht, die Nackenhaare gesträubt. Das Tier saß in der Klemme: Es konnte nicht durch die geschlossene Rückwand des Schränkchens entkommen, aber auch nicht an dem Mann mit dem Dolch vorbei, der den einzig möglichen Fluchtweg versperrte. Doch in dem Augenblick, als Kenrick zurückwich, stürmte es aus dem Schrank und floh aus der Kapelle in die Sicherheit der umliegenden Felder und Wiesen. Kenrick drehte sich um und sah dem schönen Tier nach. Über seine Lippen kam ein langer Seufzer, denn das alles beunruhigte ihn.
Wo war die Frau?
Wer auch immer sie gewesen sein mochte, es war ihr jedenfalls gelungen, spurlos zu verschwinden.
Als habe sie sich in Luft aufgelöst, dachte er, als er sich auf dem Burggelände umsah, aber nirgendwo eine Spur der lieblichen Frauengestalt entdecken konnte.
»Schätze, es dauert nicht lange, bis all die Tiere kommen und hier rumschnüffeln, weil keiner mehr da ist, sie zu verscheuchen«, meinte der Graubart aus dem Dorf. Er schnalzte mit der Zunge, als er sich Kenrick mit schwerfälligen Schritten näherte. »Aber hier ist nichts Wertvolles mehr, weder für Mensch noch für Tier. Die haben alles niedergebrannt. Nun ist es nur noch ein Ort der Trauer.«
Mag sein, dachte Kenrick. Doch auch er konnte nicht leugnen, dass der Ort nachhaltig und mit äußerster Rücksichtslosigkeit zerstört worden war. Aber noch etwas anderes lauerte hier. Etwas jenseits des Todes und der Asche, etwas, das sich besser verborgen hielt als ein streunender Aasfresser, der inmitten der Ruinen auf Essbares gehofft hatte. Und dieses Etwas besaß üppiges, leuchtend rotes Haar und das schönste Antlitz, das Kenrick jemals erblickt hatte.
Und so sicher er sich war, die Frau gesehen zu haben – wo auch immer sie hingelaufen sein mochte –, so sicher war er sich auch, dass sie nicht weit gekommen war.
2
Bei Einbruch der Dunkelheit ließ der heftige Regen nach. Die Luft war feucht und salzig, da die Regenwolken vom Meer gekommen waren. Kälte drang in den leeren Wohnturm, als Kenrick die Steintreppe zu den verlassenen Gemächern hinaufstieg. Er war jetzt ohne Begleitung. Den alten Mann hatte er bereits vor Stunden fortgeschickt, denn nur so konnte er sich ungestört in der Burg umsehen, in der auch noch nach vierzehn Tagen ein stechender Brandgeruch hing. Allein die Steinmauern hatten den Flammen widerstanden.
Kenricks Fackel flackerte im kalten Luftzug auf der gewundenen Treppe und warf lange, unheimliche Schatten auf die runden Wände. Wäre er für solche Dinge empfänglich gewesen, er hätte auch glauben können, dass ihn Geistererscheinungen umgaben, so lebendig war seine Erinnerung an die geliebten Menschen, die einst in diesem bescheidenen Wohnturm gelebt hatten. Am oberen Treppenabsatz hielt er inne, aufs Neue bestürmt von Bildern und Geräuschen aus glücklicheren Tagen.
Fröhliches Lachen hallte in seiner Erinnerung wider. Die liebevollen Blicke, die Mutter und Sohn und die Ehepartner untereinander getauscht hatten, erschienen vor seinem geistigen Auge, als er das leere Familienzimmer im zweiten Stockwerk erreichte.
Umgestürzt lag ein kleiner Tisch vor dem Austritt zum Söller, die Beine versengt. Sorgsam stellte Kenrick ihn wieder hin, wobei er versuchte, möglichst kein Geräusch zu machen, denn er wollte die heilige Stille des Ortes nicht stören. Vor dem Fenster, das mit Läden versehen war, standen noch immer Elspeths geliebter Lehnstuhl, der Webrahmen und das Tischchen mit ihrem Nähzeug. Alles lag so da, als sei die Dame des Hauses nur kurz weggegangen. Das Licht der Fackel fiel auf das entworfene Muster im Webrahmen, das eine ländliche Szene zeigte, halb fertig und nun von Rauch geschwärzt. Niemand würde diese Arbeit je zu Ende bringen.
Traurig wandte sich Kenrick ab und warf einen Blick auf das große Bett, das die gegenüberliegende Wand der Kammer beherrschte. Leer und zerwühlt stand es noch immer so da wie in jenem Augenblick des großen Schreckens, als der Wohnturm von den Mordbrennern überfallen worden war. Offenbar war Rand aus dem Schlaf hochgefahren und gleich aus dem Bett gesprungen, um sich den Eindringlingen tapfer entgegenzustellen. Seine halb verbrannten Stiefel lagen noch vor dem kalten Kamin, aber sein Schwert und sein Dolch befanden sich nicht mehr in den Scheiden, die auf dem verkohlten Bett lagen, als habe er sie in der Eile dorthin geworfen und schließlich vergessen. Elspeth mochten nur wenige Augenblicke geblieben sein, um sich anzukleiden und den kleinen Todd zu holen, ehe ihr Zuhause in beißendem Qualm, Feuer und Tod untergegangen war.
Sie alle mussten zutiefst erschrocken gewesen sein.
Gebe Gott, dass sie nicht lange hatten leiden müssen.
Plötzlich kam sich auch Kenrick wie ein Eindringling vor, als er in dem Gemach stand, in dem seine Freunde friedlich schlummernd in ihrem Bett gelegen hatten.
Der Geruch des kalten Rauchs hing auch jetzt noch im Raum und an den rußgeschwärzten Wänden. Kenrick wandte sich wieder dem geschlossenen Fenster zu und löste den Riegel, um frische Luft hereinzulassen. Die kühle Nachtbrise umwehte ihn bald, herb und salzig.
Kenrick lehnte sich ein wenig aus dem Fenster und atmete die frische Seeluft ein, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Der Drang, seinen Zorn in die Stille der Nacht hinauszuschreien, war einfach zu stark – selbst für einen Mann, der sich stets zu beherrschen wusste. Er musste sich die Wut und den Kummer von der Seele schreien, und so stieß er einen lauten Fluch aus.
Die bitteren Worte hallten in seinen Ohren nach, und der Zornesschrei gellte durch die Nacht.
Unten am Waldrand schlug sie die grünen Augen auf, der Blick war glasig und von Mattigkeit umwölkt. Der Schrei, von Kummer und Wut beladen, hatte die Stille der Nacht durchschnitten und sie aus dem Schlaf gerissen, dort, wo sie einige Zeit zuvor kraftlos zu Boden gesunken war.
Wie lange mochte sie geschlafen haben?
Vielleicht Stunden, denn Dunkelheit umgab sie nun, dazu die Stille des Todes, wäre da nicht das schmerzerfüllte Wehklagen gewesen, das noch immer in den Baumkronen über ihr widerzuhallen schien.
Zweige und Fichtennadeln stachen sie an der Wange, mit der sie auf dem kalten Boden gelegen hatte. Der Geruch lehmiger Erde vermischte sich mit dem schweren Duft von Kräutern, der an ihrer Kleidung haftete. Etwas Fauliges stieg ihr in die Nase. Es gelang ihr lediglich, den Kopf ein wenig anzuheben und sich blinzelnd umzuschauen.
Im Schutz der kleinen Baumgruppe war sie zusammengebrochen – ja, jetzt erinnerte sie sich wieder.
Sie war schnell gelaufen. Doch schließlich waren ihr die Beine schwer geworden, und sie hatte nicht mehr weitergekonnt, verausgabt und ihrer Kraft beraubt. Nur bruchstückhaft konnte sie sich erinnern, hatte lediglich einzelne Bildfetzen vor Augen, verschwommen wie eine Spiegelung im trüben Wasser.
Sie war vor jemandem geflohen. In ihrer Erinnerung blitzte das Gesicht des Ritters auf: sein goldenes Haar, die kühn geschnittenen Züge, die blauen, argwöhnisch spähenden Augen. Ja, mit diesen durchdringenden Augen hatte er sie entdeckt, und ihr war es so vorgekommen, als habe er die Hand nach ihr ausgestreckt. Ihr Versteck war entdeckt worden, und nicht weit von dem Wohnturm, der verlassen in der trostlosen Landschaft dastand, wäre sie beinahe gefangen worden.
Nein, nicht verlassen … niedergemacht hatte man ihn, wisperte ihr die Erinnerung zu, die in ihr hochstieg. Und mit ihr kamen die Bilder des Grauens.
Flammen und Blut.
Schreie.
Das Wimmern eines Kindes in den Armen seiner Mutter.
Mit einem Stöhnen kniff sie die Augen zu und drängte die hässlichen Bilder beiseite. Sie ergaben ohnehin nicht viel Sinn, waren sie doch nicht mehr als eine verwirrende Ansammlung von bösen Eindrücken, die ihr im Kopf herumgeisterten. Selbst im wachen Zustand durfte sie ihrer Wahrnehmung nicht mehr trauen. Tage und schwarze Nächte flossen ineinander, Nächte wurden plötzlich zu helllichten Tagen; sie vermochte die Tageszeiten nicht mehr scharf voneinander zu trennen. Es fiel ihr zunehmend schwer, wach zu bleiben und die Umgebung richtig wahrzunehmen, obwohl ihre Augen noch offen waren.
Dieser Schmerz.
Das war alles, was sie wirklich empfand. Die quälenden Schmerzen ließen nicht nach; ein Feuer schien sich in ihr auszubreiten, fraß sich gleichsam durch ihren Leib und beraubte sie langsam ihres Willens und ihrer Sinne.
Die Luft um sie herum war kalt, und doch brannte ihr Leib, als stünde sie in Flammen. Hitze versengte sie von innen her, aber kein Schweiß kühlte ihr die Stirn. Und sie war so furchtbar durstig. Ihr Mund fühlte sich wie ausgetrocknet an, ihre Zunge war geschwollen und schwer.
Mühsam kämpfte sie dagegen an, wieder in das Reich der Schatten abzugleiten, und drückte sich mit den Armen vom Boden ab. Ihre Glieder zitterten, als sie ihren schlanken Körper in eine sitzende Stellung brachte. Selbst diese kleine Bewegung hatte sie außer Atem gebracht, in ihren Schläfen rauschte das Blut.
Über ihr glänzten die frischen Blätter der Eichen und Eschen im Sternenlicht. Sie raschelten leise in der nächtlichen Brise, waren eben erst den Knospen des Winterschlummers entwachsen. Tropfen des letzten Regenschauers hingen an dem leicht gebogenen Blattwerk. Unter Aufbietung ihrer letzten Kräfte gelang es ihr schließlich, langsam aufzustehen. Gierig streckte sie die Hand nach den glitzernden Wassertropfen aus. Einem wilden Tier des Waldes gleich sog sie das kühlende Nass von den Blättern. Doch es war nicht genug.
Nicht einmal annähernd genug, um den quälenden Durst zu löschen.
Sie musste eine Wasserstelle finden. Musste das Feuer löschen, das in ihr wütete. Den rauen Atem zwischen den ausgetrockneten Lippen ausstoßend, drehte sie den Kopf und schaute auf die offene Ebene hinaus, die sich vor ihren müden Augen erstreckte. Etwas zog ihre Aufmerksamkeit auf sich. Reglos blieb sie stehen, spähte in die Dunkelheit und lauschte.
Der Wind rauschte in den Wipfeln, aber das Rascheln der Zweige und der hohen Gräser wurde noch von einem anderen Geräusch überlagert.
Wasser.
Große, rauschende Wogen, nicht weit von ihr entfernt.
Matt und erschöpft machte sie ein paar Schritte und blickte in die Richtung, aus der sie die willkommenen Geräusche des Wassers vernahm. Da sie sich nun nicht mehr im Schutz der Baumgruppe befand, sondern auf offener Fläche, wehte der Wind frischer und kühler. Ihr Umhang bauschte sich in der Brise und wirkte wie ein geisterhaftes Segel in einer beinahe sternenklaren Nacht.
Oben am Himmel jagten schmale Wolken über den Himmel, hoben sich grau von dem schwarzen Firmament ab. Wie dünne Rauchsäulen, Finger aus Qualm, die sich ihr entgegenstreckten … und sich um ihren Hals schlossen. Sie würgten.
Ihre Sinne waren umnebelt. Aus den unscharfen Tiefen der Nacht packte sie eine erbarmungslose Hand. Sie rang nach Atem, und ihre Finger versuchten, die Klaue abzuwehren, die sich um ihren Hals schloss.
Sterben … das Leben wich ihr aus dem Leib …
»Nein«, wisperte sie, fasste sich an die Schläfe und begehrte gegen die Trugbilder auf, die von allen Seiten auf sie einzustürmen schienen.
Sie erinnerte sich, wie sie verzweifelt versucht hatte, sich von kräftigen Händen loszureißen. Irgendwie musste es ihr auch gelungen sein, zumindest für einen Moment. Bis Metall vor ihr aufblitzte, wie ein zuckendes Licht inmitten des Rauchs. Dann brach das Feuer in ihrer Brust aus. Weiß glühend, grell wie Blitze. Sie konnte weder sehen noch denken. Dunkelheit hatte sich auf sie herabgesenkt, schneller als jede Wolke aus Asche und Ruß.
Er hatte ihr nach dem Leben getrachtet, aber sie war ihm entkommen. Mit knapper Not.
Nun hastete sie stolpernd über die Wiese, drängte mit zittrigen Händen die Binsen beiseite, die ihr fast bis zur Hüfte reichten. Frische Windböen wehten ihr ins Gesicht, doch in ihrem Fieberwahn rang sie keuchend nach Atem, als wäre sie von einer beißenden Qualmwolke umfangen. Der Rauch brannte ihr in den Augen, als die Bilder sie erneut bestürmten. Sie war wieder an jenem Ort, in der kleinen Burg auf der Anhöhe.
Wieder war der Tod ihr Begleiter, wie in jener Nacht. Bei jedem unsicheren Schritt fühlte sie seinen kalten Atem, der sie ebenso vorantrieb wie der Nachtwind. Bald, das wusste sie, würde sie die Klauen des Todes zu spüren bekommen. Zwar fürchtete sie ihr Ende nicht, war aber auch nicht bereit, sich kampflos zu ergeben. Fest entschlossen, bis zum letzten Atemzug zu kämpfen, drängte sie ihre Beine, sie schnell fortzutragen, während sie auf die verheißungsvollen Laute des rauschenden Meeres lauschte.
Wasser, dachte sie, und dieses eine Wort wirkte wie Balsam auf ihre schwere Zunge. Das Wasser würde das Feuer löschen, das ihren Leib aufzehrte und ihre Sinne beeinträchtigte. Sie musste nur die Küste erreichen, dann wäre sie in Sicherheit.
Als sie die Kraft der schäumenden Wogen hörte, lief sie schneller. Die See konnte nicht mehr weit sein. Die hohen Binsengewächse auf der Wiese wichen allmählich Grasbüscheln und Moosen, nur von Steinen unterbrochen. Schon bald würde sie den Sand unter den Füßen spüren, dann die sacht plätschernden Wellen. Gleich hatte sie es geschafft.
In ihrer Eile und mit Sinnen, die vom Fieberwahn benebelt waren, stolperte sie über einen der schroffen Steine. Hart schlug sie auf dem Boden auf. Ein stechender Schmerz durchzuckte ihre linke Schulter, die Luft war ihr bei dem harten Aufprall weggeblieben. Etwas Warmes, Zähflüssiges lief an ihrem Ärmel entlang und tropfte auf ihr Mieder.
Blut, wie sie trotz ihres dämmrigen Geistes ahnte.
Nun war sie ihrem Ende näher denn je. Die Erkenntnis betäubte sie, als sie so dalag und ihr Herz dumpf in der Brust schlagen hörte. Dies war also der Tod? Sie wollte weiter darüber sinnieren, ergab sich aber schließlich den dunklen Schatten, die sie aller weiteren Gedanken beraubten.
3
Eine huschende Bewegung weiter hinten auf der Ebene, die ins Sternenlicht getaucht war, erregte Kenricks Aufmerksamkeit. Er hob den Kopf und spähte vom Fenster des Wohnturms angestrengt in die Nacht, meinte er doch, nicht weit von den Klippen eine Gestalt entdeckt zu haben, die dort herumlief.
Nein, verbesserte er sich gleich. Jene Person ging nicht, sie rannte geradezu. Scheinbar achtlos stolperte sie an dem jäh abfallenden Abgrund entlang, der Greycliff Castle seinen Namen gegeben hatte. Die Gestalt trug einen hellen Umhang, der sie ganz verhüllte. Der breite Saum war ein Spielball des Windes, der von der See her landeinwärts blies; der Stoff flatterte wie Schwingen aus blasser, zerschlissener Wolle. Dieses zerlumpte Kleidungsstück hatte Kenrick erst wenige Stunden zuvor gesehen, und zwar eben an der zierlichen Frau, die ihn auf dem Friedhof beobachtet hatte.
»Was, zum Teufel, hat sie dort zu suchen?«, murmelte er verwundert. Doch eine düstere Vorahnung beschlich ihn.
Die Frau lief gefährlich nah an den schroffen Klippen entlang ganz so, als wolle sie zum Wasser laufen, das weit unten gegen die Küste brandete.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!