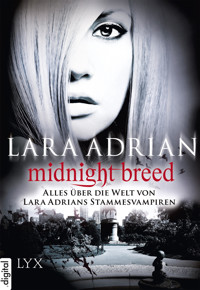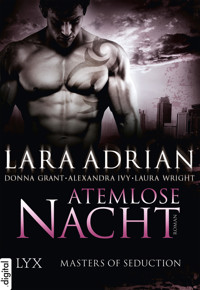9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Midnight Breed
- Sprache: Deutsch
Die ehemalige Polizistin Jenna wird in der Wildnis von Alaska angegriffen und überlebt den Überfall nur mit knapper Not. Doch hinterher gehen seltsame Veränderungen mit ihrem Körper vonstatten. Sie sucht Zuflucht im Haus eines uralten Ordens von Vampirkriegern in Boston, deren Existenz nur wenigen bekannt ist. Dort begegnet Jenna dem attraktiven Vampir Brock, der ihr hilft, sich von ihren Wunden zu erholen. Schon bald werden beide von einer tiefen Leidenschaft zueinander erfasst. Doch ein Geheimnis aus Brocks Vergangenheit und Jennas Sterblichkeit gefährden ihre verbotene Liebe.
Der achte Band der erfolgreichen Vampirsaga "Midnight Breed" von Bestseller-Autorin Lara Adrian!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
Titel
Widmung
Danksagungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Epilog
Impressum
LARA ADRIAN
GEWEIHTE DES TODES
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Katrin Kremmler
Für die wunderbare Heather Rogers
DANKSAGUNGEN
Bei jedem meiner Bücher wird mir wieder aufs Neue klar, welches Glück ich habe, mit so vielen talentierten, gewissenhaften Leuten zu arbeiten wie die in meinen Verlags- und Lizenzteams, sowohl in den Staaten als auch anderswo.
Vielen Dank für alles, was ihr für mich tut. Es ist ein echtes Privileg, mit euch allen arbeiten zu dürfen.
Besonderen Dank meinem Team zu Hause, das sich um mich kümmert, mir das Essen hinstellt und all den Alltagskram für mich erledigt, der sonst untergehen würde, solange ich in mein aktuelles Buch abgetaucht bin. Ohne eure Liebe und Unterstützung wäre das nicht machbar.
Und euch, meinen Leserinnen, bin ich unendlich dankbar dafür, dass ihr meine Figuren so ins Herz geschlossen habt und mich jedes Mal mit eurer Zeit und Freundschaft beschenkt, wenn ihr eines meiner Bücher lest. Ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei!
1
Leben … oder Tod?
Die Worte drangen durch die Dunkelheit zu ihr, einzelne Silben ohne Zusammenhang. Das raue Kratzen einer ausdruckslosen, dumpfen Stimme, die in ihre bleierne Benommenheit drang und sie zwang, aufzuwachen, zuzuhören. Eine Wahl zu treffen.
Leben?
Oder Tod?
Sie stöhnte auf dem kalten Holzboden unter ihrer Wange, versuchte, die Stimme und die erbarmungslose Entscheidung, die sie forderte, aus ihrem Verstand auszublenden. Es war nicht das erste Mal, dass sie diese Worte, diese Frage hörte. Nicht das erste Mal in den endlosen Stunden, dass sie in der eisigen Stille ihres Blockhauses mühsam ein Augenlid gehoben und mitten in das schreckliche Gesicht eines Monsters gestarrt hatte.
Vampir.
„Entscheide dich“, flüsterte die Kreatur mit einem lang gezogenen Zischen. Sie kauerte über ihr, und sie selbst lag zusammengerollt und zitternd vor Kälte auf dem Boden beim kalten Kamin. Die Fangzähne der Bestie glänzten im Mondlicht, rasierklingenscharf und tödlich, ihre Spitzen immer noch mit frischem Blut verschmiert – ihrem eigenen. Die Kreatur hatte sie erst vor wenigen Minuten in den Hals gebissen.
Sie versuchte sich aufzurichten, konnte aber ihre geschwächten Muskeln nicht einmal dazu bringen, sich anzuspannen. Sie versuchte, etwas zu sagen, aber ihr gelang nur ein raues Stöhnen. Ihre Kehle fühlte sich trocken wie Asche an, ihre Zunge geschwollen und träge.
Draußen tobte ein Schneesturm, der Winter Alaskas heulte ihr bitter und gnadenlos in den Ohren. Niemand konnte ihre Schreie hören, selbst wenn sie es versucht hätte.
Der Vampir konnte sie immer noch sofort töten. Sie wusste nicht, warum er es nicht getan hatte. Sie wusste nicht, warum er sie drängte, auf eine Frage zu antworten, die sie sich die letzten vier Jahre lang fast täglich selbst gestellt hatte – seit dem Unfall, der ihr den Mann und ihre kleine Tochter genommen hatte.
Wie oft hatte sie sich gewünscht, mit ihnen auf dieser vereisten Schnellstraße umgekommen zu sein? Dann wäre alles so viel leichter, so viel weniger schmerzhaft gewesen.
Jetzt konnte sie ein stummes Urteil in diesen unverwandten, unmenschlichen Augen spüren, die in der Dunkelheit auf sie gerichtet waren, blendend hell, die Pupillen geschlitzt wie die einer Katze. Der kahle Schädel und riesenhafte Körper der Kreatur waren von kunstvoll verschlungenen Hautmustern überzogen, und als sie sie beobachtete, schienen sie in wilden Farben zu pulsieren. Die Stille dehnte sich aus, während er sie geduldig musterte wie ein unter einem Glas gefangenes Insekt.
Als er jetzt wieder sprach, bewegten sich seine Lippen nicht. Die Worte drangen wie Rauch in ihren Schädel ein und sanken tief in ihren Verstand.
Die Entscheidung liegt bei dir, Menschenfrau. Sag mir, was du willst: Leben oder Tod?
Sie wandte den Kopf ab und schloss die Augen, weigerte sich, die Kreatur anzusehen. Weigerte sich, Teil dieses seltsamen Spiels ohne Worte zu sein, das er offenbar mit ihr spielte. Er war ein Raubtier, das mit seiner zappelnden Beute spielte, während es sich überlegte, ob es sie verschonen wollte oder nicht.
Wie es endet, liegt an dir. Du entscheidest.
„Zur Hölle mit dir!“, murmelte sie undeutlich, ihre Stimme war belegt und heiser.
Eisenstarke Finger schlossen sich hart um ihr Kinn und rissen es herum, bis sie ihm wieder ins Gesicht sah. Er legte den Kopf schief, seine bernsteingelben Katzenaugen waren völlig emotionslos, als er keuchend Atem holte und dann durch seine blutverschmierten Lippen und Fänge sprach.
„Entscheide dich. Es bleibt nicht mehr viel Zeit.“
Keine Ungeduld lag in der knurrenden Stimme so nahe an ihrem Gesicht, nur mattes Desinteresse. Eine Apathie, die zu besagen schien, dass es ihm wirklich völlig egal war, wie die Antwort ausfiel.
Wut brandete in ihr auf. Sie wollte ihm sagen, er sollte es endlich hinter sich bringen und sie töten, wenn es das war, was er vorhatte. Er würde sie nicht dazu bringen, ihn anzubetteln, verdammt noch mal! Widerstand kochte in ihr, und ihre Wut schoss ihr die ausgedörrte Kehle hinauf und in ihre Zungenspitze.
Aber die Worte wollten nicht kommen.
Sie konnte ihn nicht um den Tod bitten, selbst wenn er ihr einziger Ausweg aus dem Schrecken war, der sie hier gefangen hielt. Ihr einziger Fluchtweg vor ihrem Schmerz darüber, die beiden Menschen verloren zu haben, die sie am meisten liebte, und aus der sinnlosen Existenz, die ihr seither geblieben war.
Er löste seine Klauen von ihr und sah mit entnervender Ruhe zu, wie sie wieder auf den Boden sackte. Zeit verging, schien sich endlos auszudehnen. Sie kämpfte damit, ihre Stimme wiederzufinden, um das Wort auszusprechen, das sie entweder befreien oder verdammen würde. Und immer noch kauerte er neben ihr, wiegte sich auf den Fersen und schien mit schief gelegtem Kopf etwas abzuwägen.
Dann, zu ihrem Entsetzen und ihrer Verwirrung, streckte er den linken Arm aus und schlitzte sich mit einem klauenartigen Fingernagel das Fleisch an seinem Handgelenk auf. Blut spritzte aus der tiefen Wunde, scharlachrote Tropfen regneten auf die hölzernen Dielenbretter unter ihm. Er fuhr mit dem Finger in den offenen Schnitt und bohrte ihn in die Muskeln und Sehnen seines Unterarms.
„Oh, Scheiße! Was machst du da?“ Ekel schüttelte sie. Ihre Instinkte schrien ihr die Warnung zu, dass gleich etwas Schreckliches passieren würde – vielleicht noch schrecklicher als der Horror ihrer Gefangenschaft bei diesem albtraumhaften Wesen, das sich von ihrem Blut nährte. „Oh mein Gott, hör auf. Was zur Hölle machst du da?“
Er antwortete nicht, sah sie nicht einmal an, bis er etwas Winziges aus der Wunde in seinem Fleisch hervorgepult hatte und vorsichtig zwischen seinem blutigen Daumen und Zeigefinger hielt. Er blinzelte langsam, für einen kurzen Augenblick waren seine Augen hinter seinen Lidern verborgen, dann nagelte er sie wieder mit einem hypnotischen bernsteingelben Lichtstrahl fest.
„Leben oder Tod“, zischte die Kreatur und machte ihre unbarmherzigen Augen schmal. Er beugte sich zu ihr herüber, immer noch tropfte Blut aus der Wunde in seinem Unterarm, die er sich selbst beigebracht hatte. „Du musst dich entscheiden, sofort.“
Nein, dachte sie verzweifelt. Nein!
Irgendwo tief in ihr brandete Wut auf wie eine Springflut. Sie konnte sie nicht unterdrücken, den Wutanfall nicht zurückhalten, der jetzt ihre wunde Kehle hinaufstieg und mit einem Furienschrei aus ihrem Mund explodierte.
„Nein!“ Sie hob die Fäuste und schlug auf die nackten Schultern der Kreatur ein, deren harte Haut nichts Menschliches hatte. Sie schlug um sich und tobte, beschimpfte ihn mit aller Kraft, die sie aufbringen konnte, und genoss jeden schmerzhaften Aufprall, wenn ihre Schläge seinen Körper trafen. „Verdammt noch mal, nein! Fass mich nicht an!“
Wieder drosch sie mit den Fäusten auf ihn ein, wieder und wieder, und immer noch kroch er näher heran.
„Lass mich in Ruhe, verdammt! Hau ab!“
Ihre Fäuste trafen ihn an den Schultern und seitlich am Schädel, Schlag auf Schlag fiel, selbst dann noch, als eine schwere Dunkelheit sich über sie zu senken begann und sie einhüllte wie ein schweres, nasses Leichentuch, ihre Bewegungen träge machte und ihre Gedanken verwirrte.
Ihre Muskeln erschlafften und gehorchten ihr nicht mehr. Und immer noch schlug sie auf die Kreatur ein, jetzt langsam, als stünde sie bis zum Hals in einem schwarzen, teergefüllten Ozean.
„Nein“, stöhnte sie und schloss die Augen vor der Dunkelheit, die sie umgab. Sie sank tiefer, immer tiefer in eine geräuschlose, schwerelose, endlose Leere hinein. „Nein … lass mich los. Verdammt … lass mich los …“
Dann, als sie schon dachte, dass die Dunkelheit, die sie einhüllte, sie nie wieder freigeben würde, spürte sie etwas Kühles und Feuchtes an ihrer Stirn, und irgendwo über ihrem Kopf erklang unverständliches Stimmengewirr.
„Nein“, murmelte sie. „Nicht. Lass mich los …“
Mit allerletzter Kraft versetzte sie der Kreatur, die sie niedergedrückt hielt, einen weiteren Schlag. Harte Muskeln absorbierten ihn. Da klammerte sie sich an ihren Entführer, versuchte, ihn zu packen, zu kratzen. Verblüfft spürte sie weichen Stoff in den Händen. Nicht die klamme nackte Haut der Kreatur, die in ihr Haus eingebrochen war und sie gefangen hielt, sondern einen warmen Strickpullover.
In ihrem trägen Verstand feuerte ihre Verwirrung einen Warnschuss ab. „Wer … nein, fass mich nicht an …“
„Jenna, hören Sie mich?“ Der tiefe, rollende Bariton, der so nah an ihrem Gesicht ertönte, war ihr irgendwie vertraut. Seltsam tröstlich.
Diese Stimme sprach etwas tief in ihr an und gab ihr etwas zum Festhalten, jetzt, wo nichts als dieses bodenlose dunkle Meer um sie war. Sie stöhnte, immer noch verloren, doch nun spürte sie einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass sie vielleicht überleben würde.
Die tiefe Stimme, nach der sie sich jetzt plötzlich verzweifelt sehnte, meldete sich wieder. „Kade, Alex. Ich glaube, sie kommt zu sich. Jetzt wacht sie endlich auf.“
Sie holte Atem, schnappte heftig nach Luft. „Lass mich los“, murmelte sie, unsicher, ob sie ihren Gefühlen trauen konnte. Unsicher, ob sie jetzt überhaupt irgendetwas trauen konnte. „Oh Gott … bitte nicht … fass mich nicht an! Nicht …“
„Jenna?“ Über ihr, ganz in der Nähe, meldete sich eine Frauenstimme zu Wort. Sanfter Tonfall, nüchterne Besorgnis – das musste eine Freundin sein. „Jenna, Liebes, ich bin’s, Alex. Du bist jetzt okay. Verstehst du? Du bist in Sicherheit, das verspreche ich dir.“
Langsam registrierte sie, was diese Worte bedeuteten, und ein Gefühl von Erleichterung und Trost breitete sich in ihr aus. Ein Gefühl von Frieden, trotz des eisigen Entsetzens, das immer noch durch ihre Adern schoss.
Mit großer Anstrengung schaffte sie es, die Augen zu öffnen und die Benommenheit fortzublinzeln, die wie ein Schleier an ihren Sinnen klebte. Drei Gestalten umstanden sie, zwei davon riesig und eindeutig männlich, die dritte groß und schlank, eine Frau. Ihre beste Freundin, Alexandra Maguire. „Was … wo bin …“
„Schsch“, beruhigte Alex sie. „Nicht reden. Es ist okay. Du bist an einem sicheren Ort, und du kommst wieder in Ordnung.“
Jenna blinzelte und versuchte sich zu konzentrieren. Langsam wurden die Gestalten an ihrem Bett zu Menschen. Als sie sich etwas aufsetzte, erkannte sie, dass ihre Fäuste immer noch den Wollpullover gepackt hielten, den der Größere der beiden Männer trug: der riesenhafte, grimmig wirkende Afroamerikaner mit dem kurz geschorenen Haar und den Schultern eines Rugbyspielers, dessen tiefe Stimme sie aus dem entsetzlichen Albtraum zurückgeholt hatte, in dem sie fast ertrunken wäre.
Auf den sie weiß Gott wie lange erbarmungslos eingedroschen hatte, weil sie ihn für die höllische Kreatur gehalten hatte.
„Hallo“, murmelte er, und sein breiter Mund kräuselte sich zu einem kleinen Lächeln. Durchdringende dunkelbraune Augen hielten ihren erwachenden Blick und schienen ihr tief in die Seele zu dringen. Das warme Lächeln wurde breiter, als sie ihren Todesgriff löste und sich wieder auf das Bett sinken ließ. „Schön zu sehen, dass Sie sich für das Land der Lebenden entschieden haben.“
Jenna runzelte die Stirn über seine launige Bemerkung, denn sie erinnerte sich wieder an die schreckliche Entscheidung, die ihr Angreifer ihr aufgezwungen hatte. Sie stieß einen kehligen Seufzer aus und versuchte, ihre neue, unvertraute Umgebung in sich aufzunehmen. Ein wenig fühlte sie sich wie Dorothy, als sie nach ihrer Reise ins Zauberland Oz wieder zu Hause in Kansas aufwacht.
Nur dass ihr Land Oz scheinbar endlose Höllenqualen gewesen waren, ein schrecklicher, blutgetränkter Horrortrip.
Wenigstens der war nun vorbei.
Sie sah Alex an. „Wo sind wir?“
Ihre Freundin kam näher und drückte ihr ein kühles, feuchtes Tuch an die Stirn. „Du bist in Sicherheit, Jenna. Hier kann dir niemand etwas tun.“
„Wo bin ich?“, fragte Jenna heftig und spürte eine seltsame Panik in sich aufsteigen. Obwohl sie in einem weichen Bett voller kuschliger Kissen und Decken lag, fielen ihr sofort die klinisch weißen Wände und die zahlreichen medizinischen Monitore und digitalen Messgeräte auf, die um sie herum im Raum standen. „Was ist das hier, ein Krankenhaus?“
„Nicht direkt“, antwortete Alex. „Wir sind in Boston, in einer privaten Einrichtung. Das war momentan der sicherste Ort für dich. Und für uns alle.“
Boston? Private Einrichtung? Die vage Erklärung war alles andere als beruhigend. „Wo ist Zach? Ich muss ihn sehen. Ich muss mit ihm reden.“
Bei der Erwähnung von Jennas Bruder erblasste Alex ein wenig. Sie schwieg lange, zu lange. Dann sah sie über die Schulter zu dem anderen Mann hinüber, der hinter ihr stand. Mit seinem stacheligen schwarzen Haarschopf, den durchdringenden silbernen Augen und kantigen Wangenknochen kam er Jenna vage bekannt vor, und nun flüsterte Alex leise seinen Namen. „Kade …“
„Ich gehe Gideon holen“, sagte er und streichelte ihr sanft über die Schulter. Dieser Kade war offensichtlich ein Freund von Alex. Ein sehr enger sogar. Er und Alex gehörten zusammen; selbst in ihrem benommenen Zustand konnte Jenna die tiefe Liebe spüren, die zwischen dem Paar knisterte. Als sich Kade von Alex löste, warf er dem anderen Mann einen raschen Blick zu. „Brock, du hast hier alles im Griff, bis ich zurück bin?“
Der dunkle Kopf nickte grimmig. Doch als Jenna zu ihm aufsah, sah der riesige Mann namens Brock sie mit derselben beruhigenden Sanftheit an wie vorhin, als sie an diesem seltsamen Ort die Augen geöffnet hatte.
Jenna schluckte an einem Angstklumpen, der ihr unaufhaltsam die Kehle hinaufstieg. „Alex, sag mir, was hier los ist! Ich weiß, dass ich … angegriffen wurde. Und gebissen. Oh, Himmel … da war eine … eine Kreatur. Sie ist irgendwie in mein Haus eingedrungen und hat mich angegriffen.“
Mit sorgenvoller Miene nahm Alex ihre Hand. „Ich weiß, Liebes. Du musst Schreckliches durchgemacht haben. Aber jetzt bist du hier. Du hast es überlebt, Gott sei Dank.“
Jenna schloss die Augen, und ein wildes Schluchzen würgte sie. „Alex, es … es hat von mir getrunken.“
Ohne dass sie es bemerkt hatte, war Brock näher ans Bett gekommen. Er stand direkt neben ihr, streckte die Hand aus und streichelte ihr mit den Fingerspitzen seitlich über den Hals. Seine großen Hände waren warm und unglaublich sanft, und Jenna durchströmte ein seltsames Gefühl. Seine zarte Liebkosung brachte ihr Frieden.
Ein Teil von ihr wollte protestieren, dass er sie einfach so anfasste, aber ein anderer Teil von ihr – ein hilfsbedürftiger, verletzlicher Teil, den sie am liebsten gar nicht anerkennen, geschweige denn ihm nachgeben wollte, konnte den Trost nicht zurückweisen. Ihr hämmernder Puls beruhigte sich unter dem sanften Rhythmus seiner Finger, die leicht ihren Hals hinauf- und hinunterstrichen.
„Besser?“, fragte er ruhig, als er seine Hand wegzog.
Sie stieß einen leisen Seufzer aus und nickte schwach. „Ich muss wirklich meinen Bruder sehen. Weiß Zach, dass ich hier bin?“
Alex presste die Lippen zusammen, und eine schmerzhafte Stille senkte sich über den Raum. „Jenna, Liebes, mach dir jetzt keine Sorgen über nichts und niemanden, okay? Du hast so viel durchgemacht. Konzentrieren wir uns doch erst mal darauf, dass es dir wieder besser geht. Zach würde das auch wollen.“
„Wo ist er, Alex?“ Obwohl Jenna ihre Dienstmarke und die Uniform der Staatspolizei von Alaska schon vor Jahren abgegeben hatte, wusste sie, wenn jemand um den heißen Brei herumredete. Sie merkte sofort, wenn jemand versuchte, andere zu schützen, um ihnen Schmerz zu ersparen. Und genau das tat Alex eben mit ihr. „Was ist mit meinem Bruder passiert? Ich muss ihn sehen. Irgendwas ist mit ihm, Alex, ich seh’s dir doch an. Ich muss sofort raus hier.“
Wieder kam Brocks große, breite Hand auf sie zu, aber dieses Mal stieß Jenna sie weg. Es war nur ein leichter Klaps aus dem Handgelenk gewesen, aber seine Hand wurde zur Seite geschlagen, als hätte sie ihre ganze Kraft in die Bewegung gelegt.
„Was zum …?“ Brocks dunkle Augen wurden schmal, etwas Helles und Gefährliches blitzte in ihnen auf und war schon wieder verschwunden, bevor sie völlig registriert hatte, was sie da sah.
Und im selben Augenblick kam Kade mit zwei anderen Männern ins Zimmer zurück. Einer war groß und schlank, athletisch gebaut, und sein zerzauster blonder Haarschopf und die randlose hellblaue Sonnenbrille, die ihm tief auf der Nase saß, ließen ihn ein wenig wie einen verrückten Wissenschaftler aussehen. Der andere, dunkelhaarig und mit grimmigem Gesicht, kam in das kleine Zimmer gestapft wie ein mittelalterlicher Herrscher, allein schon seine Präsenz gebot Aufmerksamkeit und schien schlagartig alle Luft aus dem Raum zu saugen.
Jenna schluckte. Als ehemalige Polizeibeamtin war sie es gewohnt, Männer niederzustarren, die doppelt so groß waren wie sie. Sie war nie eine gewesen, die sich leicht einschüchtern ließ, aber jetzt, beim Anblick dieser mindestens vierhundertfünfzig Kilo Muskelmasse und schieren Kraft in Form dieser vier Männer, die jetzt ihr Bett umstanden – ganz zu schweigen von der definitiv tödlichen Ausstrahlung, die diese Typen so lässig zur Schau stellten wie ihre eigene Haut –, fiel es ihr verdammt schwer, ihren prüfenden, fast misstrauischen Blicken standzuhalten.
Wohin auch immer man sie gebracht hatte, und wer auch immer diese Männer waren, zu denen Kade da gehörte, Jenna hatte allmählich den Eindruck, dass diese sogenannte private Einrichtung definitiv keine Klinik war. Und weiß Gott auch kein Countryclub.
„Sie ist erst ein paar Minuten wach?“, fragte der Blonde mit leichtem britischem Akzent. Als Brock und Alex nickten, ging er zum Bett hinüber. „Hallo, Jenna. Ich bin Gideon. Das ist Lucan“, sagte er und zeigte auf seinen hünenhaften Begleiter, der neben Brock auf der anderen Seite des Raumes stand. Gideon sah sie stirnrunzelnd über seine Brillengläser an. „Wie fühlen Sie sich?“
Sie starrte genauso finster zurück. „Als hätte mich ein Bus überfahren. Und anscheinend hat er mich auch von Alaska bis nach Boston mitgeschleift.“
„Es ging nicht anders“, warf Lucan ein, und in seiner ruhigen Stimme klang ein Befehlston mit. Das war keiner, der andere um Erlaubnis fragte, er war hier der Anführer, gar keine Frage. „Sie sind im Besitz von zu vielen Informationen und brauchten spezielle Behandlung und Beobachtung.“
Das klang alles andere als gut. „Wenn ich was brauche, dann ein Rückflugticket nach Alaska. Was immer dieses Monster mir angetan hat, ich habe es überlebt. Ich brauche keine Behandlung oder Beobachtung mehr, mir geht es hervorragend, und ich will nach Hause.“
„Nein“, konterte Lucan grimmig. „Es geht Ihnen nicht gut. Ganz und gar nicht, um genau zu sein.“
Obwohl sein Tonfall weder grausam noch bedrohlich gewesen war, durchfuhr sie ein eisiger Angststoß. Sie sah zu Alex und Brock hinüber – die beiden Menschen, die ihr erst vor wenigen Minuten versichert hatten, dass es ihr gut ging und sie in Sicherheit war. Die beiden Menschen, die tatsächlich geschafft hatten, ihr ein Gefühl von Sicherheit zu geben, nachdem sie aus dem Albtraum erwacht war, den sie immer noch auf ihrer Zunge schmecken konnte. Jetzt sagten sie beide kein Wort.
Verletzt wandte sie den Blick ab und fragte sich angstvoll, was dieses Schweigen wirklich zu bedeuten hatte. „Ich muss hier raus, ich will nach Hause.“
Als sie Anstalten machte, die Beine über den Bettrand zu schwingen und aufzustehen, war es nicht Lucan oder Brock und auch keiner der übrigen hünenhaften Männer, der sie daran hinderte, sondern Alex. Jennas beste Freundin kam und verstellte ihr den Weg, und ihr nüchterner Gesichtsausdruck war effektiver als die bedrohliche Ausstrahlung der vier Muskelprotze im Zimmer.
„Jen, du musst mir jetzt zuhören, uns allen hier. Es gibt da gewisse Dinge, die du verstehen musst … darüber, was zu Hause in Alaska passiert ist. Und es gibt da auch Dinge, die wir immer noch herausfinden müssen und auf die vielleicht nur du die Antwort weißt.“
Jenna schüttelte den Kopf. „Keine Ahnung, wovon du redest. Ich weiß nur, dass ich gefangen gehalten und angegriffen wurde – gebissen und ausgesaugt, verdammt – von etwas, das schlimmer war als ein Albtraum. Das Ding könnte immer noch da draußen in Harmony sein. Ich kann doch nicht tatenlos hier herumsitzen, während dieses Monster womöglich meinem Bruder oder anderen zu Hause dasselbe antut wie mir.“
„Das wird es nicht“, sagte Alex. „Die Kreatur, die dich angegriffen hat – der Älteste – ist tot. Er ist keine Gefahr mehr für Harmony, dafür haben Kade und die anderen schon gesorgt.“
Jenna spürte nur einen Anflug von Erleichterung, denn trotz der guten Nachrichten, dass ihr Angreifer tot war, nagte immer noch etwas Eisiges an ihrem Herzen. „Und Zach? Wo ist mein Bruder?“
Alex warf einen Seitenblick auf Kade und Brock, die beide näher ans Bett gekommen waren. Alex schüttelte fast unmerklich den Kopf, ihre braunen Augen unter ihrem lockigen dunkelblonden Haar blickten traurig. „Oh Jenna … es tut mir so leid.“
Sie nahm die Worte ihrer Freundin in sich auf, weigerte sich, ihre Bedeutung zu erfassen. Ihr Bruder, ihr letzter lebender Verwandter, war tot?
„Nein.“ Sie schluckte, wollte es nicht wahrhaben. Kummer stieg ihr die Kehle hinauf, als Alex tröstend den Arm um sie legte.
Während die Trauer sie überrollte wie eine Welle, schossen auch Erinnerungen an die Oberfläche: Alex’ Stimme, die sie von außerhalb ihres Blockhauses rief, wo die Kreatur über Jenna in der Dunkelheit lauerte. Zachs wütende, abgehackte Schreie, in denen eine tödliche Drohung mitschwang – aber an wen gerichtet? Damals war sie nicht sicher gewesen, und jetzt war sie nicht sicher, ob es überhaupt noch von Bedeutung war.
Draußen vor dem Blockhaus hatte ein Schuss gekracht, und keine Sekunde später war die Kreatur aufgesprungen, hatte die verwitterte hölzerne Haustür durchbrochen und war auf den verschneiten, bewaldeten Hof hinausgestürzt. Sie erinnerte sich an die heulenden Schreie ihres Bruders, an pures Entsetzen, gefolgt von einer schrecklichen Stille.
Und dann … nichts mehr.
Nur noch ein tiefer, unnatürlicher Schlaf und endlose Dunkelheit.
Sie wand sich unter Alex’ Arm hervor und schluckte ihren Kummer hinunter. Sie würde nicht zusammenbrechen, nicht vor all diesen Männern mit den grimmigen Gesichtern, die sie alle mit einer Mischung aus Mitleid und vorsichtigem, fragendem Interesse ansahen.
„Ich werde jetzt gehen“, sagte sie und fand nur mit Mühe ihre knallharte Copstimme, die auf Streife immer so gut funktioniert hatte. Sie stand auf und fühlte sich kaum wackelig auf den Beinen. Als sie leicht zur Seite schwankte, streckte Brock die Hand aus, um sie zu stützen, aber sie hatte ihr Gleichgewicht wiedergefunden, bevor es zu dieser ungebetenen Hilfe kam. Sie brauchte weiß Gott keinen, der sie verhätschelte und ihr das Gefühl gab, schwach zu sein. „Alex kann mir zeigen, wo hier der Ausgang ist.“
Lucan räusperte sich demonstrativ.
„Äh, ich fürchte, das ist momentan nicht möglich“, sagte Gideon mit seiner höflichen britischen Art, doch absolut unnachgiebig. „Jetzt, wo Sie endlich wach und ansprechbar sind, brauchen wir Ihre Hilfe.“
„Meine Hilfe?“ Sie runzelte die Stirn. „Wobei denn?“
„Wir müssen herausfinden, was genau zwischen Ihnen und dem Ältesten vorgefallen ist. Insbesondere, ob er Ihnen irgendetwas mitgeteilt oder Ihnen auf andere Weise Informationen anvertraut hat.“
Sie schnaubte. „Tut mir leid. Ich habe diese Tortur schon einmal durchgemacht und habe weiß Gott nicht vor, das alles bis ins Detail noch mal für Sie durchzumachen. Nein, besten Dank. Ich will die ganze Sache so schnell wie möglich vergessen.“
„Es gibt da etwas, das Sie verstehen müssen, Jenna.“ Jetzt war es Brock, der sprach. Seine Stimme war leise und klang eher besorgt als fordernd. „Bitte hören Sie uns an.“
Sie blieb stehen, unsicher geworden, und Gideon füllte die Stille ihrer Unentschlossenheit.
„Wir haben Sie beobachtet, seit Sie im Hauptquartier angekommen sind“, sagte er zu ihr und ging zu einem Tastenfeld hinüber, das in die Wand eingelassen war. Er tippte darauf etwas ein, und ein Flachbildschirm senkte sich von der Decke. Das Videobild, das darauf erschien, war offenbar eine Aufnahme von ihr, schlafend in ebendiesem Zimmer. Nichts Weltbewegendes, nur sie reglos im Bett. „Das geht dreiundvierzig Stunden so, dann beginnt die Sache interessant zu werden.“
Er gab einen Befehl ein, der die Aufnahme bis zur genannten Stelle vorspulte. Jenna sah sich selbst auf dem Bildschirm und beobachtete skeptisch, wie ihre Videoversion auf dem Bett plötzlich begann, sich immer heftiger zu bewegen und zu winden, bis sie schließlich wild um sich schlug. Sie murmelte etwas im Schlaf, gab eine Reihe von Lauten von sich – und obwohl sie nichts davon verstand, wusste sie irgendwie, dass es Worte und Sätze waren.
„Ich verstehe das nicht. Was ist da los?“
„Wir hofften, dass Sie uns das sagen können“, sagte Lucan. „Erkennen Sie diese Sprache, die Sie da sprechen?“
„Sprache? Hört sich eher an wie sinnloser Blödsinn.“
„Sind Sie sicher?“ Er schien nicht überzeugt. „Gideon, das nächste Video.“
Eine andere Aufnahme füllte den Monitor aus, Bilder im Schnellvorlauf zur nächsten Episode, diese sogar noch verstörender als die erste. Völlig gebannt sah Jenna zu, wie ihr Körper auf dem Monitor wild zuckte und um sich trat, begleitet vom surrealen Soundtrack ihrer eigenen Stimme, die etwas sagte, das für sie absolut keinen Sinn ergab.
Sie war sonst keine, die sich leicht Angst machen ließ, aber in ihrer derzeitigen Situation waren diese Videoaufnahmen wie aus dem Irrenhaus so ziemlich das Allerletzte, was sie sehen wollte.
„Schalten Sie’s aus“, murmelte sie. „Bitte! Das reicht mir jetzt.“
„Wir haben Stunden mit solchem Videomaterial“, sagte Lucan, als Gideon das Video abschaltete. „Wir haben Sie die ganze Zeit rund um die Uhr überwacht.“
„Die ganze Zeit“, wiederholte Jenna. „Wie lange bin ich denn schon hier?“
„Fünf Tage“, antwortete Gideon. „Zuerst dachten wir, Sie wären in ein traumabedingtes Koma gefallen, aber Ihre Lebensfunktionen und Ihr Blutbild waren die ganze Zeit über normal. Vom medizinischen Standpunkt aus haben Sie nur …“ Er schien das richtige Wort zu suchen. „… geschlafen.“
„Fünf Tage lang“, wiederholte sie, um sicherzugehen, dass sie ihn richtig verstanden hatte. „Niemand schläft einfach so fünf Tage durch. Da muss was mit mir nicht in Ordnung sein. Herr im Himmel, nach allem, was passiert ist, sollte ich schleunigst zu einem Arzt, in ein richtiges Krankenhaus.“
Lucan schüttelte ernst den Kopf. „Einen besseren Experten als Gideon können Sie an der Oberfläche nicht finden. Das ist keine Sache, mit der die Ärzte Ihrer Spezies umgehen können.“
„Oberfläche? Meiner Spezies? Was soll denn das nun wieder heißen?“
„Jenna“, sagte Alex und nahm ihre Hand. „Ich weiß, du musst völlig durcheinander und verängstigt sein. Mir ging es vor einer Weile genauso, obwohl ich mir nicht einmal ansatzweise vorstellen kann, was du durchgemacht hast. Aber du musst jetzt stark sein. Du musst uns vertrauen – mir vertrauen, dass du wirklich in den bestmöglichen Händen bist. Wir helfen dir. Wir finden das raus, versprochen.“
„Rausfinden? Was wollt ihr rausfinden? Sag’s mir. Verdammt, ich muss wissen, was wirklich hier los ist!“
„Zeig ihr die Röntgenbilder“, murmelte Lucan Gideon zu, der mit einigen schnellen Tastatureingaben die Bilder auf dem Monitor aufrief.
„Dieses erste wurde nur Minuten nach Ihrer Ankunft hier im Hauptquartier gemacht“, erklärte er, als ein Schädel mit dem oberen Teil der Halswirbelsäule über ihnen aufleuchtete. Zwischen dem obersten Wirbel und der Schädelbasis erstrahlte ein wütend heller Fleck von der Größe eines Reiskornes.
Als sie endlich ihre Stimme wiederfand, zitterte sie ein wenig. „Was ist das?“
„Das wissen wir nicht genau“, antwortete Gideon sanft. Er rief ein anderes Röntgenbild auf. „Das hier wurde vierundzwanzig Stunden später gemacht. Wie Sie sehen können, beginnen dem Objekt winzige, fadenähnliche Fühler zu wachsen.“
Als Jenna hinsah, spürte sie, wie Alex’ Finger sich um ihre eigenen schlossen. Ein weiteres Bild erschien auf dem Monitor, und auf diesem war deutlich zu erkennen, dass die Fühler des hell leuchtenden Objektes begonnen hatten, sich mit ihrer Wirbelsäule zu verflechten.
„Oh Gott!“, flüsterte sie, hob die freie Hand und betastete die Haut in ihrem Nacken. Sie drückte fest zu und würgte fast, als sie dort die schwache Erhebung des Gegenstandes spürte, der in sie eingepflanzt war. „Er hat das mit mir gemacht?“
Leben … oder Tod?
Du hast die Wahl, Jenna Tucker-Darrow.
Jetzt erinnerte sie sich wieder an die Worte des Monsters und auch an die Wunde, die es sich selbst beigebracht hatte, das fast unsichtbar winzige Objekt, das es sich aus dem eigenen Fleisch gepult hatte.
Leben oder Tod?
Entscheide dich!
„Er hat mir etwas eingesetzt“, murmelte sie.
Der leichte Schwindel, den sie vor einigen Augenblicken gespürt hatte, kam nun heftig wieder. Ihre Knie gaben nach, doch bevor sie auf dem Boden landete, hatten Brock und Alex sie an den Armen genommen und stützten sie. So schrecklich es war, Jenna konnte die Augen nicht von dem Röntgenbild losreißen, das den Bildschirm über ihnen ausfüllte.
„Oh mein Gott!“, stöhnte sie. „Was zur Hölle hat dieses Monster bloß mit mir gemacht?“
Lucan starrte sie an. „Das ist es, was wir herausfinden wollen.“
2
Vom Korridor vor der Krankenstation aus sahen Brock und die anderen Krieger einige Minuten später zu, wie sich Alex auf den Bettrand setzte und ihre Freundin leise tröstete. Jenna brach nicht zusammen. Sie ließ sich von Alex liebevoll umarmen, aber ihre haselnussbraunen Augen blieben trocken, sie starrte mit unergründlicher Miene vor sich hin, reglos vor Schock.
Gideon räusperte sich, wandte den Blick vom kleinen Sichtfenster der Tür zum Krankenzimmer ab und brach das Schweigen. „Das hätte auch schlimmer laufen können.“
Brock stieß ein leises Knurren aus. „Wenn man bedenkt, dass sie gerade aus einem fünftägigen Koma aufgewacht ist, nur um zu erfahren, dass ihr Bruder tot ist, der Urahn aller Blutsauger sie zur Ader gelassen hat, sie dann gegen ihren Willen hierher gebracht wurde – und ach ja, übrigens haben wir da auch noch was in deiner Wirbelsäule gefunden, das vermutlich nicht von diesem Planeten stammt, also Glückwunsch, du hast beste Chancen, zum Cyborg zu werden!“ Er stieß einen trockenen Fluch aus. „Scheiße, ist das abgefuckt!“
„Kann man wohl sagen“, sagte Lucan. „Aber es wäre viel schlimmer, wenn wir die Situation nicht unter Kontrolle hätten. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist, die Frau ruhigzuhalten und genau zu beobachten, bis wir klarer sehen, was für ein Implantat das ist, ob es etwas für uns bedeuten könnte, und wenn ja, was. Zudem muss der Älteste einen Grund gehabt haben, das Ding überhaupt in sie einzupflanzen, und den müssen wir herausfinden, je eher, desto besser.“
Brock nickte zustimmend, wie auch der Rest seiner Brüder. Es war nur eine kleine Bewegung, doch als er seine Nackenmuskeln anspannte, schoss ihm eine heftige Schmerzattacke in den Schädel. Er drückte die Finger gegen die Schläfen und wartete, dass sie vorüberging.
Neben ihm runzelte Kade seine tiefschwarzen Brauen über den silbernen Wolfsaugen. „Alles okay?“
„Könnte nicht besser sein“, murmelte Brock, irritiert, dass Kade seine Besorgnis so öffentlich zeigte, auch wenn der Krieger wie ein Bruder für ihn war. Und obwohl Jennas schreckliche Schmerzen ihn innerlich zerfetzten, tat Brock sie mit einem Schulterzucken ab. „Keine große Sache, war ja nicht anders zu erwarten.“
„Du absorbierst die Schmerzen dieser Frau seit fast einer Woche“, erinnerte ihn Lucan. „Wenn du mal eine Pause brauchst …“
Brock zischte einen leisen Fluch. „Mir fehlt nichts, was ein paar Stunden Patrouille heute Nacht nicht kurieren könnten.“
Sein Blick wanderte zu dem kleinen Sichtfenster in der Tür des Krankenzimmers. Wie alle Angehörigen des Stammes verfügte Brock über eine übersinnliche Gabe, die nur er allein besaß. Mit seiner Fähigkeit, Schmerz und Leiden von Menschen zu absorbieren, hatte er Jenna seit ihrem Martyrium in Alaska in einem halbwegs schmerzfreien Zustand stabilisiert, aber mehr als Erste Hilfe konnte er nicht leisten.
Jetzt, wo sie wieder bei Bewusstsein war und dem Orden wichtige Informationen über ihre Zeit mit dem Ältesten und die außerirdische Materie liefern konnte, die er ihr eingepflanzt hatte, war sein Job getan und Jenna Darrow wieder auf sich allein gestellt.
„Da ist noch was, das ihr alle wissen müsst“, sagte Brock und sah zu, wie sie ihre nackten Beine vorsichtig über den Bettrand schwang und aufstand. Er versuchte nicht zu bemerken, wie ihr der weiße Krankenhauskittel die Oberschenkel hinaufrutschte, kurz bevor ihre Füße den Boden berührten. Stattdessen konzentrierte er sich darauf, wie überraschend schnell sie ihr Gleichgewicht wiederfand. Nach den fünf Tagen im unnatürlichen Koma trugen ihre Muskeln ihr Gewicht erstaunlich sicher. „Sie ist stärker, als sie sein sollte. Sie kann ohne Hilfe gehen, und vor ein paar Minuten, als nur Alex und ich bei ihr drin waren, hat sich Jenna aufgeregt, weil sie ihren Bruder sehen wollte. Ich wollte sie berühren und beruhigen, und sie hat meine Hand abgewehrt. Hat sie einfach weggeschlagen, als wäre das ein Klacks für sie.“
Kade hob die Brauen. „Mal ganz davon abgesehen, dass du ein Stammesvampir mit den entsprechenden Reflexen bist, wiegst du auch über siebzig Kilo mehr als diese Frau.“
„Genau das meine ich.“ Brock sah zu Lucan und den anderen. „Ich glaube nicht, dass sie realisiert hat, was das bedeutet, aber ihre Kraft ist unglaublich. Sie hat mich fast umgeworfen, ohne dass sie es wirklich versucht hat.“
„Lieber Himmel!“, flüsterte Lucan, die Kiefermuskeln angespannt.
„Auch ihre Schmerzen sind jetzt stärker als vorher“, fügte Brock hinzu. „Ich weiß nicht, was da los ist, aber alles an ihr scheint jetzt, wo sie wach ist, irgendwie intensiver zu werden.“
Lucans Stirnrunzeln vertiefte sich, als er Gideon ansah. „Und wir sind sicher, dass sie eine Normalsterbliche ist und keine Stammesgefährtin?“
„Ganz gewöhnliche Homo sapiens“, bestätigte das Universalgenie des Ordens. „Als ihr sie aus Alaska eingeflogen habt, habe ich Alexandra sofort gebeten, sich die Haut ihrer Freundin genau anzusehen. Da war nirgendwo ein Tränen-und-Mondsichel-Muttermal auf Jennas Körper. Und was ihr Blutbild und ihre DNA angeht, waren alle Proben, die ich ihr entnommen habe, auch sauber. Seither habe ich alle vierundzwanzig Stunden Tests gemacht – keinerlei Auffälligkeiten. Abgesehen von diesem Implantat ist alles an ihr völlig banal.“
Banal? Fast hätte Brock geschnaubt über das unangemessene Wort. Natürlich waren weder Gideon noch die anderen Krieger bei Jennas Ganzkörperuntersuchung nach ihrer Ankunft im Hauptquartier dabei gewesen. Die meiste Zeit war sie vor Schmerzen bewusstlos gewesen, seit Brock, Kade, Alex und der Rest des Teams die Heimreise aus Alaska nach Boston angetreten hatten.
Weil er der Einzige war, der sie schmerzfrei halten konnte, war Brock angewiesen worden, an Jennas Seite zu bleiben und die Situation so gut wie möglich unter Kontrolle zu halten. Seine Rolle hätte rein professionell sein sollen, emotionslos und distanziert. Nur ein Spezialwerkzeug, das man für den Notfall bereithielt.
Und doch hatte er auf den Anblick von Jennas nacktem Körper beunruhigend unprofessionell reagiert. Es war schon fünf Tage her, aber er erinnerte sich immer noch so deutlich an jeden Zentimeter ihrer elfenbeinweißen Haut, als sähe er sie gerade wieder vor sich, allein beim Gedanken daran beschleunigte sich sein Puls.
Er erinnerte sich an jede glatte Rundung und sanfte Mulde, jedes kleine Muttermal, jede Narbe – von der verblassten Kaiserschnittnarbe auf ihrem Unterbauch zu den verheilten Schnitt- und Platzwunden, die ihren Rumpf und ihre Oberarme sprenkelten und ihm sagten, dass sie schon mindestens einmal in ihrem Leben mitten durch die Hölle gegangen war.
Und er war alles andere als emotionslos und distanziert gewesen, als Jenna plötzlich von einem Krampfanfall geschüttelt wurde, kurz nachdem Alex ihre vergebliche Suche nach dem Muttermal beendet hatte, das ihre Freundin als Stammesgefährtin ausgewiesen hätte wie Alex und die anderen Frauen, die im Hauptquartier des Ordens lebten. Er hatte ihr beide Hände seitlich an den Hals gelegt und den Schmerz aus ihr herausgezogen, sich nur allzu sehr bewusst, wie weich und zart ihre Haut unter seinen Fingerspitzen war. Beim Gedanken daran ballte er die Fäuste.
Er sollte nicht an diese Frau denken, weder nackt noch sonst wie. Bloß dass er jetzt, wo er damit angefangen hatte, an verdammt wenig anderes mehr denken konnte. Und als sie aufsah und durch das kleine Sichtfenster in der Tür seinen Blick fing, durchzuckte ihn eine unwillkommene Hitze wie ein Brandpfeil.
Dass er scharf auf sie war, war schon schlimm genug, doch es war das seltsame Gefühl, sie beschützen zu wollen, das ihn wirklich aus dem Gleichgewicht brachte. Es hatte schon in Alaska begonnen, als er und die anderen Krieger sie gefunden hatten, und in den Tagen, die sie nun schon im Hauptquartier war, hatte es nicht nachgelassen. Es war nur noch stärker geworden, als er sie beobachtet hatte, wie sie gegen den tiefen Schlaf ankämpfte, der sie bewusstlos hielt, seit sie ihrem Martyrium durch den Ältesten in Alaska entkommen war.
Immer noch sah sie ihn von der anderen Seite des Krankenzimmers aus an: auf der Hut, fast schon misstrauisch. Da war keine Schwäche in ihren Augen und ihrem leicht gehobenen Kinn. Trotz allem, was sie durchgemacht hatte, war Jenna Darrow ganz klar eine starke Frau, und er ertappte sich bei dem Gedanken, dass eine in Tränen aufgelöste und hysterische Jenna ihm lieber gewesen wäre als diese kühle und beherrschte Frau, deren unverwandter Blick ihn nicht loslassen wollte.
Sie war ruhig und stoisch, so tapfer, wie sie schön war, und das machte sie weiß Gott nur noch faszinierender für ihn.
„Wann hast du das letzte Mal Blut und DNA getestet?“, fragte Lucan, und seine ernste, mit leiser Stimme gestellte Frage riss Brock aus seinen Gedanken.
Gideon schob seinen Hemdsärmel hoch und sah auf die Uhr. „Vor etwa sieben Stunden.“
Lucan wandte sich mit einem Grunzlaut von der Tür des Krankenzimmers ab. „Mach alles noch mal! Wenn ihre Werte sich seither auch nur um ein Jota verändert haben, will ich das wissen.“
Gideon nickte eifrig. „Nach dem, was Brock uns erzählt hat, würde ich auch gerne einige Kraft- und Belastungstests mit ihr machen. Wir brauchen möglichst umfassende Messdaten von ihr, nur so können wir herausfinden, womit genau wir es hier zu tun haben.“
„Du hast freie Hand“, sagte Lucan grimmig. „Nur mach es schnell! Das hier ist wichtig, aber wir können uns trotzdem nicht leisten, uns davon bei unseren anderen Missionen aufhalten zu lassen.“
Brock senkte den Kopf, zusammen mit den übrigen Kriegern, er wusste so gut wie alle anderen, dass ein normalsterblicher Mensch im Hauptquartier eine zusätzliche Belastung für den Orden darstellte, dessen größter Feind sich immer noch auf freiem Fuß befand – ein wahnsinniger Stammesältester namens Dragos, den der Orden schon fast ein Jahr lang verfolgte.
Dragos hatte jahrzehntelang im Geheimen gearbeitet, unter diversen falschen Identitäten und in geheimen, mächtigen Bündnissen. Seine Operation hatte mittlerweile zahlreiche und weitgehende Ableger, wie die Krieger nach und nach entdeckt hatten, und jeder einzelne dieser Fangarme arbeitete zusammen mit den anderen nur auf ein einziges Ziel zu: Dragos die Alleinherrschaft über den Stamm und die ganze Menschheit zu verschaffen.
Erste Priorität des Ordens waren seine Eliminierung und die schnelle, endgültige Auflösung seiner ganzen Operation. Der Orden wollte Dragos an der Wurzel packen, aber auch hier gab es Komplikationen. Denn in letzter Zeit war er spurlos verschwunden, und wie immer versteckte er sich hinter zahlreichen Schutzmaßnahmen – bei seinen geheimen Verbündeten in der Stammesbevölkerung, vielleicht auch außerhalb. Dragos gebot auch über eine ganze Armee hochspezialisierter Killer, jeder Einzelne von ihnen eigens gezüchtet und von Geburt an zum Töten abgerichtet. Die direkten Nachkommen des Außerirdischen, den Dragos gefangen gehalten hatte, bis er vor einigen Wochen nach Alaska geflohen und dort getötet worden war.
Brock sah ins Krankenzimmer, wo Jenna begonnen hatte, auf und ab zu gehen wie ein eingesperrtes Tier im Käfig. Zu sagen, dass der Orden derzeit alle Hände voll zu tun hatte, war die Untertreibung des Jahres. Jetzt, wo sie wach war, wurde er wenigstens hier nicht mehr gebraucht. Dank seiner Gabe hatte Jenna die letzte Woche überstanden; von nun an würden Gideon und Lucan entscheiden, wie es mit ihr weitergehen sollte.
Im Krankenzimmer wandte Alex sich von ihrer Freundin ab und näherte sich der Tür. Sie öffnete sie und schlüpfte auf den Gang hinaus, ihre braunen Augen unter dem dunkelblonden Pony blickten besorgt.
„Wie geht’s ihr?“, fragte Kade und kam auf seine Liebste zu, als zöge die Schwerkraft ihn zu ihr hin. Das frisch blutsverbundene Paar hatte sich bei Kades Mission in Alaska kennengelernt, aber, dachte Brock, wenn man den Krieger und seine hübsche Buschpilotin zusammen sah, konnte man kaum glauben, dass sie erst ein paar Wochen zusammen waren. „Braucht Jenna irgendwas, Schatz?“
„Sie ist verwirrt und aufgeregt, ist ja verständlich“, sagte Alex. Sie kam auf ihn zu und kuschelte sich an ihn. „Nach einer langen Dusche und in frischen Sachen wird sie sich besser fühlen. Sie sagt, da drin fällt ihr die Decke auf den Kopf, sie möchte etwas spazieren gehen und sich die Beine vertreten. Ich habe ihr gesagt, ich gehe mal fragen, ob das in Ordnung ist.“
Dabei sah Alex Lucan an, richtete die Frage an das älteste Mitglied des Ordens, seinen Gründer und Anführer.
„Jenna ist keine Gefangene hier“, antwortete er. „Natürlich kann sie sich waschen, anziehen und spazieren gehen.“
„Danke“, sagte Alex, und die leichte Unsicherheit in ihren Augen wich fröhlicher Dankbarkeit. „Ich habe ihr schon gesagt, dass sie hier keine Gefangene ist, aber sie hat mir nicht geglaubt. Nach allem, was sie durchgemacht hat, ist das wohl auch kein Wunder. Dann gehe ich mal und sage es ihr, Lucan.“
Als sie sich umdrehte, um wieder ins Krankenzimmer zu schlüpfen, räusperte sich der Anführer des Ordens. Kades Gefährtin blieb stehen und warf einen Blick über die Schulter, und Lucans strenger Blick schien ihr etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen. „Jenna darf sich frei bewegen und so ziemlich alles tun, was sie möchte – solange immer jemand dabei ist und sie nicht versucht, das Hauptquartier zu verlassen. Sieh zu, dass sie alles hat, was sie braucht. Wenn sie sich für ihren Spaziergang im Hauptquartier fertig gemacht hat, wird Brock mit ihr gehen und dafür sorgen, dass sie sich nicht verläuft.“
Brock musste sich schwer zusammennehmen, um sich den Fluch zu verkneifen, der ihm auf der Zunge lag.
Na toll! dachte er und hätte den Auftrag, der ihn nun weiter an Jenna Darrows Seite fesselte, am liebsten abgelehnt.
Stattdessen nahm er Lucans Befehl mit einem ernsten Nicken entgegen.
3
Jenna rammte die Fäuste in die Taschen des weißen Frotteebademantels, den sie über ihrem dünnen Krankenhauskittel trug. Ihre Füße fanden kaum Halt in den neuen, aber übergroßen Männerschlappen, die Alex in einer Schrankschublade im Krankenzimmer gefunden hatte, wo Jenna vor knapp einer Stunde aufgewacht war. Sie schlurfte neben ihrer Freundin über einen hell erleuchteten weißen Marmorkorridor, der sich durch ein scheinbar endloses Labyrinth ähnlicher Gänge wand.
Jenna fühlte sich seltsam benommen. Nicht nur von dem Schock darüber, dass ihr Bruder tot war, sondern auch, weil der Albtraum, aus dem sie erwacht war, mit ihrem Überleben noch nicht zu Ende war. Das Monster, das sie in ihrem Haus angefallen hatte, mochte ja tot sein, wie man ihr gesagt hatte, doch war sie immer noch nicht frei von ihm.
Seit sie die Röntgenaufnahmen und die Überwachungsvideos aus dem Krankenzimmer gesehen hatte, wusste sie mit absoluter, grauenvoller Gewissheit, dass ein Teil dieses Monsters sie immer noch in seinen grausamen Klauen hielt. Allein das schon wäre eigentlich genug, um vor Entsetzen zu schreien. Tief in ihr herrschten Angst und Kummer, aber sie gab sich alle Mühe, die Hysterie zu unterdrücken, die in ihr brodelte; weigerte sich, diese Art von Schwäche zu zeigen, selbst ihrer besten Freundin gegenüber.
Aber gleichzeitig spürte sie auch eine tiefe Ruhe in sich, wie schon die ganze Zeit im Krankenzimmer – und zwar vom Augenblick an, als Brock seine Hände auf sie gelegt und ihr versprochen hatte, dass sie in Sicherheit war. Diese Zusicherung, zusammen mit ihrer eigenen eisernen Entschlossenheit, sich nicht unterkriegen zu lassen, war es, was ihren Zusammenbruch verhinderte, als sie jetzt zusammen mit Alex die labyrinthartigen Korridore durchwanderte.
„Wir sind schon fast da“, sagte Alex und führte sie um eine Biegung in einen weiteren langen Gang. „Ich dachte, es ist angenehmer für dich, bei mir und Kade in der Wohnung zu duschen und dich umzuziehen als drüben in der Krankenstation.“
Jenna gelang ein vages Nicken, obwohl sie sich kaum vorstellen konnte, sich irgendwo an diesem seltsamen, unvertrauten Ort wohlzufühlen. Sie ging vorsichtig, und ihre eingerosteten Bulleninstinkte flackerten auf, als sie an immer neuen Türen ohne Aufschrift vorüberging. Hier gab es kein einziges Fenster nach draußen, nichts, das Aufschluss darüber gab, wo sich diese sogenannte Einrichtung befand, noch darüber, was sich hinter diesen Wänden verbarg. Man konnte nicht einmal sagen, ob es draußen Tag oder Nacht war.
Hier wie auch in allen anderen Korridoren waren überall kleine schwarze Halbkugeln an der Decke angebracht, in denen sich offenbar Überwachungskameras verbargen. Es war alles sehr Hightech, sehr abgeschottet und sehr gesichert.
„Was ist das hier, ein Regierungsgebäude?“, fragte sie und äußerte ihren Verdacht laut. „Definitiv keine Zivilbehörde. Ist das eine Einrichtung der Armee?“
Alex warf ihr einen zögernden, prüfenden Seitenblick zu. „Es ist noch viel sicherer als das. Wir sind hier etwa dreißig Stockwerke unter der Erde, in einem Außenbezirk von Boston.“
„Ein Bunker also“, riet Jenna und versuchte immer noch, sich einen Reim auf das alles zu machen. „Wenn er nicht der Regierung oder der Armee gehört, wem dann?“
Alex schien einen Augenblick länger als nötig über ihre Antwort nachzudenken. „Das unterirdische Hauptquartier und das gesicherte Anwesen darüber gehören dem Orden.“
„Dem Orden“, wiederholte Jenna und dachte, dass Alex’ Erklärung mehr Fragen aufwarf als beantwortete. An einem Ort wie diesem war sie noch nie gewesen. Sein Hightechdesign hatte etwas Fremdartiges, es war so ganz anders als alles, was sie im ländlichen Alaska oder an den Orten im US-amerikanischen Kernland, die sie kannte, jemals gesehen hatte.
Dieser fremdartige Eindruck wurde noch dadurch verstärkt, dass der polierte weiße Marmor unter ihren Schlappen mit Intarsien aus glänzendem schwarzem Stein verziert war, die ein unendliches Muster seltsamer Symbole bildeten – kunstvolle Schnörkel und komplexe geometrische Formen, die irgendwie an Stammestattoos erinnerten.
Dermaglyphen.
Das Wort drang aus dem Nichts in ihre Gedanken, die Antwort auf eine Frage, die sie nicht einmal hätte formulieren können. Es war ein unbekanntes Wort, so unvertraut wie ihre ganze Umgebung und die Leute, die offenbar hier lebten. Und doch gab die Gewissheit, mit der ihr Verstand ihr diesen Begriff geliefert hatte, ihr das Gefühl, als hätte sie es schon Tausende von Malen gedacht oder gesagt.
Unmöglich.
„Jenna, alles okay mit dir?“ Alex blieb einige Schritte vor Jenna auf dem Korridor stehen. „Bist du müde? Legen wir eine Pause ein.“
„Nein, alles in Ordnung.“ Sie spürte, dass sie die Stirn runzelte, als sie von dem kunstvollen Muster auf dem glatten Marmorboden aufsah. „Ich bin bloß … durcheinander.“
Und das lag nicht nur an dem seltsamen Ort, an dem sie sich wiedergefunden hatte. Alles fühlte sich anders an, sogar ihr eigener Körper. Nach fünf Tagen Bewusstlosigkeit in einem Krankenbett müsste sie doch eigentlich völlig erschöpft sein, dachte sie, selbst nach dieser kurzen Strecke, die sie eben gegangen war.
Nach so langer Inaktivität erholten Muskeln sich normalerweise nicht so schnell ohne Schmerzen und etwas Training. Das wusste sie aus eigener Erfahrung nach ihrem Unfall vor vier Jahren, der sie auf die Intensivstation des Krankenhauses von Fairbanks gebracht hatte. Derselbe Unfall, bei dem ihr Mann und ihre kleine Tochter umgekommen waren.
Jenna erinnerte sich nur zu gut an die wochenlangen harten Reha-Maßnahmen, bis sie wieder hatte aufstehen und gehen können. Doch jetzt, seit sie aus ihrem Martyrium erwacht war, fühlten sich ihre Glieder so stark und beweglich an, als hätte es die lange Ruhepause gar nicht gegeben.
Ihr Körper fühlte sich seltsam belebt an. Stärker als vorher und doch irgendwie nicht ganz wie ihr eigener.
„Das alles ergibt doch gar keinen Sinn“, murmelte sie, als sie und Alex ihren Weg über den langen Korridor wieder aufnahmen.
„Ach Jen.“ Alex legte ihr sanft die Hand auf die Schulter. „Ich weiß, wie verwirrend das alles für dich sein muss. Glaub mir, das weiß ich wirklich. Ich wünsche mir so, das alles wäre gar nicht passiert. Wenn man doch nur irgendwie ungeschehen machen könnte, was du durchgemacht hast.“
Jenna blinzelte langsam und registrierte, wie ernst es ihrer Freundin war. Sie hatte Fragen – so viele Fragen, aber als sie tiefer in das Labyrinth von Korridoren gingen, drang aus einem Raum mit Glaswand weiter vorne Stimmengewirr. Sie hörte Brocks tiefen, rollenden Bariton und die hellere Stimme des Mannes mit dem britischen Akzent, der immer so schnell redete und Gideon hieß.
Als sie und Alex sich dem Versammlungsraum näherten, sah sie, dass der, der Lucan hieß, auch da war, wie auch Kade und zwei andere, die die tödliche Ausstrahlung, die diese Typen offenbar mit derselben Lässigkeit zur Schau trugen wie ihre schwarzen Drillichhosen und gut bestückten Waffengürtel, nur noch verstärkten.
„Das ist das Techniklabor“, erklärte ihr Alex. „Das ganze Computerequipment da drin ist Gideons Reich. Kade sagt, er ist ein absolutes Technikgenie, und es gibt eigentlich nichts, womit er sich nicht auskennt.“
Als sie im Korridor stehen blieben, sah Kade auf und warf Alex durch die Scheibe einen langen Blick zu. Elektrische Spannung knisterte in seinen silbernen Augen, und Jenna hätte schon bewusstlos in ihrem Krankenbett liegen müssen, um die Hitze zwischen Alex und ihrem Liebsten nicht zu spüren.
Sie selbst hingegen wurde von allen anderen angestarrt, die in dem rundum verglasten Raum versammelt waren. Lucan und Gideon drehten sich beide zu ihr um, so wie auch zwei andere riesenhafte Männer, die sie nicht kannte, der eine ein ernst wirkender Blonder mit goldenen Augen, dessen starrender Blick sich so kalt und gefühllos wie eine Klinge anfühlte; der andere hatte olivfarbene Haut, eine dichte schokoladenbraune Mähne und topasfarbene Augen mit langen Wimpern, und die linke Hälfte seines ansonsten makellosen Gesichts wurde von wucherndem Narbengewebe verunstaltet. Die beiden starrten sie unverhohlen an, in ihren Blicken lagen Neugier und auch eine Spur Misstrauen.
„Das sind Hunter und Rio“, sagte Alex und zeigte auf den bedrohlich wirkenden Blonden und den vernarbten Dunklen. „Auch sie gehören zum Orden.“
Jenna nickte ihnen vage zu, sie fühlte sich vor diesen Männern so deutlich sichtbar wie damals an ihrem ersten Tag bei der Staatspolizei von Alaska – als Grünschnabel frisch von der Polizeiakademie und noch dazu als Frau. Doch hier lag es weniger an Diskriminierung von Frauen oder den üblichen männlichen Unsicherheiten – von diesem Blödsinn hatte sie während ihrer Polizistinnenlaufbahn genug abbekommen, um zu erkennen, dass es hier um etwas anderes ging. Etwas, das viel tiefer ging.
Hier hatte sie das Gefühl, dass allein schon ihre Anwesenheit an diesem Ort geheiligtes Territorium verletzte. Diese fünf Augenpaare, die sie musterten, gaben ihr unausgesprochen deutlich zu verstehen, dass sie hier an diesem Ort und unter diesen Leuten der ultimative Außenseiter war.
Selbst Brocks dunkle, faszinierende Augen begutachteten sie ernst und schienen zu sagen, dass er sie hier nicht gerne sah, obwohl er sie doch im Krankenzimmer mit solcher Freundlichkeit und Fürsorglichkeit behandelt hatte.
Da rannte er bei Jenna offene Türen ein, sie neigte dazu, der unausgesprochenen Botschaft zuzustimmen, die sie durch die Glaswände des Techniklabors bekam: Sie gehörte nicht hierher. Das waren nicht ihre Leute.
Nein, etwas an jedem der harten, unergründlichen Gesichter, die sie so unverwandt ansahen, sagte ihr, dass das überhaupt nicht ihre Leute waren. Sie waren … etwas anderes.
Aber konnte sie nach allem, was sie in ihrem Haus in Alaska durchgemacht und was sie von sich selbst im Krankenzimmer gesehen hatte, überhaupt noch sicher sein, was sie selbst eigentlich war?
Die Frage jagte ihr eisigen Schrecken ein.
Darüber wollte sie nicht nachdenken. Sie wollte kaum wahrhaben, dass etwas so Monströses und Entsetzliches wie die Kreatur, die sie stundenlang in ihrem eigenen Zuhause gefangen gehalten hatte, sich von ihr genährt, ihr diese fremde Materie implantiert und ihr Leben – oder was davon noch übrig war – völlig auf den Kopf gestellt hatte.
Was würde nur aus ihr werden?
Wie konnte sie jemals wieder die Frau sein, die sie gewesen war?
Jenna brach fast zusammen unter der Last immer neuer Fragen, über die sie noch nicht nachzudenken wagte.
Und dann stieg zu allem Überfluss auch noch das Gefühl von Desorientierung wieder in ihr auf, das sie durch die Korridore des Hauptquartiers verfolgt hatte, stärker denn je. Alles um sie herum schien plötzlich seltsam verstärkt, vom leisen Summen der Neonröhren an der Decke, deren Licht zu grell für ihre empfindlichen Augen war, bis hin zum Trommeln ihres Herzens, das immer schneller zu rasen begann und ihr zu viel Blut durch die Adern pumpte. Ihre Haut fühlte sich zu eng an und umschloss einen Körper, in dem sich ein seltsames neues Gefühl von Bewusstsein regte. Sie hatte es schon von dem Augenblick an gespürt, als sie im Krankenzimmer die Augen geöffnet hatte, und statt dass es nachließ, wurde es immer stärker.
Eine seltsame neue Kraft schien in ihr zu wachsen.
Sie dehnte sich aus, regte sich, erwachte …
„Mir ist irgendwie komisch“, sagte sie zu Alex, als ihr der Puls in den Schläfen dröhnte und ihre Hände feucht wurden, die sie tief in den Taschen ihres Bademantels zu Fäusten geballt hatte. „Ich glaube, ich muss raus an die frische Luft.“
Alex streckte die Hand aus und strich Jenna eine Haarsträhne aus dem Gesicht. „Unser Quartier ist gleich da vorne. Nach einer heißen Dusche geht’s dir gleich besser, du wirst sehen.“
„Okay“, murmelte Jenna und ließ sich wegführen, fort von der gläsernen Wand des Techniklabors und den entnervenden Blicken, die ihr folgten.
Einige Meter vor ihnen in der geschwungenen Halle glitt eine Lifttür auf. Drei Frauen in schneeüberzuckerten Wintermänteln und nassen Stiefeln kamen heraus, gefolgt von einem ähnlich vermummten kleinen Mädchen, das zwei angeleinte Hunde hielt – einen quirligen kleinen Terriermischling und Alex’ majestätische grauweiße Wolfshündin Luna, die die Reise von Alaska nach Boston offenbar ebenfalls mitgemacht hatte.
Sobald Lunas scharfe blaue Augen Alex und Jenna erblickten, machte sie einen Satz nach vorn. Das kleine Mädchen, das die Leine hielt, stieß ein überraschtes Kichern aus, die Kapuze ihres Anoraks fiel zurück und enthüllte einen dichten blonden Haarschopf um ihr zartes Gesicht.
„Hi, Alex!“, sagte sie und lachte, als Luna sie den Korridor entlang hinter sich herzog. „Wir waren gerade draußen spazieren, da oben ist es schweinekalt!“
Alex streckte die Hand aus, wuschelte Luna über den mächtigen Kopf und lächelte dem Kind zu. „Danke, dass du sie ausgeführt hast. Ich weiß, dass sie gern mit dir zusammen ist, Mira.“
Das kleine Mädchen nickte enthusiastisch. „Ich mag Luna auch. Und Harvard erst!“
Der rauflustig wirkende Terrier bellte einmal aus Protest oder Zustimmung und tanzte dann mit wild rotierendem Stummelschwänzchen um die Beine der größeren Hündin herum.
„Hallo!“, sagte eine der drei Frauen. „Ich bin Gabrielle. Schön zu sehen, dass Sie wieder wach und auf den Beinen sind, Jenna.“
„Tut mir leid“, warf Alex ein und machte eine schnelle Vorstellungsrunde. „Jenna, Gabrielle ist Lucans Stammesgefährtin.“
„Tag.“ Jenna zog die Hand aus der Bademanteltasche und hielt sie der hübschen jungen Frau mit den kastanienbraunen Haaren hin. Als Nächste begrüßte sie die umwerfende Afroamerikanerin neben Gabrielle mit einem warmen Lächeln.
„Ich bin Savannah“, sagte sie mit einer Stimme wie Samt und Sahne, und Jenna hatte schlagartig das Gefühl, unter Freunden zu sein. „Meinen Gefährten Gideon haben Sie ja sicher schon kennengelernt.“
Jenna nickte, trotz der Herzlichkeit der anderen Frauen fühlte sie sich schlecht gerüstet für höfliches Geplänkel.
„Und das ist Tess“, fügte Alex hinzu und zeigte auf das letzte Mitglied des Trios, eine hochschwangere Blondine mit ruhigen meergrünen Augen, die für ihr Alter ungewöhnlich weise schien. „Sie und ihr Gefährte Dante erwarten demnächst ihren kleinen Sohn.“
„Nur noch ein paar Wochen“, sagte Tess und ergriff kurz Jennas Hand, die andere legte sie leicht auf ihren riesigen Bauch. „Wir haben uns alle große Sorgen um Sie gemacht, seit Sie angekommen sind, Jenna. Brauchen Sie irgendwas? Wenn wir etwas für Sie tun können, hoffe ich, Sie lassen es uns wissen.“
„Könnte mich vielleicht jemand eine Woche in die Vergangenheit zurückbeamen?“, fragte Jenna, nur halb im Scherz. „Am liebsten würde ich die letzten paar Tage löschen und zu meinem Leben in Alaska zurückkehren. Kann das hier irgendwer für mich tun?“
Die anderen Frauen warfen einander unbehagliche Blicke zu.
„Ich fürchte, das ist nicht möglich“, sagte Gabrielle. Obwohl ihr Mitgefühl sie etwas milder wirken ließ, sprach Lucans Gefährtin mit dem ruhigen Selbstbewusstsein einer Frau, die sich ihrer Autorität bewusst war und sie nie missbrauchen würde. „Sie haben wirklich Schreckliches durchgemacht, Jenna, aber der einzige Weg hinaus führt nach vorn. Tut mir leid.“
„Und mir erst“, sagte Jenna ruhig.
Alex murmelte den anderen Frauen ein paar leise Abschiedsworte zu. Sie kraulte Luna hinter den Ohren und küsste die Wolfshündin schnell auf die Schnauze, und dann navigierte sie Jenna weiter den Korridor hinauf. Irgendwo in der Ferne registrierte Jenna scharfes Waffengeklirr und eine lebhafte Unterhaltung, die immer wieder von gedämpftem Gelächter unterbrochen wurde – so wie es sich anhörte, ein guter altmodischer Pisswettbewerb zwischen einer Frau und mindestens drei Männern.
Jenna schlurfte neben Alex her, dann bogen sie um eine Ecke, und die Stimmen und der Waffenlärm verblassten. „Wie viele Leute wohnen eigentlich hier?“
Alex legte den Kopf schief und dachte nach. „Der Orden hat derzeit elf Mitglieder, die hier im Hauptquartier leben. Alle außer Brock, Hunter und Chase haben Gefährtinnen, das macht also acht Stammesgefährtinnen, plus Mira.“
„Zwanzig Leute insgesamt“, sagte Jenna, und zählte sie abwesend durch.
„Mit dir einundzwanzig“, berichtigte Alex und warf ihr über die Schulter einen prüfenden Blick zu.