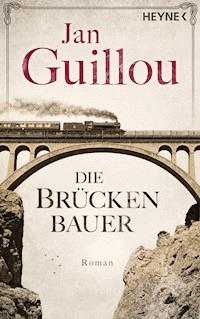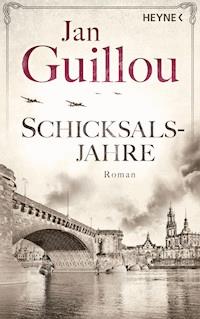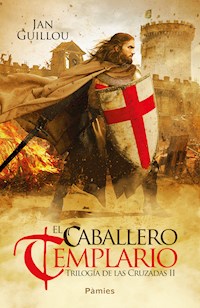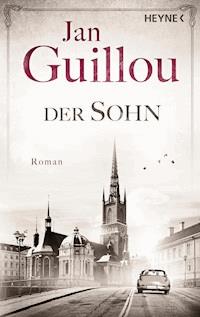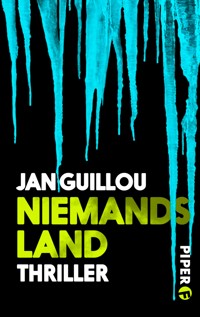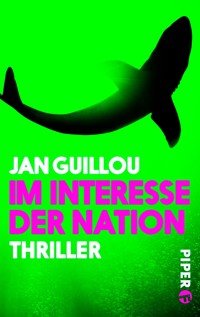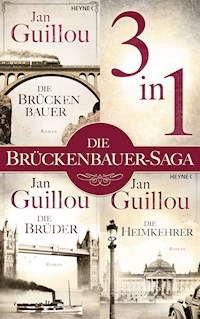Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die schwedische Originalausgabe erschien 1999 unter dem Titel Tempelriddaren bei Norstedts Förlag, Stockholm.
Der Roman erschien in Deutschland bereits 2000 unter dem Titel Die Büßerin von Gudhem im Piper Verlag, München.
Der Koran wird nach der Übersetzung von Max Henning, Reclam Verlag, Stuttgart, zitiert.
Vollständige deutsche Ausgabe 05/2009
Copyright © Jan Guillou 1999
Copyright © der Übersetzung Piper Verlag GmbH, München Copyright © 2009 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München. Coverfoto: Shutterstock
ISBN : 978-3-641-04284-4V003www.heyne.de
Inhaltsverzeichnis
ZUM BUCH
ZUM AUTOR
Die Kreuzritter-Saga:
IM NAMEN ALLAHS, DES ERBARMERS, DES BARMHERZIGEN
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
ANHANG
Das Palästina Arn Magnussons
ARN – Der Kreuzritter:
Die Schauplätze des Buchs
Copyright
ZUM BUCH
Im zweiten Band der großen Kreuzrittersaga müssen Arn Magnusson und seine Geliebte Cecilia Buße tun für ihre in Band eins begangene Blutschande. Während Arn zur Strafe für zwanzig Jahre ins Heilige Land geschickt wird, wo er als Tempelritter mithelfen soll, Jerusalem zu befreien, muss Cecilia in einem Kloster sühnen. Durch seinen Mut und seine kämpferischen Fähigkeiten steigt Arn bald zu einem geachteten Heeresführer auf, doch gleichzeitig durchschaut er die scheinbar noble Gesinnung seiner christlichen Mitstreiter und sehnt sich zurück in seine Heimat Götaland. Dort wartet noch immer seine geliebte Cecilia auf ihn. Seit Jahren hat sie keine Nachricht aus dem fernen Morgenland erhalten – und so ahnt sie auch nicht, dass Arn in Saladins Gefangenschaft geraten ist.
Der zweite – in sich abgeschlossene – Roman der epischen Kreuzrittersaga um das abenteuerliche Leben des Arn Magnusson.
Weitere Informationen rund um die Welt von Arn finden Sie unter www.arnmagnusson.se.
ZUM AUTOR
Jan Guillou wurde 1944 im schwedischen Södertälje geboren und ist einer der prominentesten Journalisten seines Landes. Seine preisgekrönten Kriminalromane um den Helden Coq Rouge erreichten Millionenauflagen. Auch mit seiner historischen Romansaga um den Kreuzritter Arn gelang ihm ein Bestseller, die Verfilmungen zählen in Schweden zu den erfolgreichsten aller Zeiten. Heute lebt Jan Guillou in Stockholm.
Die Kreuzritter-Saga:
Der Kreuzritter – Aufbruch Der Kreuzritter – Verbannung Der Kreuzritter – Rückkehr (Herbst 2009) Der Kreuzritter – Erbe (Frühjahr 2010)
IM NAMEN ALLAHS, DES ERBARMERS, DES BARMHERZIGEN
»Preis dem, der seinen Diener des Nachts entführte von der heiligen Moschee Kaaba zur fernsten Moschee, deren Umgebung wir gesegnet haben, um ihm unsre Zeichen zu zeigen. Siehe, er ist der Hörende, der Schauende.«
DER HEILIGE KORAN, 17. Sure, Vers 1
DAS HEILIGE LAND
In der Nacht kam Gottes Erzengel Gabriel zu Mohammed, nahm ihn bei der Hand und führte ihn zur heiligen Moschee Kaaba. Dort wartete Al Buraq, der Geflügelte, um sie dorthin zu führen, wohin Gott wollte.
Und Al Buraq, der mit einem Schritt von Horizont zu Horizont gelangen konnte, breitete seine weißen Flügel aus, stieg hoch in den sternklaren Weltraum und führte Mohammed, Friede sei seinem Namen, und seine Gefolgsleute in die Heilige Stadt Jerusalem und an den Platz, auf dem Salomos Tempel einmal gestanden hatte. Dort lag an der westlichen Mauer der fernste Gebetsplatz. Und der Erzengel Gabriel führte den Boten Gottes an der Hand zu denen, die ihm vorausgegangen waren, zu Moses, zu Yahia, den die Ungläubigen Johannes den Täufer nennen, zu Abraham, einem großen Mann mit lockigem, schwarzem Haar und dem Aussehen eines Propheten, Friede über ihn, und zu Jesus, der ein kleinerer Mann mit braunem Haar und Sommersprossen war.
Die Propheten und der Erzengel Gabriel luden nun den Abgesandten Gottes ein, ein Getränk zu wählen, und als er die Auswahl zwischen Milch und Wein hatte, entschied er sich für Milch. Da sagte der Erzengel Gabriel, dass dies eine gute Wahl sei und hinfort alle Gläubigen dieser Wahl folgen sollten.
Dann führte der Erzengel Gabriel den Abgesandten Gottes zu dem Felsen, auf dem einmal Abraham seinen Sohn hatte opfern wollen, und an diesem Felsen lehnte eine Leiter, die durch die sieben Himmel zu Gott führte. Und Mohammed, der Friede sei mit ihm, stieg durch die sieben Himmel zu Gottes Thron und schaute auf dem Weg, wie der Engel Malik das Tor der Hölle öffnete, in der die Verlorenen, die Lippen gespalten wie bei den Kamelen, in unendlichen Qualen glühende Kohle essen müssen, die immer noch in Flammen steht, wenn sie hinten wieder herauskommt.
Doch als er in den Himmel hinaufstieg, schaute auch sein Abgesandter das Paradies mit blühenden Gärten, in denen frisches Wasser fließt oder solcher Wein, der den Sinn nicht verwirrt.
Als Mohammed nach seiner Himmelfahrt nach Mekka zurückkehrte, hatte er von Gott die Anweisung erhalten, den Menschen das Wort zu bringen, und damit begann die Niederschrift des Koran. Ein Menschenalter später fegten der neue Glaube und seine Krieger wie ein Sturmwind aus den Wüsten Arabiens heran, und ein neues Imperium entstand.
Der Nachfolger des Propheten, der omaijadische Kalif Abdelmalik ibn Marwan, ließ zwischen Anno Domini 685 und Anno Domini 691 zunächst eine Moschee beim fernsten Gebetsplatz – das ist die Bedeutung des Namens Al-Aqsa – und später dann eine über dem Felsen erbauen, auf dem Abraham seinen Sohn opfern wollte und Mohammed zum Himmel aufstieg, die Qubbet es-Sakhra, den Felsendom.
Im Jahr des Heils 1099 wurden die drittheiligste Stadt der Rechtgläubigen und ihr drittwichtigster Gebetsplatz von einer Katastrophe heimgesucht. Die Franken eroberten die Stadt und entweihten sie auf die fürchterlichste Art und Weise. Sie mordeten alles Lebende mit Schwert und Spieß, mit Ausnahme der Juden, die sie in der Synagoge verbrannten. Das Blut floss in den Straßen so reichlich, dass es zeitweilig bis über die Knöchel reichte. Nie wieder hat dieser von Kriegen heimgesuchte Teil der Welt ein derartiges Massaker gesehen.
Den Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee verwandelten die Franken in ihre eigenen Gebetstempel. Und nach kurzer Zeit überließ der christliche König von Jerusalem, Balduin II., die Al-Aqsa-Moschee den fürchterlichsten Feinden der Rechtgläubigen, den Templern, als Quartier und Stall.
Da schwor ein Mann den heiligen Eid, dass er El Quds, die heilige Stadt, zurückerobern würde, die die Ungläubigen Jerusalem nennen. In der christlichen Welt und in unserer Sprache ist dieser Mann unter dem Namen Saladin bekannt.
I
IM HEILIGEN TRAUERMONAT MOHARRAM, der im Jahre 575 nach Hijra, das die Ungläubigen Anno Domini 1177 nannten, in die heißeste Zeit des Sommers fiel, sandte Gott seine höchst merkwürdige Rettung demjenigen seiner Gläubigen, den er am meisten liebte.
Jussuf und sein Bruder Fahkr ritten um ihr Leben, und schräg hinter ihnen kam als Schutz vor den feindlichen Pfeilen der Emir Moussa. Die Verfolger, sechs an der Zahl, näherten sich stetig, und Jussuf verfluchte seinen Hochmut, der ihn hatte glauben lassen, dass so etwas nie eintreffen könnte, da er und seine Gefolgsleute die schnellsten Pferde hätten. Aber die Landschaft hier im Tal des Todes und der Dürre direkt westlich des Toten Meeres war ebenso ungastlich trocken wie steinig. Deswegen war es gefährlich, zu schnell zu reiten, doch es hatte den Anschein, als hätten die Verfolger damit überhaupt keine Mühe. Wäre einer von ihnen zu Fall gekommen, wäre das auch nicht so verhängnisvoll gewesen, als wäre dies einem der Verfolgten zugestoßen.
Jussuf entschied sich plötzlich, im rechten Winkel nach Westen auszuweichen, auf die Berge zu, wo er Schutz zu finden hoffte. Bald ritten die drei verfolgten Reiter ein Wadi steil bergauf. Doch das trockene Flussbett wurde schmaler und tiefer, sodass sie bald in einer tiefen Kluft dahinritten, als hätte sie Gott auf ihrer Flucht gefangen und würde sie nun in eine bestimmte Richtung führen. Jetzt gab es nur noch einen Weg, und dieser führte immer steiler hinauf und machte es den Reitern schwerer, das Tempo zu halten. Die Verfolger kamen immer näher und sie waren bald in Reichweite ihrer Pfeile. Die Verfolgten hatten sich bereits ihre runden, eisenbeschlagenen Schilde auf den Rücken geschnallt.
Jussuf war es nicht gewohnt, um sein Leben zu bitten. Aber jetzt, da er zwischen den verräterischen Felsblöcken auf dem Grund des Wadi immer langsamer reiten musste, kamen ihm einige Worte Gottes in den Sinn, die er atemlos und mit trockenen Lippen vor sich hin sprach: »Er, der Leben und Tod geschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen und euch durch eure Handlungen beweisen zu lassen, wer von euch der Beste ist. Er ist der Allmächtige. Der, der stets vergibt.«
Und in der Tat stellte Gott seinen geliebten Jussuf auf die Probe und zeigte ihm – erst als Erscheinung im Gegenlicht der untergehenden Sonne, dann mit fürchterlicher Klarheit – das Schrecklichste, was ein Rechtgläubiger in dieser schweren und bedrängten Lage sehen konnte.
Aus der Gegenrichtung kamen von oben im Wadi ein Templer mit gesenkter Lanze und hinter ihm sein Knappe. Diese beiden Feinde allen Lebens und alles dessen, was gut ist, ritten so schnell, dass ihre Umhänge wie große Drachenschwingen hinter ihnen herflatterten. Sie kamen wie die Dschinn der Wüste.
Jussuf brachte sein Pferd eilig zum Stehen und griff nach seinem Schild, den er jetzt vom Rücken nach vorne nehmen musste, um der Lanze des Ungläubigen zu begegnen. Er empfand keine Angst, sondern nur die kalte Erregung der Todesnähe, und er lenkte sein Pferd auf die steile Wand des Wadis zu, damit ihn die Lanze des Feindes nicht voll von vorn treffen, sondern ihn vielleicht nur streifen würde.
Doch da hob der Templer, der nur noch wenige Atemzüge entfernt war, seine gesenkte Lanze und gab Jussuf und den anderen Rechtgläubigen ein Zeichen, den Weg freizumachen. Das taten sie, und im nächsten Augenblick donnerten die zwei Templer vorbei und ließen dabei ihre Umhänge fallen, die flatternd in den Staub sanken.
Eilig gab Jussuf seinen Gefährten mit Handzeichen einen Befehl, und dann erklommen sie mit Mühe den letzten steilen Hang des Wadis, um zu einem Platz zu kommen, von dem aus sie alles überblicken konnten. Dort warf Jussuf sein Pferd herum und hielt an, denn er wollte erfahren, was Gott mit alldem im Sinn hatte.
Die beiden anderen wollten die Gelegenheit nutzen, um zu verschwinden. Templer und Räuber sollten die Sache unter sich ausmachen. Aber Jussuf wischte alle Einwände mit einer kurzen, verärgerten Handbewegung beiseite, denn er wollte sehen, was geschehen würde. Noch nie zuvor war er einem dieser Templer, diesen Dämonen des Bösen, so nahe gekommen und er hatte das eindeutige Gefühl, die Stimme Gottes rate ihm, die Ereignisse abzuwarten. Daran durfte ihn keine normale Klugheit hindern. Normale Klugheit hätte bedeutet, noch vor Sonnenuntergang in Richtung Al Arish weiterzureiten, bis sich schließlich die Dunkelheit wie eine schützende Decke über sie gelegt hätte. Was er jetzt sah, sollte er nie vergessen.
Die sechs Räuber hatten nicht viele Möglichkeiten, als sie bemerkten, dass sie sich nun, statt drei reiche Männer zu verfolgen, den Lanzen zweier Templer gegenübersahen. Das Wadi war viel zu schmal, um anzuhalten, zu wenden und den Rückzug anzutreten, ohne dass die Franken sie einholen würden. Nach kurzem Zögern taten sie das einzig Mögliche: sie formierten sich neu, sodass sie jetzt zu zweit nebeneinanderher ritten, und gaben ihren Pferden die Sporen.
Der weiß gekleidete Templer, der vor seinem Knappen herritt, leitete zunächst eine Scheinattacke gegen den rechten der beiden ersten Räuber ein, und als dieser sein Schild hob, um den fürchterlichen Stoß der Lanze abzuwehren, warf der Templer sein Pferd herum, was in diesem schwierigen Terrain vollkommen unmöglich erschien, und bohrte seine Lanze aus einem ganz neuen Winkel durch den Schild und Oberkörper des linken Räubers. Im selben Augenblick ließ er die Lanze fahren, um nicht selbst aus dem Sattel gerissen zu werden. Da war sein Knappe auch schon auf der Höhe des verblüfften rechten Räubers, der hinter seinen Schild geduckt auf einen Anfall wartete, der nicht kam, und daher aufblickte, worauf er aus einer gänzlich unerwarteten Richtung die Lanze des zweiten Feindes ins Gesicht bekam.
Der Weißgekleidete mit dem widerwärtigen roten Kreuz traf jetzt auf das zweite Räuberpaar, und zwar an einer Stelle, an der drei Pferde kaum aneinander vorbeikamen. Er hatte sein Schwert gezogen, und es schien zunächst, als wolle er von vorn angreifen, was weniger klug war, da er nur auf einer Seite eine Waffe trug. Aber plötzlich warf sich sein schöner Hengst, ein Schimmel in seinen kräftigsten Jahren, ganz herum und schlug nach hinten aus. Einer der Räuber wurde getroffen und aus dem Sattel geschleudert.
Der andere Räuber sah seine Chance gekommen, da er den Feind seitlich, fast von hinten, vor sich hatte. Außerdem hielt dieser das Schwert in der falschen Hand, was damit außer Reichweite war. Doch er bemerkte nicht, dass der Templer seinen Schild fallen gelassen und das Schwert in die Linke genommen hatte. Als der Räuber sich im Sattel vorbeugte, um mit dem Schwert zuzustoßen, waren sein Kopf und Hals ungeschützt dem Hieb ausgesetzt, der jetzt aus der falschen Richtung kam.
»Wenn der Kopf im Augenblick des Todes überhaupt einen Gedanken fassen kann, und sei es nur für einen Atemzug, dann ist soeben ein sehr erstaunter Kopf zu Boden gefallen«, meinte Fahkr verblüfft. Auch er folgte jetzt gebannt dem Schauspiel.
Die beiden letzten der sechs Räuber hatten die Zeit genutzt, um ihre Pferde zu wenden und flohen nun das Wadi entlang.
Unterdessen ritt der schwarz gekleidete Knappe auf den gottlosen Schuft zu, der vom Pferd des Templers aus dem Sattel geworfen worden war. Der Knappe setzte ab, nahm ruhig mit der einen Hand die Zügel des Pferdes und stieß dem taumelnden und sicher grün und blau geschlagenen Räuber sein Schwert an der Stelle in die Halsbeuge, wo der mit Stahlplatten besetzte Lederpanzer endete. Er machte keinerlei Anstalten, seinem Herrn zu folgen, der inzwischen die Verfolgung der beiden letzten Räuber aufgenommen hatte. Stattdessen band er die Zügel um die Vorderbeine des Pferdes, das er gerade eingefangen hatte, und ging dann vorsichtig hinter den beiden anderen reiterlosen Pferden her. Er redete beruhigend auf sie ein und schien sich um seinen Herrn nicht weiter zu kümmern, dem er doch hätte beistehen müssen, anstatt die Pferde der Feinde zusammenzutreiben. Wahrlich ein außerordentlicher Anblick.
»Derjenige, den Ihr dort seht, Herr«, sagte der Emir Moussa und deutete auf den weiß gekleideten Templer, der gerade weit unten im Wadi aus dem Blickfeld der drei Rechtgläubigen entschwand, »ist Al Ghouti.«
»Al Ghouti?«, sagte Jussuf fragend. »Ihr sagt das so, als müsste ich ihn kennen. Aber das tue ich nicht. Wer ist Al Ghouti?«
»Al Ghouti ist jemand, den Ihr kennen solltet, Herr«, antwortete Emir Moussa grimmig. »Er wurde uns von Gott für unsere Sünden geschickt. Er ist derjenige unter den Teufeln mit dem roten Kreuz, die manchmal zusammen mit den Turkopelen reiten und manchmal mit deren schweren Rittern. Er reitet, wie Ihr seht, einen Araberhengst wie ein Turkopel, aber trotzdem trägt er Lanze und Schwert, als säße er auf einem der langsamen und schweren Pferde der Franken. Außerdem ist er der Emir der Templer in Gaza.«
»Al Ghouti, Al Ghouti«, murmelte Jussuf nachdenklich. »Den will ich treffen. Wir warten hier!«
Die anderen beiden blickten ihn entsetzt an, sahen aber sofort ein, dass es keinen Sinn hatte, etwas einzuwenden.
Während die drei sarazenischen Reiter oben am Rand des Wadis warteten, sahen sie, wie der Knappe des Templers offenbar ganz unbekümmert die vier Pferde der Toten zusammentrieb. Dann lud er, obwohl er sehr kräftig zu sein schien, mit großer Mühe die Leichen der Räuber auf die Pferde und band sie fest, und zwar jeweils auf das Pferd, das ihnen einmal gehört hatte.
Von dem Templer und den Verfolgten, die eben noch die Verfolger gewesen waren, war nichts mehr zu sehen.
»Das ist klug«, murmelte Fahkr. »Er bindet die Toten auf ihren eigenen Pferden fest, damit sie trotz des Blutgeruchs nicht allzu unruhig werden. Er gedenkt offenbar die Pferde mitzunehmen.«
»Ja, das sind wirklich sehr gute Pferde«, pflichtete ihm Jussuf bei. »Ich verstehe nur nicht, wie diese Verbrecher zu Pferden kommen, wie sie eines Königs würdig sind. Ihre Pferde waren tatsächlich genauso schnell wie unsere.«
»Noch schlimmer. Sie kamen zum Schluss sogar näher«, wandte Emir Moussa ein, der nie zögerte, seinem Herrn seine aufrichtige Meinung zu sagen. »Aber haben wir jetzt nicht gesehen, was wir sehen wollten? Wäre es nicht das Klügste, in die Dämmerung zu reiten, ehe Al Ghouti zurückkommt?«
»Seid Ihr so sicher, dass er zurückkehrt?«, fragte Jussuf belustigt.
»Ja, Herr, er kommt zurück«, entgegnete Emir Moussa mürrisch. »Da bin ich mir ebenso sicher wie der Knappe da unten, der es nicht für nötig hält, seinen Herrn im Kampf gegen nur zwei Feinde zu unterstützen. Habt Ihr nicht gesehen, wie Al Ghouti sein Schwert in die Scheide gesteckt und den Bogen gespannt hat, ehe er da unten um die Biegung ritt?«
»Hatte er einen Bogen, obwohl er ein Templer ist?«, fragte Jussuf und zog erstaunt seine schmalen Augenbrauen hoch.
»Genau das, Herr«, antwortete Emir Moussa respektvoll. »Er ist, wie ich bereits gesagt habe, ein Turkopel, er reitet leicht und schießt aus dem Sattel wie ein Türke, aber mit einem längeren Bogen. Schon allzu viele Rechtgläubige sind seinen Pfeilen zum Opfer gefallen. Ich möchte mich aber trotzdem erdreisten, Herr, vorzuschlagen …«
»Nein!«, unterbrach ihn Jussuf. »Wir warten hier. Ich will ihn treffen. Es herrscht gerade Waffenstillstand mit den Templern, und ich will ihm danken. Es kommt nicht infrage, dass ich in Dankesschuld zu einem Templer stehe!«
Die anderen beiden sahen ein, dass es keinen Sinn hatte, weiter über diese Sache zu streiten. Es war ihnen jedoch nicht wohl in ihrer Haut. Das Gespräch verstummte.
Schweigend saßen sie eine Weile lang da, vorgebeugt und eine Hand auf den Sattelknauf gestützt. Sie betrachteten den Knappen, der damit begonnen hatte, die Waffen und die beiden Umhänge aufzusammeln, die er und sein Herr vor dem Angriff abgeworfen hatten. Nach einer Weile fiel ihm der abgeschlagene Kopf des einen Räubers in die Hände, und er überlegte, wie er ihn wohl im Gepäck verstauen könnte. Zum Schluss zog er einem der Toten seinen Abay aus, wickelte den Kopf darin ein, verschnürte ihn und hängte das Paket dann am Sattelknauf neben der Leiche auf, der der Kopf fehlte.
Zum Schluss war der Knappe mit allem fertig und überprüfte, ob alle Lasten ordentlich verstaut waren. Er stieg auf sein Pferd und ritt, die zusammengebundenen Pferde hinter sich, an den drei Sarazenen vorbei.
Jussuf grüßte den Knappen höflich auf Fränkisch und machte eine weite Armbewegung. Unsicher lächelte ihn der Knappe an, und sie hörten nicht, was er antwortete.
Es begann zu dämmern, und die Sonne ging bereits hinter den hohen Bergen im Westen unter. Das Salzmeer weit unten in der Ferne funkelte nicht mehr blau. Als würden die Pferde die Ungeduld ihrer Herren spüren, warfen sie gelegentlich die Köpfe nach hinten und schnaubten, als wollten sie sich auf den Weg machen, ehe es zu spät wurde.
Da sahen sie unten im Wadi den weiß gekleideten Templer kommen. Hinter sich führte er zwei Pferde, über deren Sätteln zwei Tote hingen. Er hatte keine Eile und ritt mit gesenktem Kopf, als sei er ins Gebet vertieft, obwohl er wahrscheinlich nur den steinigen und unebenen Boden betrachtete, um einen brauchbaren Weg zu finden. Als hätte er die drei wartenden Reiter nicht gesehen, wiewohl sie sich aus seiner Richtung gegen den hellen Teil des Abendhimmels als Silhouetten abzeichnen mussten.
Als er herangekommen war, blickte er auf und zügelte, ohne etwas zu sagen, sein Pferd.
Jussuf verlor vollkommen den Faden. Er verstummte, weil das, was er jetzt sah, nicht zu dem zu passen schien, was er eben mitverfolgt hatte. Derjenige der beiden Teufelsdämonen, der offenbar Al Ghouti genannt wurde, strahlte Frieden aus. Er trug seinen Helm an einer Kette über der Schulter, und sein kurzes helles Haar und sein üppiger, wild wuchernder Bart in derselben Farbe zeigten wahrlich nicht das Antlitz eines Dämons mit Augen, die so blau waren, wie man erwarten konnte. Er hatte einen Mann vor sich, der gerade drei oder vier andere Männer erschlagen hatte. Jussuf konnte sich vor lauter Aufregung nicht daran erinnern, wie viele es gewesen waren, obwohl er normalerweise alles im Kopf behielt, was während eines Kampfes geschah. Viele Männer hatte Jussuf im Augenblick nach einem Sieg gesehen, nachdem sie getötet und den Gegner bezwungen hatten. Allerdings hatte er noch nie jemanden vor sich gehabt, der dabei wirkte, als kehre er einfach von der Arbeit des Tages zurück, als hätte er Weizen gemäht oder Zuckerrohr im Sumpf geerntet und hätte das gute Gewissen, das nur ein gutes Tagewerk geben kann. Die blauen Augen waren nicht die Augen eines Dämons.
»Wir haben Euch erwartet … wir sagen Euch Dank …«, sagte Jussuf in einer Art Fränkisch, von der er hoffte, dass sie der andere verstehen würde.
Der Mann, der in der Sprache der Rechtgläubigen Al Ghouti genannt wurde, sah Jussuf forschend an. Auf seinen Zügen breitete sich ein Lächeln aus, als hätte er in seinem Gedächtnis gesucht und das Gesuchte gefunden. Emir Moussa und Fahkr, aber nicht Jussuf senkten vorsichtig und fast unbewusst ihre Hände zu den Waffen, die seitlich am Sattel hingen. Der Templer bemerkte diese Hände, die einen eigenen Willen zu haben schienen, hob seinen Blick zu den dreien am Abhang, sah Jussuf direkt in die Augen und antwortete in dessen Sprache:
»Im Namen Gottes, des Barmherzigen, in dieser Stunde sind wir keine Feinde. Ich suche mit Euch keinen Kampf. Denkt an die Worte Eurer Schrift, die Worte, die der Prophet, Friede seiner Seele, selbst ausgesprochen hat: ›Nimm das Leben eines anderen nicht – Gott hat es für heilig erklärt -, wenn du nicht einen gerechten Grund hast.‹ Ihr und ich, wir haben keinen gerechten Grund, denn es herrscht Waffenruhe zwischen uns.«
Der Templer lächelte sie noch breiter an, als wolle er sie in Gelächter versetzen. Er war sich sehr bewusst, welchen Eindruck es auf seine drei Feinde gemacht haben musste, dass er in der heiligen Sprache des Korans zu ihnen gesprochen hatte. Jussuf, der auf einmal das Gefühl hatte, blitzschnell nachdenken und entscheiden zu müssen, antwortete dem Templer nach nur kurzem Zögern:
»Die Wege Gottes, des Allmächtigen, sind wahrhaftig unerforschlich«, was der Templer mit einem Nicken beantwortete, als seien ihm diese Worte wohlbekannt, »und nur er kann wissen, warum er uns einen Feind zu unserer Rettung geschickt hat. Aber ich bin Euch, Ritter vom roten Kreuz, Dank schuldig und will Euch an dem, was diese Verfluchten begehrten und nicht bekamen, teilhaben lassen. Ich will Euch hundert Dinare in Gold geben, und die gebühren Euch mit Recht für das, was Ihr vor unseren Augen ausgerichtet habt!«
Jussuf fand, dass er jetzt wie ein König gesprochen hatte und noch dazu wie ein überaus großzügiger, wie es Königen eben geziemt. Aber zu seinem großen Verdruss und zum noch größeren Verdruss seines Bruders und des Emirs Moussa antwortete der Templer zunächst nur mit einem Lachen, das allerdings vollkommen ehrlich und ohne Spott war.
»Im Namen Gottes, des Barmherzigen, Ihr sprecht zu mir voller Güte, aber auch in Unkenntnis«, erwiderte der Templer dann. »Ich kann von Euch nichts annehmen. Was ich getan habe, musste ich tun, wärt Ihr nun hier gewesen oder nicht. Ich habe keinen Besitz und darf auch keinen annehmen. Etwas anderes wäre es, und damit wäre mein Gelübde umgangen, wenn Ihr die hundert Dinare den Templern schenken würdet. Und mit Verlaub, mein unbekannter Feind oder Freund, dieses Geschenk könntet Ihr nur schlecht vor Eurem Propheten rechtfertigen!«
Mit diesen Worten griff der Templer wieder die Zügel, schaute nach hinten auf die beiden Pferde mit den Leichen, trieb seinen Araberhengst an und hob gleichzeitig die rechte Faust zum Gruß der gottlosen Templer. Die Situation schien ihn sehr zu belustigen.
»Wartet!«, rief Jussuf eilig und ehe er noch überlegen konnte. »Da lade ich Euch und Euren Knappen stattdessen zum Abendessen ein!«
Der Templer brachte sein Pferd wieder zum Stehen und sah Jussuf mit einem Blick an, als müsse er nachdenken.
»Ich nehme Euer Angebot an, mein unbekannter Feind oder Freund«, erwiderte der Templer langsam, »aber nur unter der Bedingung, dass Ihr mir Euer Wort gebt, dass keiner von euch dreien die Absicht hat, gegen mich oder meinen Knappen die Waffe zu erheben, solange wir beisammen sind.«
»Beim wahren Gott und seinem Propheten habt Ihr mein Wort«, antwortete Jussuf schnell. »Habe ich auch Eures?«
»Ja, Ihr habt mein Wort bei dem einen wahren Gott, seinem Sohn und der Heiligen Jungfrau«, antwortete der Templer ebenso schnell. »Wenn ihr zwei Finger südlich von dem Punkt reitet, an dem die Sonne hinter den Bergen untergegangen ist, kommt ihr zu einem Bach. Folgt diesem in nordwestlicher Richtung, dann kommt ihr zu einigen niedrigen Bäumen, bei denen es Wasser gibt. Bleibt dort die Nacht über. Wir lagern weiter im Westen, etwas weiter den Berg hinauf am selben Bach. Jetzt ist bald Abend und die Stunde für euer Gebet und für unseres. Wenn wir danach im Dunkeln zu euch kommen, so tun wir das lautstark, sodass ihr uns hören könnt, und nicht leise wie Menschen, die Böses im Schilde führen.«
Der Templer gab seinem Pferd die Sporen, salutierte erneut zum Abschied, brachte seine kleine Karawane in Bewegung und ritt in die Dämmerung, ohne sich umzusehen.
Die drei Rechtgläubigen blickten ihm lange nach, ohne dass sich einer von ihnen bewegt oder etwas gesagt hätte. Ihre Pferde schnaubten ungeduldig, aber Jussuf war tief in Gedanken versunken.
»Du bist mein Bruder, und nichts, was du tust oder sagst, sollte mich nach all den Jahren noch in Erstaunen versetzen«, meinte Fahkr, »aber das, was du soeben getan hast, hat mich doch sehr verblüfft. Ein Templer! Und ausgerechnet der, den sie Al Ghouti nennen!«
»Fahkr, mein geliebter Bruder«, antwortete Jussuf, während er mit einer leichten Bewegung sein Pferd wendete, um den Weg einzuschlagen, der ihm von seinem Feind gewiesen worden war, »man muss seinen Feind kennen, darüber haben wir doch oft genug gesprochen? Und wen sollte man wohl kennenlernen, wenn nicht den gefürchtetsten unter ihnen? Gott hat uns eine glänzende Gelegenheit geschenkt, und wir sollten diese Gabe nicht zurückweisen.«
»Aber kann man den Worten eines solchen Mannes trauen?«, wandte Fahkr ein, nachdem sie eine Weile schweigend geritten waren.
»Ja, das kann man in der Tat«, murmelte Emir Moussa. »Der Feind hat viele Gesichter, bekannte und unbekannte. Aber auf das Wort dieses Mannes können wir uns genauso verlassen wie er sich auf das Eures Bruders.«
Sie ritten nach den Anweisungen ihres Feindes und kamen bald zu einem kleinen Bach mit frischem, kaltem Wasser, wo sie ihre Pferde trinken ließen. Dann folgten sie dem Bach und gelangten, genau wie der Templer gesagt hatte, zu einer Senke, in der der Bach sich zu einem kleinen Teich erweiterte. In der Senke wuchsen einige niedrige Bäume und Büsche, und es gab eine dürftige Weide für die Pferde. Sie sattelten ab, kümmerten sich um ihr Gepäck und banden den Pferden die Vorderbeine zusammen, damit diese in der Nähe des Baches blieben und nicht weiter entfernt Futter suchten, wo es ohnehin keines gab. Anschließend wuschen sie sich sorgfältig, wie es vor dem Gebet vorgeschrieben war.
Als sich die erste bleiche Mondsichel am hellen Himmel der Sommernacht zeigte, sprachen sie die Gebete für ihre Toten und dankten Gott, dass er ihnen in seiner unerforschlichen Güte ihren schlimmsten Feind geschickt hatte, um sie zu retten.
Nach dem Gebet unterhielten sie sich noch etwas über diese Sache, und Jussuf meinte, dass Gott damit auf eine fast scherzhafte Weise seine Allmacht bewiesen habe: Nichts sei ihm unmöglich, nicht einmal, einen Templer zu schicken, um gerade die zu retten, die schließlich einmal alle Templer besiegen würden.
Dass die Rechtgläubigen eines Tages siegen würden, war etwas, was Jussuf sich und allen anderen einreden wollte. Die Franken begaben sich in die Heilige Stadt, manchmal zahlreich wie die Heuschrecken, manchmal in kleineren Gruppen. Jedes Jahr kamen neue Krieger aus den Ländern der Franken, die plünderten und siegten oder unterlagen und starben, und wenn sie siegten, dann kehrten sie bald mit ihrer schweren Beute in die Heimat zurück.
Einige Franken fuhren allerdings nie nach Hause. Das waren die besten und gleichzeitig die schlimmsten – die besten, weil sie nicht zum Zeitvertreib alles verwüsteten und weil man mit ihnen reden, Verträge und Frieden schließen und Handel treiben konnte, zugleich aber die schlimmsten, weil einige von ihnen im Krieg fürchterliche Gegner waren. Und am schlimmsten von ihnen allen waren die beiden irrgläubigen Orden kämpfender Mönche, der Templerorden und der Johanniterorden. Wer das Land von den Feinden befreien und die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom in Gottes Heiliger Stadt zurückerobern wollte, musste sowohl die Templer als auch die Johanniter besiegen.
Gerade diese Irrgläubigen schienen unbesiegbar zu sein. Sie kämpften furchtlos und überzeugt davon, ins Paradies zu kommen, wenn sie im Kampf fielen. Sie ergaben sich nie, weil ihre Ordensregeln einen Freikauf gefangen genommener Ordensbrüder verboten. Ein gefangener Johanniter oder Templer war also wertlos, und deshalb konnte man ihn ebenso gut töten.
Wenn fünfzehn Rechtgläubige in einer Ebene auf fünf Templer stießen, überlebten erfahrungsgemäß entweder alle oder keiner. Wenn die fünfzehn Rechtgläubigen die fünf Ungläubigen angriffen, kam kein Rechtgläubiger mit dem Leben davon. Um einen solchen Angriff sicher zu überstehen, musste man die vierfache Übermacht haben und trotzdem bereit sein, große Verluste hinzunehmen. Normale Franken dagegen ließen sich durchaus besiegen, selbst wenn die Rechtgläubigen in der Minderzahl waren.
Während Fahkr und Emir Moussa Reisig für ein Feuer sammelten, lag Jussuf mit unter dem Kopf verschränkten Armen da und starrte in den Himmel. Langsam schienen immer mehr Sterne auf. Er grübelte über seine schlimmsten Feinde und dachte daran, was er vor Sonnenuntergang gesehen hatte. Der Mann, der sich Al Ghouti nannte, besaß ein Pferd, das eines Königs würdig war, ein Pferd, das immer dasselbe zu denken schien wie sein Herr, das gehorchte, ehe es noch einen Befehl bekommen hatte.
Das war keine Zauberei. Solche Erklärungen wies Jussuf, soweit es ging, zurück. Es war ganz einfach so, dass dieser Mann und sein Pferd viele Jahre zusammen gekämpft und ernsthaft, nicht nur zum Zeitvertreib, geübt hatten. Unter den Mamelucken gab es ähnliche Männer und Pferde, und die Mamelucken taten nichts anderes als zu üben, bis sie erfolgreich genug waren, um nach einem mehrjährigen, erfolgreichen Kriegsdienst als Lohn Land, ihre Freiheit und Gold zu erhalten. Das war weder ein Wunder noch Magie, das war eine Leistung des Menschen und nicht nur Gottes, der solche Menschen schuf. Die Frage war nur, was nötig war, um dieses Ziel zu erreichen.
Jussufs Antwort auf diese Frage lautete immer, dass der reine Glaube das Entscheidende war. Wer voll und ganz den Worten des Propheten über den Dschihad, den Heiligen Krieg, folgte, würde auch ein unüberwindbarer Krieger werden. Das Problem war jedoch, dass unter den Mamelucken in Ägypten kaum die gläubigsten Mohammedaner zu finden waren. Normalerweise waren diese Türken mehr oder minder abergläubisch, glaubten an Geister und heilige Steine und bekannten sich nur mit den Lippen zum reinen und wahren Glauben.
Schlimmer war noch, dass auch die Ungläubigen Männer wie Al Ghouti hervorbringen konnten. Gott wollte wohl damit zeigen, dass der Mensch mit seinem freien Willen das Ziel seines Erdenlebens bestimmte und dass erst das heilige Feuer die Spreu vom Weizen trennen und zeigen würde, wer rechtgläubig und wer ungläubig war.
Ein niederschmetternder Gedanke. Denn wenn es Gottes Absicht war, die Rechtgläubigen, wenn sie sich im Dschihad gegen die Ungläubigen vereinigten, mit dem Sieg zu belohnen, warum hatte er dann Feinde geschaffen, die sich unmöglich im Kampf Mann gegen Mann besiegen ließen? Möglicherweise, um den Rechtgläubigen zu zeigen, dass sie sich wirklich gegen den Feind verbünden und alle inneren Zwistigkeiten beilegen mussten, da sie insgesamt zehn- oder hundertmal so viele waren wie die Franken, die dann in jedem Fall zum Untergang verurteilt wären, ob sie nun alle Templer waren oder nicht.
Jussuf rief sich erneut Al Ghouti in Erinnerung, seinen Hengst, sein schwarzes, gut gefettetes und vollkommen unbeschädigtes Zaumzeug und seine Ausrüstung, an der nichts nur der Zierde diente, sondern alles nützlich war. Daraus konnte man etwas lernen. Denn sicher waren viele auf dem Schlachtfeld gefallen, weil sie es nicht lassen konnten, neuen, steifen und goldglänzenden Brokat über der Rüstung zu tragen, sodass sie sich im entscheidenden Augenblick nicht angemessen bewegen konnten. So starben viele allein an ihrer Eitelkeit. An alles, was man sah, musste man sich erinnern, aus allem musste man lernen. Wie war der teuflische Feind sonst zu besiegen, der Gottes heilige Stadt besetzt hielt?
Das Feuer knisterte bereits, und Fahkr und Emir Moussa hatten ein Musselintuch ausgebreitet, Trinkgefäße mit Wasser darauf gestellt und ihren Proviant ausgepackt. Emir Moussa saß in der Hocke und mahlte Mokkabohnen, um zu gegebener Zeit seinen schwarzen Beduinentrank genießen zu können. Nach Einbruch der Dunkelheit kam die Kühle, erst als angenehme Brise, die von den Hängen Al Khalils, der Stadt Abrahams, herabkam. Doch schon bald würde diese angenehme Kühle nach dem heißen Tag in Kälte übergehen.
Da der Wind von Westen kam, witterte Jussuf die beiden Franken im selben Augenblick, in dem er sie im Dunkeln hörte. Ein Geruch von Sklaven und Schlachtfeld. Als richtige Barbaren kamen sie zweifellos ungewaschen zum Abendessen.
Als der Templer in den Lichtschein des Feuers trat, sahen die Rechtgläubigen, dass er seinen weißen Schild mit dem roten Kreuz vor sich hielt. So sollte sich ein Gast nicht nähern, und Emir Moussa machte ein paar zögernde Schritte auf seinen Sattel zu, neben dem er seine Waffen und sein Zaumzeug liegen hatte. Aber Jussuf fing rasch seinen unruhigen Blick auf und schüttelte unmerklich den Kopf.
Der Templer verbeugte sich nacheinander vor seinen drei Gastgebern, und sein Knappe machte es ihm unbeholfen nach. Dann überraschte er die drei Rechtgläubigen, indem er seinen weißen Schild mit dem verhassten Kreuz emporhob und ihn, so hoch es ging, in einen der niedrigen Bäume hängte. Anschließend trat er vor und nahm sein Schwert ab, um den ihm von Jussuf angewiesenen Platz einzunehmen. Er erklärte, dass es, soweit er wisse, keine Männer mehr in der Gegend gäbe, die Böses im Schilde führten, aber man könne sich dessen nie sicher sein. Der Schild eines Templers hätte sicher eine beruhigende und abkühlende Wirkung auf jede Art von Streitlust. Außerdem bot er großzügig an, den Schild über Nacht hängen zu lassen und ihn erst bei Morgengrauen abzuholen, wenn es für alle Zeit sei weiterzuziehen.
Als der Templer und sein Knappe sich an das Tuch setzten und ihr eigenes Bündel mit Datteln, Hammelfleisch, Brot und einigen unreinen Nahrungsmitteln auspackten, konnte Jussuf das Lachen nicht mehr zurückhalten, das er so lange unterdrückt hatte. Die anderen sahen verwundert zu ihm auf, da sie an der Situation nichts Komisches entdecken konnten. Die beiden Templer runzelten die Stirn, da sie den Verdacht haben mussten, Jussuf lache über sie.
Er musste daher sein Verhalten erklären und sagte, wenn es etwas auf dieser Welt gäbe, womit er nie gerechnet habe, dann sei es, eine Nacht unter dem Schild seines schlimmsten Feindes zu verbringen. Obwohl es andererseits auch bestätige, was er immer geglaubt habe, dass Gott in seiner Allmacht durchaus mit seinen Kindern scherzen könne. Und darüber mussten sie alle lachen.
In diesem Augenblick entdeckte der Templer unter den Dingen, die sein Knappe ausgepackt hatte, ein Stück geräuchertes Fleisch, sagte unfreundlich etwas auf Fränkisch und deutete mit seinem langen, scharfen Dolch darauf. Der Knappe errötete und nahm das Fleischstück wieder weg. Der Templer entschuldigte sich mit einem Schulterzucken. Was für die einen als unreines Fleisch gelte, sei für andere eine Delikatesse.
Die drei Rechtgläubigen begriffen erst jetzt, dass ein Stück Schweinefleisch inmitten ihres Essens gelegen hatte und damit das ganze Mahl verunreinigt war. Jussuf erinnerte sie jedoch eilig und flüsternd daran, dass diese Regel nicht für Menschen gelte, die sich in Not befänden, und damit waren alle zufrieden.
Jussuf segnete das Essen im Namen Gottes, des Erbarmers und Gnadenreichen, und der Templer im Namen Jesu Christi und der Gottesmutter, und keiner der fünf Männer ließ sich seinen Abscheu vor dem Glauben der anderen anmerken.
Sie begannen, sich gegenseitig zum Essen zu ermuntern, und schließlich nahm der Templer auf Jussufs Geheiß ein Stück in Brot eingebackenes Hammelfleisch, schnitt es mit seinem grauen, schmucklosen und, wie man sehen konnte, unerquicklich scharfen Dolch in zwei Stücke und reichte das eine mit der Dolchspitze seinem Knappen, der es mit beherrschtem Zögern in den Mund steckte.
Sie aßen eine Weile lang schweigend. Die Rechtgläubigen hatten auf ihrer Seite des Musselintuchs das in Brot eingebackene Hammelfleisch sowie grüne, gehackte Pistazien in gesponnenem Zucker und Honig serviert. Die Ungläubigen hatten getrocknetes Hammelfleisch, Datteln und trockenes Weißbrot auf ihrer Seite.
»Es gibt eine Sache, die ich Euch gerne fragen würde, Templer«, sagte Jussuf nach einer Weile. Er sprach leise und durchdringend, wie immer, wenn er lange nachgedacht hatte und auf etwas Wichtiges hinaus wollte.
»Ihr seid unser Gastgeber, und wir haben Eure Einladung angenommen und wollen gerne auf Eure Fragen antworten, aber denkt daran, dass unser Glaube der wahre ist und nicht der Eure«, antwortete der Templer mit einer Miene, als würde er sich erdreisten, selbst über den Glauben zu scherzen.
»Ihr versteht sicher, wie ich über diese Sache denke, Templer, aber jetzt zu meiner Frage. Ihr habt uns, Eure Feinde, gerettet, und ich habe Euch gedankt. Aber jetzt will ich wissen, warum Ihr das getan habt.«
»Wir haben nicht unsere Feinde gerettet«, sagte der Templer nachdenklich. »Wir haben diese sechs Räuber schon lange gesucht, eine Woche lang sind wir ihnen auf Abstand gefolgt und haben auf den richtigen Augenblick gewartet. Unsere Aufgabe war, sie zu töten, und nicht, euch zu retten. Aber Gott hat zufällig gleichzeitig seine schützende Hand über euch gehalten, und weder Ihr noch ich wissen, warum.«
»Aber Ihr seid doch der berühmte Al Ghouti«, beharrte Jussuf.
»Ja, das ist wahr«, sagte der Templer. »Ich bin der, den die Ungläubigen in der Sprache, die wir jetzt sprechen, Al Ghouti nennen, aber mein voller Name lautet Arn de Gothia, und mein Auftrag war, die Erde von diesen sechs Unwürdigen zu befreien. Ich habe meinen Auftrag ausgeführt, das ist alles.«
»Aber was bringt Euch dazu? Seid Ihr nicht sogar Emir der Templer auf Eurer Burg in Gaza, also ein Mann von Rang? Warum solltet Ihr Euch mit einer so geringen Aufgabe befassen, die überdies gefährlich ist, und in dieser ungastlichen Gegend im Hinterhalt liegen, nur um Räuber zu töten?«
»Genau aus diesem Grund wurde unser Orden gegründet, lange ehe ich geboren wurde«, antwortete der Templer. »Am Anfang, als die Unseren das Grab Gottes befreit hatten, waren unsere Pilger ohne Schutz, wenn sie eine Wallfahrt zum Jordan an den Ort machen wollten, an dem Yahia, wie Ihr ihn nennt, einst den Herrn Jesus Christus getauft hat. Zu dieser Zeit trugen alle Pilger ihre Habseligkeiten bei sich, statt sie, wie jetzt, sicher bei uns in Verwahrung zu geben. Sie waren für Räuber eine leichte Beute, und zu ihrem Schutz entstand unser Orden. Noch heute ist es ein ehrenvoller Auftrag, die Pilger zu schützen und die Räuber zu töten. Es handelt sich also nicht, wie Ihr glaubt, um einen geringen Auftrag, den wir irgendwem anvertrauen würden, sondern ganz im Gegenteil um die Essenz und den Ursprung unseres Ordens. Und Gott hat unsere Gebete erhört.«
»Ihr habt recht«, stellte Jussuf mit einem Seufzer fest. »Wir sollten die Pilger immer beschützen. Wäre das Leben hier in Palästina nicht viel einfacher, wenn alle das täten? Wo im Frankenreich liegt im Übrigen dieses Gothia?«
»Genau genommen liegt das gar nicht im Frankenreich«, antwortete der Templer mit einem amüsierten Augenzwinkern, als sei all seine Feierlichkeit plötzlich wie weggeblasen. »Gothia liegt weit nördlich des Frankenreichs, am Ende der Welt. Gothia ist ein Land, in dem man fast das halbe Jahr auf dem Wasser gehen kann, weil die große Kälte das Wasser hart macht. Aber aus welchem Land kommt Ihr selbst? Euer Arabisch klingt nicht so, als kämt Ihr direkt aus Mekka.«
»Ich kam in Baalbek zur Welt, aber wir sind alle drei Kurden«, antwortete Jussuf verblüfft. »Das hier ist mein Bruder Fahkr und das … mein Freund Moussa. Wie und warum habt Ihr die Sprache der Gläubigen gelernt, Ihr seid doch sicher nicht in langer Gefangenschaft gewesen?«
»Nein, das ist wahr«, antwortete der Templer. »Meinesgleichen gerät nicht in Gefangenschaft, und Ihr wisst sicher, warum. Aber ich habe zehn Jahre lang in Palästina gelebt und bin nicht hier, um zu stehlen und in einem halben Jahr wieder nach Hause zu fahren. Außerdem sprechen die meisten, die für die Templer arbeiten, Arabisch. Mein Knappe heißt übrigens Armand de Gascogne, er ist noch nicht lange hier und versteht nicht viel von dem, was wir sagen. Deswegen ist er auch so still, anders als Eure Gefährten, die sich nicht äußern dürfen, ehe Ihr es ihnen gestattet habt.«
»Ihr habt ein scharfes Auge«, murmelte Jussuf und errötete leicht. »Ich bin der Älteste, und Ihr könnt schon die grauen Haare in meinem Bart sehen. Ich verwalte das Geld der Familie. Wir sind Kaufleute auf dem Weg zu einem wichtigen Geschäft in Kairo und … Ich weiß im Übrigen nicht, was mein Bruder und mein Freund einen Ritter der Feinde fragen sollten. Wir sind alle friedliebende Leute.«
Der Templer sah Jussuf forschend an und erwiderte eine Weile lang nichts. Er gewann dadurch etwas Zeit, dass er von den Mandeln in Honig aß, unterbrach sich dann, hielt ein Stück der Delikatesse in den Lichtschein des Feuers und meinte, die Backware stamme wohl aus Aleppo. Dann zog er seinen Weinschlauch heran und trank, ohne zu fragen oder um Entschuldigung zu bitten, und reichte ihn dann an seinen Knappen weiter. Anschließend lehnte er sich bequem zurück, zog seinen dicken, weißen Umhang mit dem schreckenerregenden roten Kreuz enger um sich und betrachtete Jussuf, als würde er einen Gegner bei einem Brettspiel betrachten und nicht einen Feind.
»Mein unbekannter Freund oder Feind, was nützt es einem von uns, die Unwahrheit zu sagen, während wir hier friedlich beisammensitzen und uns das Wort gegeben haben, einander nichts zu tun?«, meinte er endlich. Er sprach sehr ruhig und ohne jeden Groll. »Ihr seid Krieger wie ich. Wenn Gott will, dann begegnen wir uns das nächste Mal auf dem Schlachtfeld. Eure Kleider geben eure Identität preis und auch eure Pferde, das Zaumzeug und die Schwerter, die da drüben gegen die Sättel gelehnt stehen. Sie sind in Damaskus geschmiedet, und jedes einzelne hat mindestens fünfhundert Dinare in Gold gekostet. Der Frieden ist bald vorüber, der Waffenstillstand nähert sich seinem Ende, und wenn ihr es bis jetzt noch nicht wusstet, so erfahrt ihr es jetzt. Wir sollten deswegen diesen bemerkenswerten Augenblick genießen, denn man hat nicht oft Gelegenheit, seinen Feind kennenzulernen. Aber wir sollten uns nicht belügen.«
Jussuf überkam die fast unwiderstehliche Versuchung, dem Templer ehrlich zu sagen, wer er war. Aber es stimmte, dass die Waffenruhe jetzt bald vorüber sein würde, auch wenn das bisher noch nicht zu spüren gewesen war. Und das Ehrenwort, nicht aufeinander loszugehen, der Grund dafür, dass sie beisammensitzen und essen konnten, galt nur an diesem Abend. Sie waren beide wie Lämmer, die mit Löwen speisten.
»Ihr habt recht, Templer«, sagte er schließlich. »Inschallah, wenn Gott will, begegnen wir uns das nächste Mal auf dem Schlachtfeld. Aber ich bin ebenfalls Eurer Meinung, dass man seine Feinde kennenlernen sollte, und Ihr scheint wirklich mehr Rechtgläubige zu kennen als wir drei Ungläubige. Ich werde den Meinen nun erlauben, das Wort an Euch zu richten.«
Jussuf lehnte sich zurück und zog nun ebenfalls seinen Umhang enger um die Schultern. Er gab seinem Bruder und seinem Emir ein Zeichen, dass es ihnen erlaubt sei zu sprechen. Aber beide zögerten. Sie waren darauf eingestellt gewesen, den ganzen Abend nur zuzuhören. Da keiner der Rechtgläubigen etwas sagte, beugte sich der Templer zu seinem Knappen und führte ein kurzes, geflüstertes Gespräch auf Fränkisch.
»Meinem Knappen ist etwas aufgefallen«, erklärte er dann. »Eure Waffen, Pferde und Kleider sind allein mehr wert als alles, wovon diese unglücklichen Räuber jemals träumen konnten. Wie kommt es, dass ihr diesen gefährlichen Weg westlich des Toten Meers ohne ausreichende Eskorte eingeschlagen habt?«
»Weil es der schnellste Weg ist und weil eine Eskorte zu große Aufmerksamkeit erregt …«, antwortete Jussuf zögernd. Er wollte sich nicht erneut dadurch in Verlegenheit bringen, dass er die Unwahrheit sagte, und musste sich deswegen die Worte genau überlegen. Seine Eskorte hätte ganz sicher Aufmerksamkeit erregt, da sie aus mindestens dreitausend Reitern bestanden hätte, um als sicher zu gelten.
»Wir haben uns auf unsere Pferde verlassen und nicht geglaubt, dass uns irgendwelche elenden Räuber oder Franken einholen«, fügte er eilig hinzu.
»Klug und doch nicht klug«, meinte der Templer und nickte. »Aber diese sechs Räuber haben jetzt ein gutes halbes Jahr in dieser Gegend ihr Unwesen getrieben, sie kannten die Gegend in- und auswendig und konnten auf gewissen Strecken schneller reiten als alle anderen. Das hat sie reich gemacht. Bis Gott sie bestraft hat.«
»Ich würde gerne eine Sache wissen«, sagte Fahkr, der sich jetzt zum ersten Mal äußerte und sich räuspern musste, um nicht über seine eigenen Worte zu stolpern. »Es heißt, dass ihr Templer, die ihr euch in der Al-Aqsa-Moschee aufhaltet, dort auch einen Minbar habt, einen Ort des Gebets für die Rechtgläubigen. Und man hat mir auch gesagt, dass ihr Templer einmal einen Franken bestraft habt, der einen Rechtgläubigen am Gebet gehindert hat. Ist das wahr?«
Die Rechtgläubigen blickten ihren Feind aufmerksam an und schienen alle gleichermaßen interessiert an der Antwort. Der Templer lächelte und übersetzte erst einmal seinem Knappen die Frage ins Fränkische. Dieser nickte und musste sofort lachen.
»Ja, das ist wahr«, antwortete der Templer, nachdem er eine Weile nachgedacht oder zumindest so getan hatte, um das Interesse seiner Zuhörer zu steigern. »Wir haben einen Minbar im Templum Salomonis, den ihr die Al-Aqsa-Moschee nennt. Wie auch immer, die Sache ist nicht sonderlich bemerkenswert. In unserer Burg in Gaza halten wir jeden Donnerstag einen Majlis, am einzigen Tag, an dem das möglich ist, und da dürfen die Zeugen auf die Heilige Schrift Gottes schwören, auf die Thorarollen, auf den Koran oder in gewissen Fällen auf etwas anderes, was ihnen heilig ist. Wenn ihr wirklich drei ägyptische Kaufleute gewesen wärt, wie ihr das vorgegeben habt, dann hättet ihr auch gewusst, dass unser Orden viele große Geschäfte mit den Ägyptern macht, und von denen teilt ja wohl niemand unseren Glauben. In der Al-Aqsa-Moschee, wenn wir nun diese Bezeichnung gebrauchen wollen, haben wir Templer unser Hauptquartier und deswegen viele Gäste, die wie Gäste behandelt sein wollen. Das Problem besteht darin, dass jedes Jahr im September Schiffe aus Pisa oder Genua oder aus den südlichen Ländern des Frankenreichs kommen. Die neuen Männer sind vom Geist erfüllt und übereifrig – sie sind vielleicht nicht gerade erpicht darauf, sofort ins Paradies einzugehen, aber wenigstens darauf, die Ungläubigen zu töten oder zumindest Hand an sie zu legen. Diese Neuankömmlinge bereiten uns große Mühe. Jedes Jahr im September gibt es wilde Szenen in unserem Viertel, weil diese Männer Leute eures Glaubens misshandeln, und da müssen wir natürlich hart durchgreifen.«
»Ihr tötet die Euren für die Unseren!«, sagte Fahkr atemlos.
»Das nun wahrlich nicht!«, erwiderte der Templer plötzlich erzürnt. »Für uns ist es eine schwere Sünde, einen Mann des rechten Glaubens zu töten, ebenso wie für euch in eurem Glauben. Das kommt nicht infrage.«
»Aber«, fügte er nach einer Weile hinzu und hatte seine gute Laune wiedergewonnen, »nichts hindert uns daran, solchen Bengeln eine Abreibung zu verpassen, wenn sie anders keine Vernunft annehmen wollen. Ich habe selbst einige Male das Vergnügen gehabt …«
Er neigte sich rasch zu seinem Knappen und übersetzte. Als der Knappe nickte und zustimmend lachte, schienen alle erleichtert und lachten, vielleicht sogar eine Spur zu laut.
Eine Windböe, das letzte Aufleben der Abendbrise von den Bergen bei Al Khalil, wehte plötzlich den Geruch der Templer zu den drei Rechtgläubigen hinüber, und diese konnten aus ihrem Widerwillen keinen Hehl machen und wichen zurück.
Die Templer sahen ihre Verlegenheit, standen sofort auf und schlugen vor, die Seiten zu wechseln. Die drei Gastgeber folgten unverzüglich diesem Rat, ohne etwas Unhöfliches zu sagen. Emir Moussa begann daraufhin, Mokka in kleine Tassen zu gießen.
»Wir haben unsere Regeln«, erklärte der Templer entschuldigend, als er es sich wieder bequem machte. »Ihr habt Regeln, die vorsehen, dass man sich andauernd wäscht, und wir haben Regeln, die das verbieten. Genau wie ihr Regeln für die Jagd habt, während uns diese verboten ist, solange es sich nicht um Löwen handelt, oder wie wir Wein trinken und ihr nicht.«
»Wein ist etwas anderes«, wandte Jussuf ein. »Das Verbot von Wein ist streng und außerdem ein Wort Gottes an den Propheten, der Friede sei mit ihm. Aber im Übrigen sind wir nicht wie unsere Feinde, denkt nur an Gottes Wort in der siebten Sure: ›Wer hat die schönen Dinge verboten, die Gott seinen Dienern geschenkt hat, und all das Gute, was er ihnen zu ihrer Versorgung gegeben hat.‹«
»Na ja«, meinte der Templer, »in eurer Schrift steht alles mögliche. Und wenn ihr wolltet, dass ich aus Eitelkeit meine Scham entblöße und mit Duftwässerchen begieße wie weltliche Männer, dann könnte ich genauso gut versuchen, euch davon abzubringen, mich euren Feind zu nennen. Hört nur die Worte eurer eigenen Schrift aus der 61. Sure, die Worte eures eigenen Propheten, der Friede sei mit ihm: ›O ihr, die ihr glaubt – ihr seid Allahs Helfer, wie Jesus, der Sohn der Maria, zu den Weißgekleideten sprach: Welches sind meine Helfer zu Allah? Und sie antworteten: Wir sind Allahs Helfer. Und es glaubte ein Teil von den Kindern Israel, und ein anderer Teil war ungläubig. Und wir halfen den Gläubigen wider ihren Feind, und sie wurden siegreich.‹ Am besten gefällt mir natürlich das mit den Weißgekleideten …«
Bei diesen Worten sprang Emir Moussa auf, als wolle er zu seinem Schwert greifen, besann sich dann aber und blieb stehen. Er war im Gesicht hochrot vor Wut, als er den Arm ausstreckte und einen anklagenden Finger auf den Templer richtete.
»Gotteslästerer!«, schrie er. »Ihr sprecht die Sprache des Koran, das ist eine Sache. Aber die Worte Gottes in Lästerung und Spott zu verwandeln ist eine andere, die Ihr nicht überleben würdet, wäre es nicht so, dass Euch Seine Maje… ich meine Jussuf, sein Wort gegeben hat!«
»Setzt Euch und benehmt Euch, Moussa!«, brüllte ihn Jussuf an, aber nahm sich sofort zusammen, als Moussa seinem Befehl gehorchte. »Das, was Ihr da gehört habt, war wirklich Gottes Wort, und das steht tatsächlich in der 61. Sure. Es ist ein Wort, über das Ihr einmal nachdenken solltet. Und glaubt im Übrigen nicht daran, dass das mit den Weißgekleideten wirklich bedeutet, was unser Gast im Scherz angedeutet hat.«
»Nein, natürlich nicht«, beeilte sich der Templer, einzulenken. »Es bezieht sich auf Weißgekleidete, die es lange vor meinem Orden gab. Meine Kleidung hat mit dieser Sache nichts zu tun.«
»Wie kommt es, dass Ihr Euch so gut im Koran zurechtfindet?«, fragte Jussuf mit seiner normalen, ruhigen Stimme, als sei nichts Beleidigendes vorgefallen und als sei sein hoher Rang nicht soeben beinahe enthüllt worden.
»Es ist klug, seinen Feind zu studieren. Wenn Ihr wollt, kann ich Euch dabei helfen, die Bibel zu verstehen«, antwortete der Templer, als wolle er scherzend das Thema wechseln und als würde er seinen plumpen Einbruch in die Sphäre der Rechtgläubigen bereuen.
Jussuf wollte schon scharf auf diese lose Rede antworten, dass er sich dem Studium ketzerischer Schriften widmen solle, aber ein fürchterlicher und langgezogener Schrei ließ ihn den Faden verlieren. Der Schrei ging in ein schrilles Hohngelächter über und hallte von den Bergen wider. Alle Männer erstarrten und lauschten. Emir Moussa begann sofort die Worte zu murmeln, die die Rechtgläubigen gebrauchten, um die Dschinn der Wüste zu beschwören. Da ertönte der Schrei erneut und klang nun, als komme er von mehreren Geistern der Tiefe, die sich darüber austauschten, dass sie das kleine Feuer entdeckt hätten und die einzigen Menschen, die sich in dieser Gegend aufhielten.
Der Templer beugte sich vor und flüsterte seinem Knappen ein paar Worte auf Fränkisch zu. Dieser nickte sofort, stand auf, legte seinen Schwertgürtel um, zog seinen schwarzen Umhang enger um die Schultern, verbeugte sich wortlos vor seinen Gastgebern und verschwand in der Dunkelheit.
»Ihr müsst diese Unhöflichkeit entschuldigen«, sagte der Templer. »Aber wie die Dinge nun einmal liegen, haben wir eine Menge frisches Blut oben in unserem Lager und Pferde, um die man sich kümmern muss.«
Es hatte den Anschein, als finde er die Sache nicht weiter erklärungsbedürftig. Mit einer kleinen Verbeugung hielt er Emir Moussa die kleine Mokkatasse zum Nachfüllen hin. Beim Einschenken zitterte die Hand des Emirs ein wenig.
»Ihr schickt Euren Knappen in die Dunkelheit, und er gehorcht Euch, ohne mit der Wimper zu zucken?«, fragte Fahkr mit leiser und etwas heiserer Stimme.
»Ja«, entgegnete der Templer. »Man gehorcht, selbst wenn man Angst hat. Aber ich glaube nicht, dass Armand Angst hat. Die Dunkelheit ist dem mit einem schwarzen Umhang ein größerer Freund als dem mit einem weißen. Außerdem ist Armands Schwert scharf, und er führt eine sichere Hand. Diese wilden Hunde, diese fleckigen Bestien mit ihrem unschönen Geheul, sind doch auch für ihre Feigheit bekannt, oder nicht?«
»Aber seid Ihr Euch sicher, dass das, was wir eben gehört haben, die wilden Hunde waren?«, fragte Fahkr unschlüssig.
»Nein«, antwortete der Templer. »Es gibt vieles zwischen Himmel und Erde, was wir nicht kennen. Niemand kann sicher sein. Aber der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, und ob ich schon wandelte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. So wird wohl Armand da draußen in der Finsternis beten. Auf jeden Fall würde ich das tun. Wenn Gott unsere Zeit abgemessen hat und uns heimrufen will, dann können wir natürlich nichts tun. Aber bis dahin spalten wir wilden Hunden und unseren Feinden die Schädel. Und darin, das weiß ich, denkt ihr, die ihr an den Propheten glaubt, Friede seiner Seele, und die ihr Gottes Sohn verleugnet, genauso wie wir. Habe ich damit nicht recht, Jussuf?«
»Ihr habt recht, Templer«, stellte dieser fest. »Aber wo verläuft die Grenze zwischen Vernunft und Glaube, zwischen Angst und Gottvertrauen? Wenn ein Mann gehorchen muss, wie Euer Knappe gehorcht hat, mindert das seine Furcht?«
»Als ich jung war, nun ja, ich bin noch kein sonderlich alter Mann«, meinte der Templer und schien scharf nachzudenken, »habe ich mich ständig mit solchen Fragen beschäftigt. Das ist gut für den Kopf, die Gedanken werden beweglich, wenn man mit dem Kopf arbeitet. Aber inzwischen, fürchte ich, bin ich recht träge geworden. Man gehorcht. Man besiegt das Böse. Anschließend dankt man Gott, das ist alles.«
»Und wenn man seinen Feind nicht besiegt?«, fragte Jussuf mit einer Stimme, die seinen Begleitern weicher als sonst vorkam.
»Da stirbt man, zumindest in meinem und in Armands Fall«, antwortete der Templer. »Und am Jüngsten Tag werden Eure und meine Seele gewogen, und was Euch dann beschieden ist, vermag ich nicht zu sagen, obwohl ich weiß, was Ihr selbst glaubt. Aber wenn ich hier in Palästina sterbe, dann gehe ich ins Paradies ein.«
»Glaubt Ihr das wirklich?«, fragte Jussuf immer noch mit dieser ungewöhnlich weichen Stimme.
»Ja, das glaube ich«, antwortete der Templer.
»Sagt mir eins, steht diese Verheißung wirklich in Eurer Bibel?«
»Nein, ganz so steht es nicht da.«
»Aber trotzdem seid Ihr Euch ganz sicher?«
»Ja, der Heilige Vater in Rom hat versprochen …«
»Aber der ist doch auch nur ein Mensch! Welcher Mensch kann Euch einen Platz im Paradies versprechen, Templer?«
»Aber Mohammed war auch nur ein Mensch! Und Ihr glaubt an seine Versprechen, verzeiht, Friede seinem Namen.«
»Mohammed, der Friede sei mit ihm, war Gottes Gesandter, und Gott sagte: ›Jedoch der Gesandte und die Gläubigen bei ihm eifern mit Gut und Blut, und sie – das Gute wird ihnen zum Lohn, und sie – ihnen wird’s wohlergehen. ‹ Das sind doch wohl klare Worte? Und die Fortsetzung lautet …«
»Ja! Der nächste Vers der neunten Sure lautet folgendermaßen«, unterbrach ihn der Templer brüsk, »›Bereitet hat Allah für sie Gärten, durcheilt von Bächen, ewig darinnen zu verweilen. Das ist die große Glückseligkeit!‹ Dann sollten wir uns doch verstehen? Nichts davon ist Euch fremd, Jussuf. Und im Übrigen ist der Unterschied zwischen Euch und mir, dass ich kein Gut, keinen Besitz habe, ich habe mich Gott anvertraut, und wenn er es so will, sterbe ich für seine Sache. Euer Glaube widerlegt durchaus nicht, was ich sage.«
»Ihr kennt Euch mit den Worten Gottes wirklich gut aus, Templer«, stellte Jussuf fest, war aber zufrieden, dass ihm sein Feind auf den Leim gegangen war. Das sahen ihm seine Gefährten an.
»Ja, wie gesagt, man muss seinen Feind kennen«, meinte der Templer und wirkte zum ersten Mal etwas verunsichert, als hätte er ebenfalls eingesehen, dass ihn Jussuf in die Ecke gedrängt hatte.
»Wenn Ihr so sprecht, seid Ihr gar nicht mein Feind«, antwortete Jussuf. »Ihr zitiert den heiligen Koran, das Wort Gottes. Was Ihr sagt, gilt also für mich, aber vorläufig noch nicht für Euch. Ich weiß wahrlich nicht so viel über Jesus wie Ihr über den Propheten, der Friede sei mit ihm. Aber was hat Jesus über den Heiligen Krieg gesagt? Hat Jesus auch nur ein einziges Wort darüber gesagt, dass Ihr ins Paradies kommt, wenn Ihr mich tötet?«
»Lasst uns darüber jetzt nicht streiten«, meinte der Templer mit einer selbstsicheren Geste, als seien das alles nur Kleinigkeiten, obwohl alle seine Unsicherheit sehen konnten. »Unser Glaube ist nicht derselbe, selbst wenn vieles gleich ist. Trotzdem müssen wir zusammen in einem Land leben und im schlimmsten Fall gegeneinander kämpfen und im besten Fall miteinander Verträge schließen und Geschäfte machen. Lasst uns jetzt über etwas anderes sprechen. Das ist mein Wunsch als euer Gast.«
Sie hatten alle begriffen, dass Jussuf seinen Gegner in eine Falle gelockt hatte, aus der er sich nicht mehr befreien konnte. Jesus hatte offenbar nie etwas darüber gesagt, dass es gottgefällig sei, Sarazenen zu töten. Dennoch war es dem Templer gelungen, sich durch die ungeschriebenen Gesetze der Gastfreundschaft unter den Rechtgläubigen aus seiner unangenehmen Lage zu befreien. Da er der Gast war, musste man seinem Wunsch entsprechen.
»Wahrlich, Ihr wisst viel über Eure Feinde, Templer«, sagte Jussuf und erweckte den Anschein, als gefalle es ihm, den Disput gewonnen zu haben.
»Wie gesagt, man muss seine Feinde kennen«, erwiderte der Templer leise und mit gesenktem Blick.
Eine Weile saßen sie schweigend da und starrten in ihre Mokkatassen. Es war nicht leicht, nach Jussufs Sieg das Gespräch ungezwungen wieder in Gang zu bringen. Doch plötzlich wurde die Ruhe erneut durch das Heulen der Untiere gestört. Jetzt hörten sie alle, dass es Tiere waren und keine teuflischen Wesen, und es klang so, als würden sie jemanden oder etwas angreifen. Dann schienen sie unter Schmerzens- und Todesschreien die Flucht zu ergreifen.
»Armands Schwert ist wie gesagt scharf«, murmelte der Templer.
»Warum nur habt Ihr die Leichen der Räuber mitgeschleppt?«, fragte Fahkr.
»Es wäre natürlich viel besser gewesen, sie lebend mitzunehmen. Dann würde es auf dem Heimweg auch nicht so übel riechen, und sie hätten ohne Mühe selbst reiten können. Morgen wird es sehr heiß, und wir müssen zeitig aufbrechen, um sie nach Jerusalem zu bringen, ehe sie allzu sehr stinken«, erwiderte der Templer.
»Aber wenn Ihr sie nun gefangen genommen und lebend nach El Quds gebracht hättet, was wäre dann mit ihnen geschehen?«, fragte Fahkr weiter.
»Wir hätten sie unserem Emir in Jerusalem ausgeliefert, dem Ranghöchsten unseres Ordens. Dieser hätte sie der weltlichen Macht übergeben, und dann hätte man ihnen alle Kleider genommen außer denen, die ihre Scham bedecken, und hätte sie gehängt, und zwar an der Mauer auf dem Felsen«, antwortete der Templer, als sei das alles selbstverständlich.
»Aber Ihr habt sie doch bereits getötet, warum nehmt Ihr ihnen nicht bereits hier ihre Kleider und überlasst sie dem Schicksal, das sie verdient haben? Warum verteidigt Ihr ihre Leichen auch noch gegen die wilden Tiere?«, beharrte Fahkr, als wolle er das Fragen nicht lassen oder als könne er das Verhalten der Templer einfach nicht verstehen.
»Wir werden die Leichen auf jeden Fall dort aufhängen«, erwiderte der Templer. »Alle sollen wissen, dass jeder, der Pilger ausplündert, dort endet. Das heilige Gelöbnis unseres Ordens muss, solange uns Gott hilft, immer erfüllt werden.«
»Was macht Ihr mit ihren Waffen und Kleidern?«, fragte Emir Moussa neugierig und in einem Ton, als wolle er das Gespräch in verständlichere Bahnen lenken. »Sie müssen doch einiges an Kostbarkeiten bei sich gehabt haben?«