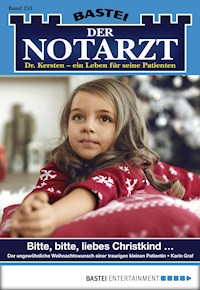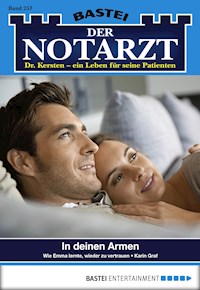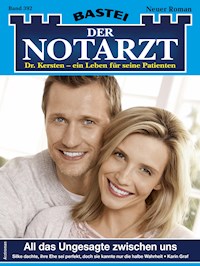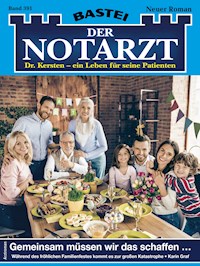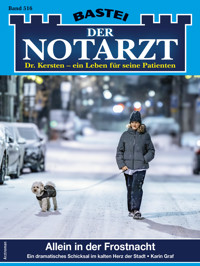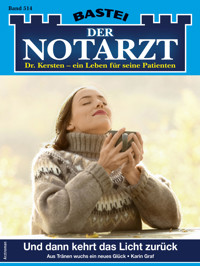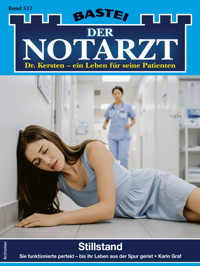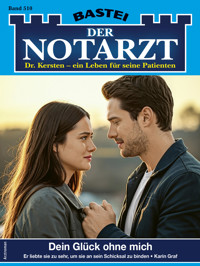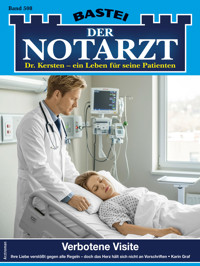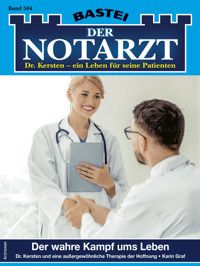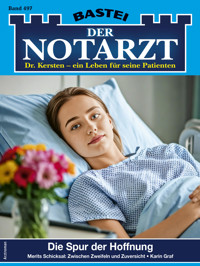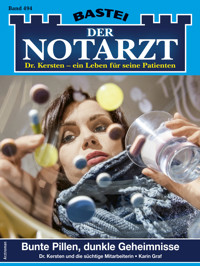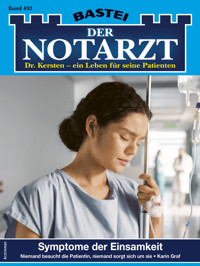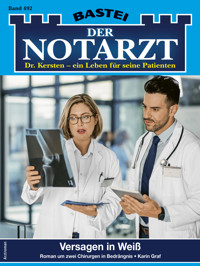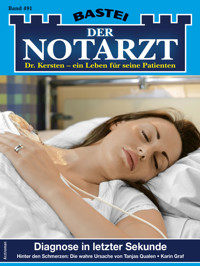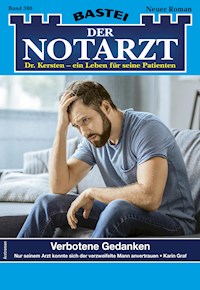
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Notarzt
- Sprache: Deutsch
Ken Frankenberg hat eine schlimme Zeit hinter sich. Vor drei Jahren wurde er unfreiwillig Zeuge, als seine damalige Freundin kaltblütig ermordet wurde. Den Verlust und das traumatische Erlebnis hat er nie verwunden. Seit jenem Tag wird er von Panikattacken heimgesucht und findet nachts kaum Schlaf. Als letzten Ausweg hat er sich vor einigen Wochen bei dem bekannten Psychiater Prof. Dr. Höppner in Behandlung begeben. Vielleicht kann der ihm helfen, endlich wieder ein normales Leben zu führen? Anfangs sieht es tatsächlich so aus, als würde sich alles zum Besseren fügen. Ken kann wieder regelmäßiger schlafen und wird nicht ständig von seinen schlimmen Erinnerungen verfolgt. Doch leider ist seine Erleichterung nur von kurzer Dauer, denn etwas anderes belastet den jungen Rettungspiloten zunehmend: Er hat plötzlich verbotene Gedanken. Gedanken, die immer wiederkehren und Besitz von ihm zu ergreifen scheinen. Ken merkt sehr genau, dass diese Gedanken ihn zu schrecklichen Taten verleiten wollen, und sie werden immer stärker ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Verbotene Gedanken
Vorschau
BASTEI LÜBBE AG
Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: YAKOBCHUK VIACHESLAV / shutterstock
eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 9-783-7517-0496-0
www.bastei.de
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Verbotene Gedanken
Nur seinem Arzt konnte sich der verzweifelte Mann anvertrauen
Karin Graf
Ken Frankenberg hat eine schlimme Zeit hinter sich. Vor drei Jahren wurde er unfreiwillig Zeuge, als seine damalige Freundin kaltblütig ermordet wurde. Den Verlust und das traumatische Erlebnis hat er nie verwunden. Seit jenem Tag wird er von Panikattacken heimgesucht und findet nachts kaum Schlaf. Als letzten Ausweg hat er sich vor einigen Wochen bei dem bekannten Psychiater Prof. Dr. Höppner in Behandlung begeben. Vielleicht kann der ihm helfen, endlich wieder ein normales Leben zu führen?
Anfangs sieht es tatsächlich so aus, als würde sich alles zum Besseren fügen. Ken kann wieder regelmäßiger schlafen und wird nicht ständig von seinen schlimmen Erinnerungen verfolgt. Doch leider ist seine Erleichterung nur von kurzer Dauer, denn etwas anderes belastet den jungen Rettungspiloten zunehmend: Er hat plötzlich verbotene Gedanken. Gedanken, die immer wiederkehren und Besitz von ihm zu ergreifen scheinen. Ken merkt sehr genau, dass diese Gedanken ihn zu schrecklichen Taten verleiten wollen, und sie werden immer stärker ...
Alles hatte damit begonnen, dass Ken Frankenberg nicht mehr schlafen konnte. Nicht bloß für eine Nacht oder zwei, sondern so gut wie gar nicht mehr.
Posttraumatisches Belastungssyndrom, so hatte die Diagnose seines Hausarztes gelautet. Ken hatte kurz davor, bevor er damit begonnen hatte, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen, tatsächlich ein traumatisches Erlebnis gehabt. Ein sehr traumatisches Erlebnis.
Ein Krimineller hatte ihn brutal zusammengeschlagen, geknebelt und mit Klebeband an Händen und Füßen gefesselt. Nachts in einem Park, durch den er den Heimweg hatte abkürzen wollen.
Was dann geschehen war, daran mochte Ken nicht einmal denken. Nur so viel: Als alles vorüber war – und es hatte verdammt lange gedauert! –, war Isabella, seine damalige Freundin, tot gewesen.
Bis zum Morgen, bis ein früher Spaziergänger das Pech gehabt hatte, sie zu entdecken, hatte er dicht neben ihr gelegen und nichts anderes tun können, als sie anzusehen.
Seit mehr als drei Jahren tat Ken nun schon alles, um die schlimmen Bilder und die ebenso schlimmen Schuldgefühle weit von sich zu schieben. Dass es ihm unmöglich gewesen war, Isabella zu retten, änderte nichts daran, dass er sich unendlich schuldig fühlte.
Der Vorfall hatte sich in Berlin ereignet. Inzwischen lebte Ken in Frankfurt. So lief er nicht Gefahr, zufällig in die Nähe des Parks zu geraten oder sich plötzlich auf einer der Straßen wiederzufinden, auf denen er und Isabella damals gegangen waren.
Drei Jahre lag das nun schon zurück. Das erste Jahr war das Schlimmste gewesen. Obwohl er selbst ziemlich übel zugerichtet gewesen war, hatte man ihn beschuldigt, seine Freundin getötet und sich danach – um vom wahren Sachverhalt abzulenken – selbst verletzt und gefesselt zu haben.
Er hatte sogar zwei Monate lang in Untersuchungshaft verbracht. Dann hatten sie den wahren Täter endlich erwischt. Und dann war natürlich alles wieder von vorne losgegangen. Abermals hatte er die Ereignisse in allen Einzelheiten wieder und wieder erzählen und dem grinsenden Kerl dabei ins Gesicht blicken müssen.
Als er seine Schuldigkeit getan hatte und der Irre hinter Gittern saß, war Ken ein psychisches Wrack gewesen. Und alleine.
Seine Familie hatte sich in dem Augenblick von ihm losgesagt, in dem er verhaftet worden war. Und Isabellas Familie hatte ihn selbst nach seinem Freispruch weiter schuldig gesprochen. In ihren Augen hatte er ihre Tochter feige im Stich gelassen.
Wenn das alles kein traumatisches Erlebnis war, was dann?
Wenn die Erinnerung wie ein Blitz über ihn kommen wollte, wenn die ersten Bilder und Gefühle aus seinem Unterbewusstsein heraufdämmerten, dann half nur rasche Ablenkung.
Rennen war ein probates Gegenmittel. Und zwar so schnell und so weit rennen, dass Körper und Geist vollauf beschäftigt waren.
Das Erinnern setzte immer dann ein, wenn es um ihn herum zu still wurde, wenn auch nur die minimalste Pause in seinem hektischen Alltag entstand, wenn er dazu gezwungen war, irgendwo zu sitzen und zu warten.
Deshalb stieg er auch in keinen Bus und keinen Zug mehr ein und fuhr auch nicht mehr mit dem eigenen Auto. Alles unter hundert Kilometern bewältigte er mit dem Fahrrad. Für alle Strecken, die länger waren, nahm er das Motorrad. Auch im Winter.
Jeder, der nicht wusste, was mit ihm los war, musste ihn für verrückt halten, wenn er miterlebte, wie er plötzlich aufsprang, panisch »Nein, nein, nein, weg, weg, weg!« rief und blindlings losstürmte.
Die Zeit, in der alles, was man im hintersten Winkel seines Unterbewusstseins vergraben hatte, hervorkroch und intensiv ins Bewusstsein drängte, waren natürlich die Minuten knapp vor dem Einschlafen. Und das war auch der Grund für Kens Schlaflosigkeit.
Abend für Abend und Nacht für Nacht schnellte er bis zu zwanzig Mal immer wieder aus dem Bett hoch. »Weg, weg, weg! Nein, nein, nein!«
Dann rannte er in seinen kleinen Fitnessraum, raste auf seinem Hometrainer einmal um die Welt, schleppte sich hundemüde ins Bett zurück, fuhr wieder hoch, hastete auf dem Laufband von Frankfurt nach Hamburg und wieder zurück und versuchte erneut, einzuschlafen.
Erst wenn er körperlich so erschöpft war, dass er augenblicklich in einer tiefen Bewusstlosigkeit versank, sobald sein Kopf das Kissen berührte – und das war meistens erst dann der Fall, wenn bereits der neue Morgen heraufdämmerte –, konnte er Ruhe finden. Zumindest so lange, bis der Wecker klingelte und er zur Arbeit musste. Das waren nur selten mehr als zwei oder drei Stunden. Gerade genug, um einen Arbeitstag bewältigen zu können.
Ken Frankenberg war Hubschrauberpilot und zugleich Rettungssanitäter. Er arbeitete für die Frankfurter Flugrettung. Dieser überaus stressige Job kam ihm jetzt sehr zugute, denn während der mitunter recht riskanten und hektischen Einsätze blieb ihm absolut keine Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen.
Nachdem die Sache mit der Schlaflosigkeit etwa zweieinhalb Jahre lang so gelaufen war, nachdem sich bereits die ersten gesundheitlichen Folgeerscheinungen gezeigt hatten und sein Hausarzt ihm die Ausstellung eines weiteren Rezepts für Schlaftabletten – die sowieso keine Wirkung zeigten – verweigert hatte, hatte er vor einem halben Jahr zum ersten Mal Prof. Dr. Bruno Höppner aufgesucht.
Sein Hausarzt hatte ihm diesen Psychiater empfohlen, der eine weltweit anerkannte Koryphäe war – unter anderem auf dem Gebiet der Traumatherapie.
Sympathisch war Ken der Mann von Anfang an nicht gewesen. Der fast siebzigjährige Professor hatte etwas an sich – was, das konnte Ken nicht benennen –, was ihm jedes Mal eine Gänsehaut verursachte.
Doch die Behandlung schien zu wirken. Seit etwa zwei Monaten musste er nicht mehr ganz so weit rennen. Abends sprang er nicht mehr ganz so oft aus dem Bett, und es gelang ihm immer öfter, ein paar Minuten lang irgendwo tatenlos zu sitzen, ohne dass die Erinnerung sofort mit voller Wucht zuschlug.
Allerdings war er nicht ganz sicher, ob er sich über diesen Erfolg freuen sollte. Er war nicht einmal sicher, ob es sich überhaupt um einen Erfolg handelte.
Ja, er musste heute nicht mehr so oft an damals denken. Dafür gingen ihm allerdings andere Dinge durch den Kopf. Schlimme Dinge. Keine Erinnerungen, sondern Dinge, die noch gar nicht geschehen waren. Dinge, die erst darauf warteten, zu geschehen.
Diese Art der Verbesserung, die ihm zuteilgeworden war, fühlte sich für ihn an, als ob man Läuse gegen Flöhe vertauscht hätte. Die Pest gegen die Cholera. Oder eine Überschwemmung gegen eine Feuersbrunst. Schwer zu sagen, ob etwas davon wirklich besser war als das andere.
Schriller Alarm drang plötzlich aus allen Lautsprechern, die in jedem Winkel der Flugrettungszentrale montiert waren.
Ken sprang vom Laufband im Fitnessraum, in dem die Rettungsärzte und Sanitäter sich nicht nur die Wartezeit vertrieben, sondern sich auch gleich körperlich ertüchtigten, was für ihren Beruf unabdingbar war.
Er wischte sich nur notdürftig den Schweiß von Gesicht und Körper und sprang in seinen Overall, den er wie immer so bereitgelegt hatte, dass er sich nicht erst damit aufhalten musste, irgendwelche Reißverschlüsse oder Knöpfe zu öffnen.
Dann rannte er nach draußen. Den Hubschrauber hatte er – wie immer – nach dem letzten Einsatz sofort durchgecheckt und aufgetankt. Er brauchte nur noch hineinzuspringen und den Vogel zu starten.
Seine Teamkameraden – Lukas, der sechsunddreißigjährige Rettungsarzt, und Tim, der achtundzwanzigjährige Notfallsanitäter – hatten bei ihrer Rückkehr die Materialkisten wieder aufgefüllt und die medizinischen Geräte überprüft.
Der Motor heulte bereits auf, und die Rotoren schnitten sirrend durch die Luft, als Lukas und Tim in nach vorne gebeugter Haltung angerannt kamen und einstiegen. Lukas vorne, Tim – der meistens derjenige war, der aussteigen musste, wenn sie nicht landen konnten – hinten.
Hinten im Frachtraum, wo auch die Rolltrage stand – umgeben von den Überwachungsgeräten und lebenserhaltenden Maschinen –, befanden sich nämlich auch die Seilwinde und die Bergetrage, in der man Verunglückte sicher nach oben ziehen konnte.
»Wo darf ich diesmal landen?«, unkte Ken und hob ab, noch ehe die Türen ganz geschlossen waren. »Auf einer Kirchturmspitze oder in einer Baumkrone?«
Die Landung bei seinem letzten Einsatz vor etwas mehr als zwei Stunden war nämlich die reinste Maßarbeit gewesen. Auf einer kleinen Lichtung mitten im Frankfurter Stadtwald hatte der Abstand von den Rotorblättern zu den umstehenden Bäumen gerade einmal einen halben Meter betragen.
Es hatte sich für ihn angefühlt, als wollte man einen Elefanten durch ein Nadelöhr manövrieren. Aber genau das mochte er ja, denn dabei kam er ganz bestimmt nicht in Versuchung, an damals zu denken.
»Gar nicht«, beantwortete Lukas seine Frage. »Tim muss raus. Vielleicht auch ich.«
»Was ist passiert? Und wo genau?« Er schaute auf seinen Bordcomputer, wo Heinz, der heute die Einsätze koordinierte, ihm bereits die Koordinaten elektronisch übermittelt hatte.
»Staustufe Griesheim«, erwiderte Lukas. »Ein Tourist von einem Ausflugsboot wollte alles ganz genau sehen und ist beim Durchschleusen ins Wehr gefallen. Die Wasserwacht kommt mit dem Boot nicht hin, ohne selbst hinuntergerissen zu werden.«
»Super!« Ken verdrehte die Augen. »Ich wette, er wollte ein Selfie machen. Oder ein Video für seinen Youtube-Kanal. Guckt mal, ich auf einem Ausflugsbooooo...!«
Der Rettungsarzt lachte. »Vermutlich war es so. In letzter Zeit halten etwa die Hälfte aller Verunglückten noch ihre Smartphones in ihren kalten, toten Fingern.«
»Hör mal, Ken!«, mischte sich der Sanitäter, der sich bereits die Sicherheitsgurte anlegte, von hinten ins Gespräch. »Es ist saukalt heute!«
»Und?«
»Kannst du die Winde rechtzeitig stoppen, sodass ich den Verunglückten bergen kann, selbst aber nicht baden gehen muss?«
»Mal sehen ...« Ken tat so, als ob er darüber erst nachdenken müsste. »Dieser Apfelkuchen, den deine Mama dir heute mitgegeben hat ... Für die Hälfte davon würde ich gut aufpassen, dass du nicht nass wirst.«
»Mieser Erpresser!« Der Sanitäter lachte. »Also gut!«
»Geritzt!«, erwiderte Ken schmunzelnd.
Das waren die Momente, in denen er sich für ein paar Augenblicke wieder so wie früher fühlte. Unbeschwert und völlig normal. Als ob nie etwas geschehen wäre.
Wenn er mit seinen Kollegen herumalberte. Wenn kurz vor dem Einsatz in seinem Inneren alles vor Anspannung kribbelte. Wenn er seine fünf Sinne nur auf diese eine Sache konzentrieren musste, weil ihm klar war, dass nicht nur das Überleben des Verunglückten, sondern auch das seiner Kollegen von ihm abhing.
»Ich kann ihn sehen!«, rief er, als er fast über dem Unglücksort war. »Er lebt noch. Er klammert sich an der Walzenaufhängung fest. Scheint zumindest nicht schwer verletzt zu sein, sonst hätte er nicht mehr so viel Kraft.«
»Das heißt dann ja, dass du alleine aussteigst, Tim!«, freute sich Lukas.
»Wie immer!«, grummelte der Sanitäter. »Denk dran, Ken«, rief er dem Piloten noch einmal in Erinnerung. »Nasse Hose, kein Kuchen!«
»Kein Kuchen, nasser Tim!«, konterte Ken lachend und konzentrierte sich darauf, den Hubschrauber möglichst direkt über die Stelle zu manövrieren, an der sich der Verunglückte an das Walzenwehr klammerte, und den Helikopter dann so ruhig wie möglich in der Luft zu halten.
***
Als Barbara Lindner nach dem Abitur Fotografie und Design studiert hatte, hatte sie sich ihre spätere Karriere ein bisschen anders vorgestellt.
Modefotos für die bekannten Hochglanzmagazine waren ihr vorgeschwebt. Zwischendurch hatte sie sich immer mal wieder eine längere Auszeit nehmen, durch die ganze Welt reisen und Landschaftsfotos für internationale Reisemagazine machen wollen. Gerne auch Tierbilder, Fotos berühmter Gebäude und Sehenswürdigkeiten oder kultureller Ereignisse.
Sie hatte sich selbst in flippigen Designeroutfits in den Straßen New Yorks gesehen, wo sie weltberühmte Models angewiesen hatte, wie sie stehen, laufen und gucken sollten.
Sie hatte sich auf Luxusjachten geträumt, auf denen sie die oberen Zehntausend ins rechte Licht rückte. Sie war tagträumend in klimatisierten Jeeps durch Afrikas Savannen gefahren und hatte ihr Teleobjektiv auf Löwen, Elefanten und Nashörner gerichtet.
Und sie hatte auf ihren Vernissagen – Champagner schlürfend – kleine Sticker auf die verkauften Bilder geklebt, die wie die warmen Semmeln an steinreiche Kunstsammler weggingen.
Natürlich hatte sie alle großen Preise eingeheimst, die es für Kunstfotografie zu bekommen gab, und ihr Name war in der ganzen Welt bekannt. Zumindest in ihrer Fantasie.
Nun, keiner ihrer Träume hatte sich erfüllt. Ihr Leben war alles andere als glamourös. Ihre bisher weiteste Dienstreise hatte sie auf die Insel Sylt geführt. Ihre Fotos erschienen auch nicht in der Vogue, der Elle oder in der Cosmopolitan. Auch nicht in der National Geographic, im Traveler oder im Geo. Und Kunstsammler würden ihre Bilder nicht einmal mit der Kneifzange anfassen.
Topmodels, internationale Superstars oder Löwen suchte man auf Barbaras Fotos vergeblich. Stattdessen hatte sie beispielsweise Schloss Neuschwanstein bereits aus sämtlichen nur erdenklichen Winkeln abgelichtet. Von links, von rechts, von vorne, von hinten, von oben, von unten, bei Sonnenschein und unter einem berauschend schönen Sternenhimmel.