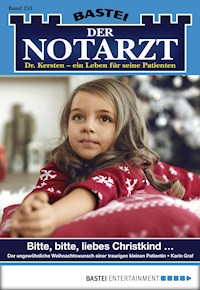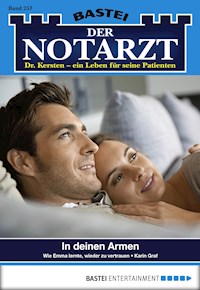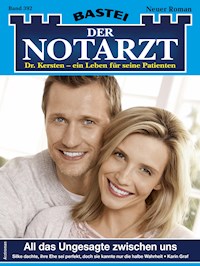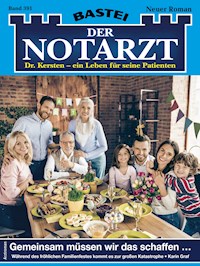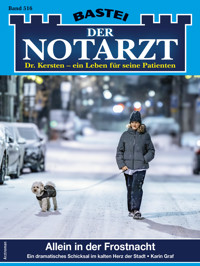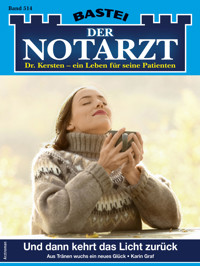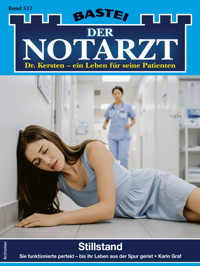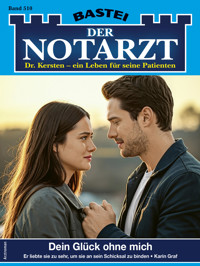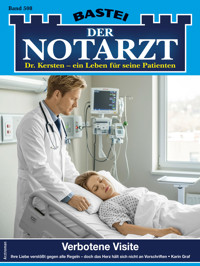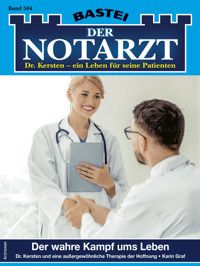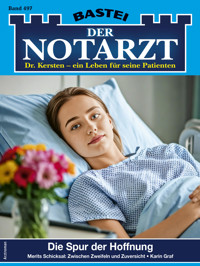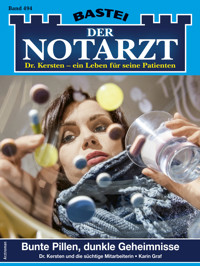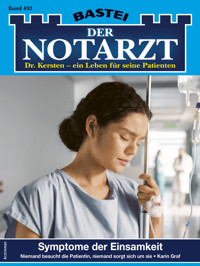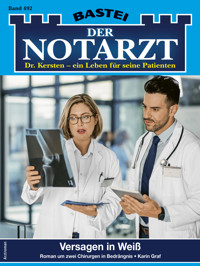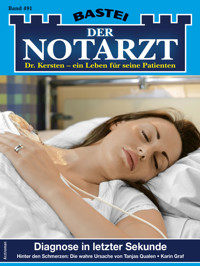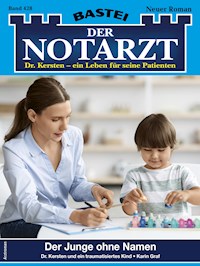
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Notarzt
- Sprache: Deutsch
In allen großen Tageszeitungen prangt das Foto eines etwa vierjährigen, traurig blickenden Jungen. Das Kind wurde im Botanischen Garten in Frankfurt weinend und verwahrlost vorgefunden und weiß offenbar nicht mal, wie es heißt, geschweige denn wo es herkommt und wer seine Eltern sind. "Der Junge ohne Namen" wird der Kleine in der Presse genannt. Peter Kerstens Lebensgefährtin, die Kinder- und Jugendpsychologin Lea König, wird mit dem Fall betraut und erzählt ihrem Freund von dem herzzerreißenden Zustand des Kindes. Doch schon bald ist auch Dr. Kersten selbst in die Sache involviert, denn als sich der Gesundheitszustand des Jungen schlagartig verschlechtert, wird er in die Notaufnahme der Sauerbruch-Klinik gebracht. Hier kommt es zu einem Zwischenfall, der sowohl dem Notarzt als auch den anderen Anwesenden die Tränen in die Augen treibt. Und plötzlich ist die Chance, das Schicksal des Findelkindes zu ergründen, zum Greifen nah ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Junge ohne Namen
Vorschau
Impressum
Der Junge ohne Namen
Dr. Kersten und ein traumatisiertes Kind
Karin Graf
In allen großen Tageszeitungen prangt das Foto eines etwa vierjährigen, traurig blickenden Jungen. Das Kind wurde im Botanischen Garten in Frankfurt weinend und verwahrlost vorgefunden und weiß offenbar nicht mal, wie es heißt, geschweige denn, wo es herkommt und wer seine Eltern sind. »Der Junge ohne Namen« wird der Kleine in der Presse genannt. Peter Kerstens Lebensgefährtin, die Kinder- und Jugendpsychologin Lea König, wird mit dem Fall betraut und erzählt ihrem Freund von dem herzzerreißenden Zustand des Kindes. Doch schon bald ist auch Dr. Kersten selbst in die Sache involviert, denn als sich der Gesundheitszustand des Jungen schlagartig verschlechtert, wird er in die Notaufnahme der Sauerbruch-Klinik gebracht. Hier kommt es zu einem Zwischenfall, der sowohl dem Notarzt als auch den anderen Anwesenden die Tränen in die Augen treibt. Und plötzlich ist die Chance, das Schicksal des Findelkindes zu ergründen, zum Greifen nah ...
»Hey Opa, hast du mal einen Euro für mich?«
Dr. Peter Kersten, der Leiter der Notaufnahme an der Frankfurter Sauerbruch-Klinik, blieb abrupt stehen, als ihm plötzlich diese Frage gestellt wurde.
Von wegen Opa! Unverschämtheit! Er war gerade einmal zweiundvierzig Jahre alt. Okay, er hatte einen anstrengenden 24-Stunden-Dienst hinter sich und zwischendurch höchstens drei oder vier Stunden geschlafen. Da sah er heute möglicherweise ein paar Tage älter aus als sonst, aber Opa ...?
Er wollte das unerfreuliche Geschöpf, das in einem Gang des Frankfurter Hauptbahnhofs saß und ihm fordernd die Hand hinstreckte, schon scharf zurechtweisen, als ihm noch rechtzeitig dämmerte, wie kindisch er sich benahm.
Die Gestalten, die hier Tag und Nacht herumlungerten, die Reisenden um Geld anbettelten und dieses dann sofort in Drogen oder billigen Fusel investierten, brauchten alles andere als eine Lektion über höfliches Benehmen.
Hier hatten sich die Kinder versammelt, die von der guten Gesellschaft ausgespuckt worden waren. Jene, an denen man gerne rasch vorüberging und bei denen man den Kopf abwandte. Solche, denen man nicht zu nahe kommen wollte, weil sie womöglich eine ansteckende Krankheit oder Läuse hatten.
Zu diesen Geht-mich-nichts-an-Leuten hatte Peter nie gehören wollen. Seine Fähigkeit, logisch denken zu können, sagte ihm deutlich, dass Kinder und Jugendliche ganz bestimmt nicht deshalb auf Abwege geraten konnten, weil es ihnen zu gut ging, wie man gerne behauptete. Deshalb erschrak er jetzt ein bisschen darüber, dass er sich gerade völlig automatisch genauso benommen hatte wie so viele andere.
Er schaute also genau hin. Und was er sah, war eine junge Frau, die höchstens achtzehn oder neunzehn Jahre alt sein konnte. Sie war völlig verdreckt. Sie verströmte einen beißenden Geruch nach billigem Fusel und einem Körper, der nach Wasser und einem Stück Seife schrie. Ihre Haare waren ein einziges Filzknäuel von undefinierbarer Farbe. Und ihre Augen waren die einer Toten.
»Was guckst'n du so blöde, Opa?«
Der Notarzt musste lachen und ging neben ihr in die Hocke.
»Kleines, freches Ding! Wie kommt es, dass du betteln musst?«
»Was geht's dich an, Opa?«
»Es interessiert mich eben.«
»Bist du ein Freak oder was?«
»Ich glaube nicht. Wofür brauchst du das Geld?«
»Wieso fragst'n du so blöde?«
»Es interessiert mich eben«, wiederholte Peter schmunzelnd. »Und nein, ich bin kein Freak.«
»Ich möchte mir mit dem Geld eine Fahrkarte kaufen, um zu Mutti nach Hause zu fahren«, flunkerte sie und gab sich nicht einmal ein bisschen Mühe, ihre Lüge wahr klingen zu lassen.
»Wo wohnt Mutti denn?« Er tat, als hätte er ihr die Lüge geglaubt. »Ich besorge dir eine Fahrkarte.«
»Blöder Penner!«, zischte sie. »Wenn du mir nichts geben willst, dann zieh Leine!«
»Hör mal, Mädchen ...« Peter zog seine Brieftasche aus der Gesäßtasche seiner Jeans und zuckte zurück, als die junge Frau gierig danach greifen wollte. Er nahm eine Visitenkarte heraus und gab sie ihr.
»Was soll ich denn mit dem Scheiß, du blöder Penner?«
»Wenn du einmal reden willst oder hungrig bist oder möchtest, dass ich dir helfe, dann besuchst du mich. Okay?«
»Mensch, du bist ja wirklich ein total durchgeknallter Freak!«, zischte sie, grinste jedoch dabei.
»Steck sie ein«, ermahnte Peter sie, als sie die Karte achtlos auf den Boden warf. »Vielleicht kommst du ja doch einmal drauf, dass du Hilfe brauchen könntest. Dann kommst du zu mir. Wir werden gemeinsam einen Weg für dich finden, dich hier rauszuholen, das verspreche ich dir.« Er stand auf. »Ich muss jetzt los. Ich muss jemanden vom Zug abholen, der in einer Minute ankommt.«
»Ja, ja, schwirr ab, Opa!«, rief sie ihm noch hinterher.
Als er sich ein paar Schritte weit entfernt hatte, hörte er sie abermals »Hey, hast du einen Euro für mich, Oma?« betteln. Und er hörte eine Frau »euch sollte man alle in einem Rutsch von hier wegschaffen, dreckiges Gesindel!« antworten.
Er lief weiter zur großen Bahnhofshalle und fragte sich dabei, ob er richtig gehandelt hatte. Hätte er ihr vielleicht doch Geld geben sollen? Oder ihr etwas zu essen kaufen? Oder hätte er sie einfach mitnehmen und zu Professor Ralf Menzinger, dem Leiter der Psychiatrie, bringen sollen, der auch Drogenabhängige mit gutem Erfolg behandelte?
Aber nein, sie musste es selbst wollen. Sie musste von sich aus das Bedürfnis verspüren, ihr Leben zu ändern. Andernfalls würde sie bei der erstbesten Gelegenheit abhauen und dann vermutlich noch tiefer sinken, falls das bei ihr überhaupt noch möglich war.
Die Anzeigetafel über dem betreffenden Bahnsteig blinkte, der Zug fuhr gerade ein. Peter faltete den Zettel auseinander, den er vorbereitet hatte.
Dr. Lorenzo Bruno stand in großen schwarzen Buchstaben darauf. Er hatte den jungen Kollegen, den er abholen sollte, noch nie zuvor gesehen und war schon sehr gespannt auf ihn.
Es handelte sich um einen sechsundzwanzigjährigen Assistenzarzt aus Mailand, der im Austausch gegen einen jungen Kollegen aus der Sauerbruch-Klinik ein Jahr in seiner Abteilung verbringen sollte.
Fieberhaft suchte er noch rasch die letzten paar Brocken der Sprache zusammen, die er vor langer Zeit einmal leidlich gut beherrscht hatte.
Buongiorno! Ähm ... haben gehabt buon viaggio? Io Peter Kersten ... ähm ... benvenuti alla Frankfurti ... ähm ... furt ohne I natürlich! Ähm ...
Na, viel war davon nicht mehr übrig. Wie denn auch? Seit er die Notaufnahme leitete, war ein längerer Italienurlaub nicht mehr drin, und er kannte auch niemanden, mit dem er öfter mal Italienisch hätte sprechen können.
Besser, er tat gar nicht erst so, als ob er die italienische Sprache beherrschte, bevor er sich total lächerlich machte.
Als der Zug jetzt anhielt und die Reisenden sich aus allen Türen ergossen, stellte Peter sich ans Ende des Bahnsteigs, hielt den Zettel hoch und wartete gespannt darauf, angesprochen zu werden.
***
»Lea, sag mir bitte, dass du gerade ein bisschen Zeit hast! Bitte! Ich brauche deine Hilfe! Dringend! Ich bin total überfordert und weiß nicht mehr, was ich noch tun soll.«
Obwohl sie offensichtlich so aufgeregt war, dass sie völlig vergessen hatte, erst einmal ihren Namen zu nennen, erkannte Lea König die Stimme der jungen Kollegin sofort wieder, die nach ihrem Studium ein einjähriges Praktikum in ihrer Praxis absolviert hatte.
Der Kontakt war seither nie ganz abgerissen. Die Fünfundzwanzigjährige, die mittlerweile als Psychologin für das Jugendamt arbeitete, betrachtete Lea immer noch als ihre Lehrerin und Ratgeberin.
Es kam alle paar Wochen vor, dass sie anrief, Lea einen besonders schwierigen Fall schilderte und von ihr wissen wollte, ob sie im Begriff war, die richtige Entscheidung zu treffen, oder was sie noch besser machen könnte.
Lea schätzte die junge Kollegin sehr dafür, dass sie nicht zu jenen gehörte, die lieber ein Kinderschicksal aufs Spiel setzten, bevor sie zugaben, dass sie überfordert waren.
Sie hielt es selbst ja genauso. Auch sie scheute sich nicht, bei erfahreneren Kollegen nachzufragen, wenn sie selbst einmal ratlos war.
»Leni? Leni Becker?«
»Ach ja, entschuldige, bitte. Da kannst du mal sehen ...! Ich bin gerade am Ende meiner Weisheit angelangt und total durch den Wind. Ich bin ganz sicher, dass du es schaffen würdest, zu ihm durchzudringen. Ich habe alles versucht, aber ich kriege es einfach nicht auf die Reihe. Ich fühle mich gerade wie ein blutige Anfängerin, die noch nicht einmal bis drei zählen ...«
»Langsam, Leni, langsam!« Lea musste lachen. »Alles schön der Reihe nach. Atme erst einmal tief durch, und dann fängst du ganz von vorne an, damit ich auch verstehen kann, worüber wir reden.«
»Richtig! Es tut mir leid, Lea, ich bin ... ich habe ... er ist ... du kannst dir nicht vorstellen, wie ...«
»Atmen!«
»Atmen! Richtig! Erst mal atmen.«
Lea konnte hören, wie Leni am anderen Ende der Leitung ein paarmal tief Luft holte. Sie musste schmunzeln. Leni Becker war eine der Ersten gewesen, die sie hatte ausbilden dürfen. Obwohl ihr seither etliche Studienabgänger nachgefolgt waren, war die quirlige junge Kollegin bis jetzt Leas absolute Lieblingsschülerin geblieben.
Leni hatte es bis heute nie geschafft, die Entscheidung über das weitere Schicksal eines Kindes zur Routine werden zu lassen. Und genau das rechnete Lea ihr hoch an. Es gab schon genügend abgestumpfte Kollegen, die mitunter nur noch daran dachten, einen Fall so schnell wie möglich vom Tisch zu bekommen.
»Okay, Leni. Wer ist er?«
»Ein kleiner Junge. Unheimlich süß. Schätzungsweise vier Jahre alt. Er ist ...«
»Was?«, hakte Lea nach, als Leni verstummte.
»Warte mal, warte mal ...« Lea konnte hören, wie ihre Kollegin schluckte und die Nase hochzog. »Tut mir echt leid. Ich weiß, ich bin total unprofessionell. Aber immer, wenn ich an seine großen, traurigen Augen denke, dann ...«
»Schon gut. Menschlichkeit ist niemals unprofessionell. Ganz im Gegenteil. Nimm dir ruhig Zeit. Ich habe gerade nichts besonders Wichtiges zu tun.« Sie wartete, bis die junge Psychologin sich die Nase geputzt hatte. »Schätzungsweise vier Jahre, sagtest du?«, hakte sie dann nach. »Ihr wisst es also nicht? Wie kommt das?«
»Der Kleine wurde gestern am frühen Morgen im Botanischen Garten aufgegriffen, wo er weinend umhergeirrt ist. Verdreckt, wie er war, ist anzunehmen, dass er mindestens eine Nacht dort verbracht hat. Vielleicht sogar zwei. Vorgestern hatte es ja geregnet, da ist dort niemand spazieren gegangen. Er war total verängstigt und dehydriert.«
»Du meine Güte!«
»Das kannst du laut sagen«, seufzte Leni Becker. »Wir konnten seine Eltern bis jetzt nicht ausfindig machen. Aus Frankfurt kann er nicht sein. Die Polizei hat sehr gründlich ermittelt. Entweder haben Touristen ihn hier zurückgelassen, oder ... oder er ist vom Himmel gefallen.«
»Und der Junge selbst? Mit etwa vier Jahren müsste er doch schon ein paar Angaben machen können. Die eigene Wohnadresse und den Nachnamen, das bringt man einem Kleinkind doch als Erstes bei. Eben für den Fall, dass es verloren geht, damit es sagen kann, wohin es gehört.«
»Schön wär's! Er kennt nicht einmal seinen Vornamen. Er behauptet, er hieße Püppi.«
»Ich verstehe.«
Es kam nicht selten vor, dass Vierjährige, Fünfjährige und mitunter sogar Kinder, die bereits im Schulalter waren, bei der Frage nach ihrem Namen Schatz, Zwerg, Kurzer, Häschen, Prinzessin oder Ähnliches angaben.
»Und weißt du, was noch seltsam ist?«, fuhr Leni Becker fort. »Er weiß nicht einmal, ob er ein Junge oder ein Mädchen ist. Als er gefunden wurde, hatte er Mädchensachen an. Aber er ist eindeutig ein Junge.«
»Heiliger Bimbam!« Lea schloss für einen Moment die Augen und schüttelte den Kopf. »Und über seine Eltern weiß er gar nichts zu erzählen? Deren Vornamen beispielsweise? Was oder wo sie arbeiten? Irgendwas?«
»Uwe und Torten.«
»Wie bitte?«
»Diese beiden Namen erwähnt er manchmal. Vielleicht ist es aber auch nur einer, denn er nennt die Namen immer in einem Atemzug. Uwe-Torten. Ich gehe davon aus, dass Torten Thorsten heißen soll.«
»Vermutlich.« Lea dachte nach. »Oder dieser Uwe heißt mit Nachnamen Torten? Hast du schon ...«
»Es gibt niemanden, er so heißt. Das habe ich schon nachgeguckt. Mit den Begriffen Mama und Papa scheint er überhaupt nichts anfangen zu können. Wenn ich ihn danach frage, sieht er mich immer an, als ob ich ihn darum gebeten hätte, mir etwas über Quantenphysik und Molekularbiologie oder so etwas in der Art zu erzählen.«
»Uwe und Thorsten ...« Lea runzelte die Stirn. »Vielleicht ist er bei einem homosexuellen Paar aufgewachsen. Wenn ja, dann müssten sie ihn doch adoptiert haben. Hast du schon versucht, herauszufinden, ob in Frankfurt und Umgebung vor drei oder vier Jahren ...«
»Nichts!«, fiel Leni ihr ins Wort. »Ich habe sämtliche schwulen Paare, die während der letzten fünf Jahre ein Kind adoptiert haben, überprüft. Die haben ihres alle noch.«
»Und ... Väter, die nach einer Scheidung das Sorgerecht für das Kind bekommen haben?«
»Auch nichts. Ich habe auch sämtliche Scheidungsfälle der letzten Jahre überprüft, bei denen das Kind dem Vater zugesprochen wurde. Kein Uwe, kein Thorsten.«
»Hast du ihn nach einem etwaigen Kindergarten befragt?«
»Ja. Nichts. Kein Kindergarten. Er weiß nicht mal, was das sein soll. Er glaubt, es sei ein Garten, in dem Kinder auf Bäumen oder in Beeten wachsen.«
»Namen von kleinen Freunden oder Spielkameraden?«
»Auch nichts. Er weiß auch gar nicht, was Freunde oder Spielkameraden sein sollen.«
»Ist er bereits untersucht worden? Gibt es irgendwelche Anzeichen von ...«
»Nein!«, tönte es beinahe panisch aus dem Telefonhörer. »Ich meine, ja. Ja zu untersucht worden, nein zu Anzeichen für du weißt schon was.«
Ein abgrundtiefer Seufzer unterbrach Lenis Redeschwall.
»Herrgott, ich benehme mich wirklich wie eine blutige Anfängerin. Aber ich habe in letzter Zeit einfach zu oft mit missbrauchten Kindern zu tun gehabt. Manchmal denke ich, ich kann kein einziges weiteres Opfer mehr ertragen, ohne hinterher Amok zu laufen. Tut mir wirklich leid, Lea.«
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich kann dich gut verstehen«, versicherte Lea der jungen Kollegin. »Es geht mir genauso. Also: Was hat die Untersuchung ergeben?«
»Nur ein paar Kratzer und frische Abschürfungen. Die hat er sich aber höchstwahrscheinlich im Park geholt. Er hatte sich wie ein kleines Tier im Gestrüpp verkrochen und dort geschlafen. Ein früher Spaziergänger hat die Polizei alarmiert, weil er dachte, sie sei tot.«
»Sie?«
»Wie gesagt, er trug rosarote Leggins, ein rosarotes Rüschentop, lackierte Fingernägel und glitzernde Spängchen und Schleifchen im langen Haar.
»Wo ist er jetzt?«
»In diesem Kinderheim in der Nähe vom Zoo. Ich war gestern schon fast den ganzen Tag lang hier. Es ist auch nicht so, dass er mir nicht vertrauen würde. Glaube ich zumindest. Das ist nicht der Grund, warum er mir nichts erzählt.«