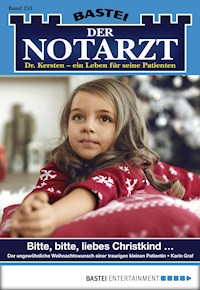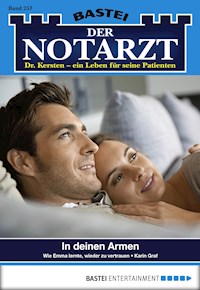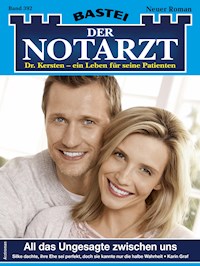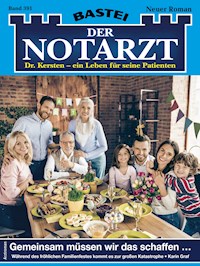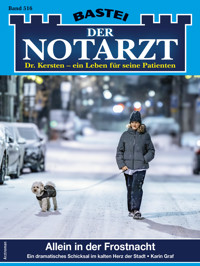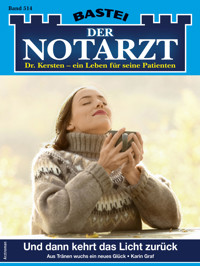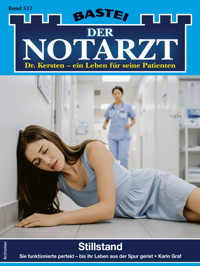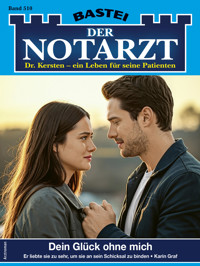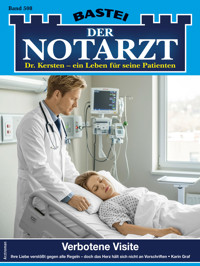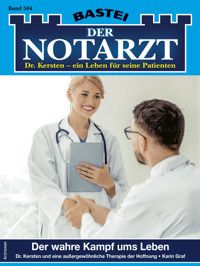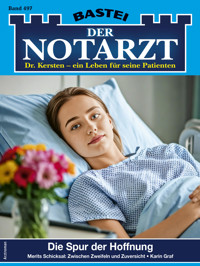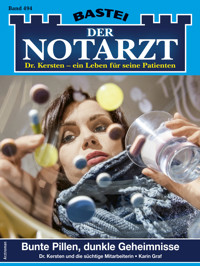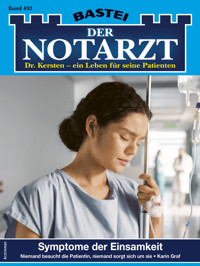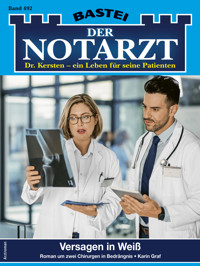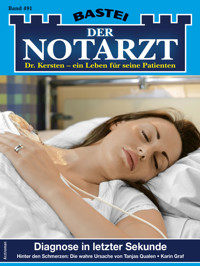1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Notarzt
- Sprache: Deutsch
Als Dr. Peter Kersten in der Frankfurter Sauerbruch-Klinik die vierjährige Pia-Dora erblickt, hat er irgendwie das Gefühl, dieses Kind bereits zu kennen. Sie schaut ihn mit großen, ernsten Augen an, in denen sich der ganze Himmel zu spiegeln scheint und die dem Leiter der Notaufnahme vertraut vorkommen, obwohl er das Mädchen doch gerade erst kennengelernt hat.
Peter Kersten ahnt nicht, dass ein besonderes Schicksal die Kleine zusammen mit ihrer Mutter Lara in die Klinik geführt hat. Ein Schicksal, das auch Peters schwer verletzten guten Freund Marius betrifft, der vor wenigen Stunden in die Notaufnahme eingeliefert wurde. Aber es dauert nicht lange, bis der Notarzt hinter das Geheimnis kommt, welches das Mädchen umgibt. Und dann überstürzen sich die Ereignisse ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Himmel in deinen Augen
Vorschau
Impressum
Der Himmel in deinen Augen
Roman um eine kleine Patientin mit einem besonderen Schicksal
Karin Graf
Als Dr. Peter Kersten in der Frankfurter Sauerbruch-Klinik die vierjährige Pia-Dora erblickt, hat er irgendwie das Gefühl, dieses Kind bereits zu kennen. Sie schaut ihn mit großen, ernsten Augen an, in denen sich der ganze Himmel zu spiegeln scheint und die dem Leiter der Notaufnahme vertraut vorkommen, obwohl er das Mädchen doch gerade erst kennengelernt hat.
Peter Kersten ahnt nicht, dass ein besonderes Schicksal die Kleine zusammen mit ihrer Mutter Lara in die Klinik geführt hat. Ein Schicksal, das auch Peters schwer verletzten guten Freund Marius betrifft, der vor wenigen Stunden in die Notaufnahme eingeliefert wurde. Aber es dauert nicht lange, bis der Notarzt hinter das Geheimnis kommt, welches das Mädchen umgibt. Und dann überstürzen sich die Ereignisse ...
Schon seit geraumer Zeit fühlte sich der vierunddreißigjährige Forschungsreisende Marius Thoma wie innerlich zerrissen.
Er ahnte, dass es an der Zeit war, eine wichtige Entscheidung für die Zukunft zu treffen. Seit etlichen Monaten überlegte er hin und her, wog sämtliche Pros und Kontras gegeneinander ab, schaffte es jedoch nicht, einen endgültigen Entschluss zu fassen.
Gegenstand seiner Unschlüssigkeit war der seit rund einem Jahr immer drängender werdende Wunsch, eine Familie zu gründen. Mit vierunddreißig schien es ihm dringend an der Zeit, denn er wollte kein alter Vater sein.
Er wollte seinen Kindern nicht ständig erklären müssen, dass Papa zu alt sei, um mit ihnen auf dem Klettergerüst im Park herumzuturnen, mit ihnen Radtouren zu unternehmen oder sie auch nur Huckepack zu tragen.
Sein eigener Vater war bei seiner Geburt fast sechzig Jahre alt und schon ein bisschen gebrechlich gewesen. Wenn er ihn von der Schule abgeholt oder an Schulveranstaltungen teilgenommen hatte, hatten seine Klassenkameraden ihn für seinen Großvater gehalten.
Sein Vater hatte kaum jemals etwas mit ihm unternommen. Wenn die anderen Jungs sich an den Wochenenden mit ihren Vätern sportlich betätigt hatten, war Marius zu Hause zu Untätigkeit und Stille verdonnert worden, weil sein Vater Ruhe brauchte.
Vermutlich war das der Grund, warum Marius einen Beruf gewählt hatte, bei dem kein Tag wie der andere verlief und er beinahe täglich bis an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit und oft genug auch noch darüber hinaus gehen musste.
Nun war es aber leider so, dass sein Beruf, den er sehr liebte, mit einem normalen Familienleben ganz und gar nicht zu vereinbaren war.
Anfangs vielleicht, wenn er das Glück hätte, sich in eine Frau zu verlieben, die abenteuerlustig genug war, ihn auf seinen Reisen, die ihn kreuz und quer durch die ganze Welt und bis in die entlegensten Winkel dieser Erde führten, zu begleiten.
Doch spätestens dann, wenn ein Kind da war, würde mit dem Vagabundendasein Schluss sein. Kinder brauchten Beständigkeit. Kinder brauchten eine vertraute Umgebung mit vertrauten Menschen, ein festes Heim, Freunde, Kindergarten, Schule, das ganze Programm eben.
Seit Marius mit vierundzwanzig Jahren seine Studien der Archäologie, Biologie und Geologie beendet hatte, war er ständig auf Reisen. Er hatte sich mit Leib und Seele der Höhlenforschung verschrieben.
Die zum größten Teil noch völlig unbekannte Welt unter unsren Füßen zu entdecken und zu erforschen, das war seine große Leidenschaft. Es würde ihm schrecklich schwerfallen, darauf zu verzichten und irgendeinen normalen Job anzunehmen.
Andererseits passierte es ihm in letzter Zeit immer wieder, dass ihn eine unglaubliche Sehnsucht und Wehmut überkam, wenn er einem glücklichen Paar mit kleinen Kindern begegnete.
Dann malte er sich aus, wie er seinen Kindern von seinen Reisen erzählte, wie er sie für die Schönheit und die Wunder dieser Erde begeisterte, wie er sein Wissen an sie weitergab und sie zu jungen Menschen heranreiften, denen es nicht genügte, in die Glotze oder auf ihr Handy zu starren, wie das heute leider so oft der Brauch war.
Tief in Gedanken versunken, achtete Marius nicht mehr richtig darauf, wohin er trat. Ein Stein brach unter seinem Fuß weg, und er stürzte in die schwarze Tiefe.
Zum Glück nur etwa einen halben Meter weit, denn das Seil, mit dem er sich vor dem Aufstieg gesichert hatte, machte den Fehler wett, der ihn sonst mit absoluter Sicherheit das Leben gekostet hätte. Schließlich hing er in einem Schacht, der rund hundert Meter in die Tiefe führte.
Dennoch kam er nicht ohne ein paar Blessuren davon. Der Gurt, an dem das Seil befestigt war, würde etliche Blutergüsse an seinem Oberkörper hinterlassen. Er pendelte ein paarmal von Wand zu Wand, ehe er einen der stählernen Steigbügel zu fassen bekam, die Tom beim Abstieg in den Felsen geschlagen hatte, und holte sich dabei blutige Schrammen an Stirn und Kinn.
Seine Stirnlampe zerbrach, und es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis die Bruchstücke unten ankamen. Die Geräusche, mit denen sie in der dunklen Tiefe auf dem felsigen Boden aufschlugen, hörten sich hier in der totalen Stille ungewöhnlich laut an und hallten in dem Schacht schier endlos lange wider.
»Bist du okay?« Louis beugte sich besorgt über den Rand des Schachts.
»Nichts passiert!«, rief Marius zurück, und auch seine und die Worte seines Kameraden wurden wie Pingpongbälle von Felswand zu Felswand geschleudert, als ob das Gestein sie nachäffen würde.
Marius Thoma befand sich zurzeit mit einem kleinen Team auf Bora Bora, um dort die innerirdische Welt zu erforschen. Fast zwei Tage am Stück hatten sie in einem zum Teil noch unentdeckten Höhlenlabyrinth zugebracht, das bis weit unter den Meeresspiegel reichte.
Sie hatten jahrtausendalte Wandmalereien entdeckt, fotografiert und zusätzlich abgezeichnet, einen Rucksack mit Gesteinsproben gefüllt und Wasserproben aus einem unterirdischen See entnommen, die sie später in ihrem Camp unter dem Mikroskop untersuchen wollten.
Als er noch ein kleiner Junge gewesen war, hatte man ihm gesagt, dass es auf der Erde keinen noch so kleinen Winkel mehr gäbe, der nicht längst entdeckt, erforscht, vermessen und bis in alle Einzelheiten dokumentiert sei. Doch das stimmte ganz und gar nicht. Im Gegenteil.
Mehr als die Hälfte der Erde wartete noch darauf, entdeckt zu werden. Im Erdinneren gab es unzählige Gänge und Höhlen, die vermutlich noch nie zuvor jemand betreten hatte. Was befand sich unter dem etliche Kilometer dicken Eis in der Antarktis? Und was an den tiefsten Stellen der Meere?
Immer mal wieder wurden versteinerte Knochen gefunden, die keinem bekannten Lebewesen zuzuordnen waren. Es gab noch so viel zu entdecken und zu erforschen. Und der Gedanke daran, an der Suche nach den Geheimnissen und Wundern dieser Welt nicht mehr teilzuhaben, machte ihn ebenso traurig wie der Gedanke daran, auf eine eigene Familie zu verzichten. Was für ein Dilemma!
Doch jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber nachzugrübeln. Er musste sich konzentrieren, wenn er überhaupt noch eine Zukunft haben wollte.
»Das ist nun schon das dritte Mal innerhalb einer Woche, dass du unachtsam bist und einen dummer Fehler machst«, bemerkte der Geologe Louis, als Marius den restlichen Aufstieg endlich geschafft hatte und sich in einer kleineren Höhle auf den felsigen Boden fallen ließ.
Marius nickte, während er noch vor Anstrengung keuchte.
»Ich war in Gedanken.«
»Es ist nicht besonders bekömmlich, in zweitausend Metern Tiefe an etwas anderes als ans Überleben zu denken«, unkte Tom, ein erfahrener Bergsteiger, der immer mit dabei war, um steil abfallende Wände oder Schächte auf ihre Klettertauglichkeit zu untersuchen und für mehr Sicherheit bei Ab- oder Aufstiegen zu sorgen.
»Ich weiß«, seufzte Marius. »Das weiß ich doch.«
»Du denkst doch nicht etwa immer noch ans Aufhören?«
»Unentwegt. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, das Fernweh würde mich umbringen oder mich zumindest trübsinnig werden lassen. Doch der Gedanke, irgendwann einmal einsam und ohne Nachkommen zu sterben, macht mich ebenso trübsinnig.«
»Wozu denn aufhören?«, fragte Louis. »Ich hab doch auch Frau und Kinder und mache trotzdem weiter.«
Marius schüttelte schmunzelnd den Kopf.
»Deshalb fragen deine Kleinen dich auch, ob du Mamas neuer Freund oder der Postbote bist, wenn du alle heiligen Zeiten mal Heimaturlaub machst. So will ich das für mich aber nicht haben. Wenn, dann richtig. Man kann keine richtige Beziehung zu seinen Kindern aufbauen, wenn man sie nur zweimal im Jahr für ein paar Tage sieht.«
»Dann entscheide dich bald mal«, erwiderte Louis. »Manchmal, wenn man zu lange hin und her überlegt, wird man nämlich vom Schicksal selbst vor vollendete Tatsachen gestellt. Und solche Entscheidungshilfen sind meistens nicht besonders angenehm. Es könnte beispielsweise ein Unfall sein, der es dir entweder nicht erlaubt, deinem Beruf so wie bisher nachzugehen, oder der dir einen Strich durch deinen Kinderwunsch macht. Je nachdem, was dir vorherbestimmt ist.«
Marius lachte. »Ach, du immer mit deinen düsteren Prophezeiungen!«
»Lach du nur! Dein Absturz gerade eben, der hätte auch ins Auge gehen können«, konterte der Geologe.
»Unsinn! Ich war nur ganz kurz unachtsam. So etwas passiert mir nie wieder«, behauptete Marius. Noch konnte er ja nicht ahnen, dass er sich da gewaltig täuschte.
»Ich fände es auf alle Fälle jammerschade, wenn du nicht mehr dabei wärst«, seufzte Tom. »Aber wie auch immer, sehen wir zu, dass wir hier rauskommen. Ich möchte endlich wieder Tageslicht sehen und freue mich schon auf einen faulen Tag am Strand.«
»Ich auch«, stimmte Marius ihm zu. »Ich komme mir schon wie ein Grottenolm vor. Oder wie ein Maulwurf. Ein bisschen Sonne auf der Haut und ein erfrischendes Bad im Meer könnte ich jetzt auch gut gebrauchen.«
***
In der Notaufnahme der Frankfurter Sauerbruch-Klinik kämpften Dr. Peter Kersten und sein Team um das Leben einer zweiundsiebzigjährigen Frau, die einen Herzstillstand erlitten hatte und seit rund drei Minuten klinisch tot war.
Eleonore Berndorf war im Münchener Vorort Grünwald zu Hause und hatte geschäftlich in Frankfurt zu tun. Dass es überhaupt noch einen Funken Hoffnung gab, sie wieder ins Leben zurückzuholen, hatte die ältere Dame dem Umstand zu verdanken, dass sie im Grandhotel in der Innenstadt, in dem sie für eine Woche abgestiegen war, einen Weckruf für sieben Uhr und ein Frühstück für halb acht aufs Zimmer bestellt hatte.
Sie hatte mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass sie um acht Uhr einen äußerst wichtigen Termin hätte und man deshalb die Zeiten genau einhalten solle.
Anton Glas, der Zimmerkellner, hatte pünktlich um halb acht geklopft. Erst wie üblich dezent mit dem gekrümmten Zeigefinger und dann etwas lauter mit den vier Fingerknöcheln der geballten Hand. Dann hatte er sein Ohr an die Tür gelegt und gelauscht, ob er vielleicht Wasserrauschen oder sonst irgendetwas hören könnte, was darauf schließen ließe, dass Frau Berndorf im Bad war.
Doch es war totenstill in der Suite gewesen. Er hatte mit der Faust gegen die Tür gehämmert und ihren Namen gerufen. Als auch das erfolglos blieb, hatte er die Tür mit dem Generalschlüssel geöffnet und Eleonore Berndorf in dem kleinen Arbeitszimmer, das zur Suite gehörte, leblos auf dem Boden neben dem Schreibtisch vorgefunden.
Sie war bereits vollständig angezogen und gerade dabei gewesen, etliche geschäftliche Unterlagen durchzusehen. Dabei musste sie einen völlig überraschenden Schwächeanfall erlitten haben und vom Stuhl gekippt sein.
Wie alle Angestellten des Grandhotels, war auch Anton Glas sehr gründlich in Erster Hilfe ausgebildet worden. Er hatte unverzüglich einen Notruf abgesetzt, dann hatte er sofort mit der Herzmassage begonnen und es tatsächlich geschafft, Frau Berndorfs Herz bis zum Eintreffen der Rettungsmannschaft wieder zum Schlagen zu bringen.
Im Rettungswagen hatte sie allerdings erneut reanimiert werden müssen, und in dem Augenblick, als das Rettungsteam die Rolltrage in die Notaufnahme geschoben hatte, hatte ihr Herz zum dritten Mal aufgehört, zu schlagen.
Seit rund zwei Minuten führte Peter die manuelle Herzdruckmassage durch. Das war ein äußerst schweißtreibendes Prozedere, und er keuchte bereits hörbar. Im Rhythmus eines normalen Herzschlags rammte er die Ballen seiner verschränkten Hände gegen den Brustkorb der Patientin und drückte den harten Panzer dabei jedes einzelne Mal etwa fünf Zentimeter tief ein.
»Achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig. Beatmen!«
Dr. Hannes Fischer, der Anästhesist der Notaufnahme, stand mit dem manuellen Beatmungsgerät am Kopfende der Liege bereit und füllte die Lungen der älteren Dame zweimal hintereinander mit sauerstoffreicher Atemluft.
»Soll ich dich ablösen, Boss? Du schmorst ja schon im eigenen Saft und keuchst wie ein kettenrauchendes Walross.«
Dr. Elmar Rösner, der rothaarige Assistenzarzt, wollte Peters Platz einnehmen, doch da meldete der Herzmonitor, mit dem Frau Berndorf verkabelt war, mit einem rhythmischen Piepsen, dass ihr Herz nun wieder selbstständig zu schlagen begonnen hatte.
»Ich kann mir das nicht erklären.« Peter schüttelte seine schmerzenden Hände. »Irgendwas stimmt da nicht. Das ist kein Myokardinfarkt oder sonst irgendetwas in der Art. Ihr Herzschlag setzt einfach aus. Ohne jegliche Vorwarnung. Und es geht zu einfach und zu schnell, sie wieder zu reanimieren.«
»Ja, komisch, nicht wahr?«, stimmte ihm Elmar zu. »Es ist, als ob das Herz einschlafen würde und gleich wieder da wäre, wenn man es aufweckt.«
»Hyperkaliämie?« Der Anästhesist zog fragend die Augenbrauen hoch.
Peter nickte. »Das wäre auch mein Verdacht. Wenn der Blutbefund endlich mal aus dem Labor kommt, werden wir es genau wissen.«
Wie aufs Stichwort wurde die doppelte Schwingtür von außen aufgestoßen, und Jens Jankovsky, der fast zwei Meter große junge Sanitäter der Notaufnahme, betrat den Schockraum mit einem Befund in der Hand.
»Hyperkaliämie! Und zwar astronomische Werte!«
»Niereninsuffizienz?«, schlug Dr. Fischer vor.
Peter schüttelte den Kopf.
»An den Nieren kann es nicht liegen. Die haben wir schon überprüft, die arbeiten normal. Sie muss entweder zwanzig Kilo Bananen gefuttert oder eine Überdosis Kaliumtabletten eingenommen haben.«
»Es könnte sich auch um eine Vergiftung handeln«, gab der Anästhesist zu bedenken. »Mit Digitalis, beispielsweise. Wie heißen diese hübschen Blumen, die Digitalis enthalten?«
»Fingerhut«, erwiderte Elmar. »Aber im Winter wächst doch keiner, und im Blumenladen bekommt man den nicht zu kaufen. Eben deswegen, weil schon zwei oder drei Blätter davon tödlich sein können.«
»Trotzdem ...«
Peter, der zehn Milliliter zehnprozentiges Kalziumgluconat in eine Spritze aufgezogen hatte und nun mit längeren Pausen dazwischen einzelne Milliliter dieses Medikaments in den Venenverweilkatheter der Frau injizierte, hob den Kopf.