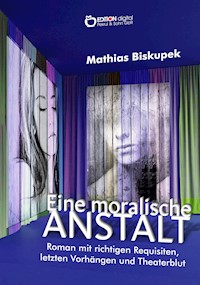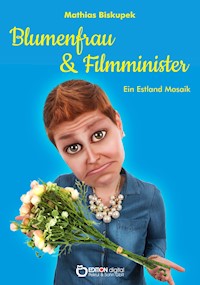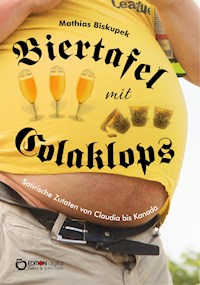7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Bei Biskupek kommt’s knüppelhageldick. Da wird nicht geschmunzelt und geblinzelt, nicht kokettiert und vielleicht gar ein bisschen mitempfunden. Das Buch ist genau, ungemein bösartig und teilweise in der Art, wie der Autor mit höhnisch verzogener Lippe kalauert.“ Sächsische Zeitung „Endlich mal einer, dem die deutsche Wende gut bekommen ist! Mario Claudius Zwintzscher aus Ainitzsch an der Zschopau hat, wie es sich gehört, im Jahre 1989 seinen ersten demokratischen Wahlkampf mit Hilfe des sächsischen Nationalstolzes gewonnen.“ Süddeutsche Zeitung „Das Buch, das die tierisch-ernsten Wendewälzer aus den Regalen fegt.“ Takt, Leipzig
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
Matthias Biskupek
Der Quotensachse
Vom unaufhaltsamen Aufstieg eines Staatsbürgers sächsischer Nationalität
Roman
ISBN 978-3-96521-475-0 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien 1996 im Gustav Kiepenheuer Verlag.
Dieses Buch wurde durch die Stiftung Kulturfonds gefördert.
2021 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Lehmseife und Fragebogen
Es geht mir verdammt gut, und das ist nicht gut so.
Normalerweise ist das Leben wie eine Verkehrsampel. Es leuchtet sehr lange rot und lange gelb und ziemlich kurz grün. Bei mir aber dauert die Grünphase schon viel zu lange, und das kann, das darf eigentlich gar nicht gut gehen.
Irgendjemand müsste mir doch von rechts in die Quere kommen oder meinetwegen auch von links: vorwärts ein Ruck; rücklings der Druck – ich will das bitte überhaupt nicht politisch verstanden haben. Ich bin, wenn es erlaubt ist, wahlfreudig, mediengestählt, aber parteipolitisch tolerant. Obwohl ich auf gesellschaftlich vorgeschobenem Posten ausharre. Denn mein Ausschuss zur Bekämpfung Unsolidarischen Verhaltens ragt aus der allgemeinen Gleichgültigkeit heraus. Der Aufprall des Ausschusses auf die gemeine Realität ist längst überfällig.
Ich komme aus einem gruseligen Staat und lebe in einem angesehenen Land. Ich wundere mich nur, warum das Programm des Niedergangs bei mir versagt. Eine Grünphase löst die nächste ab; ich weiß gar nicht, wie all die anderen zwischen meinen langen lindgrünen Gelegenheiten über die Kreuzung huschen können. Es muss doch mal krachen. So viel Geduld kann niemand mit mir haben.
Mein Leben begann bereits unnormal schön. Blauer Himmel und nirgendwo eine Klimakatastrophe am Firmament. Sie sollten sich das mal anhören:
Als ich dieser Welt meinen ersten guten Tag wünschte, hatte Sachsen über sechs Millionen Einwohner. Die stellten rote, brüchige Ziegel her, zum Aufbau, und klein karierte Baumwollstoffe, zum Einkleiden. Die Straßenbahnen fuhren zwischen spitzen Trümmerbergen herum, weil die Sachsen wieder mal auf der falschen Seite gekämpft hatten. Bei der Schlacht von Mühlberg hatten wir diese saublöden Niederlagen schmalkaldischen Lutheranern und im Siebenjährigen Krieg unfähigen Österreichern zu verdanken. In der Völkerschlacht bei Leipzig kämpften Franzmänner und Rheinländer uns in die Katastrophe. Die Preußen zwackten damals genüsslerisch einen riesigen Flatschen Sachsen ab und hocken bis heute auf solchen Perlen wie Jüterbog, Belzig und Treuenbrietzen. Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg waren es dann die Deutschen, denen wir unser nationales Unglück zuzuschreiben hatten. Wieder war ein Zipfelchen Sachsen weg und diesmal bei den Polen gelandet. Hätten die Deutschen den Hitler nicht gewählt und nicht diese dämliche, holprige Autobahn voller Engstellen, Baustellen und Unfallstellen quer durch unser Land von Meerane im Westen bis Bautzen im Osten geschlagen, dann würde bis heute alles schneller vorangehen.
Doch als Sachse meckert man nicht, sondern gniedschd höchstens. Drum gniedschde mein Vater auch, als meine Mutter zu entbinden hatte, im Landesfrauenkrankenhaus zu Leipzig. Er sollte sich alleine was zu essen machen, zwo Spiegeleier in die Pfanne schlagen, aber es war die Zeit, als Spiegeleier in Sachsen ausgesprochen selten in Pfannen wuchsen.
Die Nullserie ihrer Familienverplanung hatten meine Eltern schon zwei Jahre vor mir hergestellt, einen typischen älteren Bruder, rechthaberisch, musikalisch, laut, beflissen, duckmäuserisch, hochintelligent und mich begeistert als Spielhäschen begrüßend. Wäre er eifersüchtig gewesen, hätte er mich geknufft und verklappst, hätte meines Lebens Kurve ganz andere Beulen und Senken bekommen. Doch er war begeistert. Und wartete bei der Nixenweg-Oma sehnsüchtig auf mein Eintreffen.
Ich kann mich nicht mal dunkel erinnern, ob ich ordentlich abgenabelt wurde und das Brusttrinken exakt erlernt habe. So was ist ja wichtig zu wissen, damit man dem Psychologen etwas mitzuteilen hat, falls man Nägel kaut, beim Anblick von Miederwarengeschäften zu schwitzen beginnt oder unter dem Einfluss von Resedaduft unbedingt frischgebackene Dreipfundbrote anbeißen will. Resedaduft habe ich erst später wegen des ihm innewohnenden SEDADU als etwas Merkwürdiges wahrgenommen; ich müsste da von jener Geschichte, wie ich „Mama am Ofen“ schreiben wollte, berichten. Vielleicht heißt sie auch „Mama am SEDADU“, und vielleicht komme ich noch dazu. Damals jedenfalls bin ich mit duftloser Lehmseife gewaschen worden, einer Seife, die sich quasi gewaschen hatte. Rau aber herzlos. Keine Kernseife, mit der wir jetzt umweltverträglich schrubben. Gute Seife war Westseife, doch die hieß damals noch nicht so, weil es sie noch überhaupt nicht gab und der Westen bloß im Westen lag. Sechs Millionen waren wir in Sachsen, die keine Westseife kannten. Von den sechs Millionen dürfte fast eine Million aus Schlesiern, Sudetendeutschen, Balkantypen, Halbrussen, Ganzpolen und Opankenheinis bestanden haben. Oder zwei, drei, sieben Millionen? Die Hälfte dieser Bezeichnungen habe ich damals übrigens weder ausgesprochen noch im Wortspeicher bereitgehalten, denn ich war im Babystatus als politisch korrekt bekannt, hegte in meinem süßen Nuckelschlaf keinerlei Rassenvorurteile. Im Gegenteil, ich war sogar ziemlich dunkel behaart, was mit der südsächsischen Herkunft meiner Mutter, deren Vorfahren aus den schwarzen Wäldern des Vogtlandes stammten, zu tun haben dürfte.
Meine Geburt fand im Oktober statt; ich bin ein Kind der Kartoffelernte, im Sternzeichen der Waage angetreten, wie jene Republik, die zwei Wochen vor meiner Geburt im fernen Berlin vom Präsidenten Wilhelm Pieck und dem Sachsen Walter Ulbricht gemacht worden war. Dies muss mich damals schon beeindruckt haben, denn zum Zwecke der Veraktung meines Lebenslaufs wurde mir ein Fragebogen auf den frischen, roten Bauch gelegt. Ich trug jenen Bogen gar friedlich, wie später alle Verwaltungsauflagen, und krähte meine Zustimmung dazu leis ins Krankenzimmer. Der Bogen war so groß, dass man mich hätte darin einwickeln können, er verkörperte noch gute Friedensware mit geschwärzten Stellen. Das Hakenkreuz am oberen Ende war mit einem scharfen Schnitt ein für alle Mal abgetrennt worden. Ein für alle Mal. Vermutlich bin ich später sehr oft mit Fragebögen eingewickelt worden, was ich nicht beklagen, nur wahrheitsgemäß auflisten möchte.
Kaum war ich jedenfalls da, wurde der Bogen mit guter deutscher Sütterlinschrift ausgefüllt: Religion: evangelisch. Beruf: ohne. Besonderes Kennzeichen: brüllt kaum. Muttersprache: sächsisch. Vaterland: kaputt. Appetit: befriedigend. Ohren: stramm angelegt. Alter: wenige Minuten. Geschlecht: Zipfel. Versorgungsstatus: Lebensmittelkarte einfach, mütterlicherseits. Patriotismus: noch unausgebildet. Windel: Vorkriegsware. Name: Mario Claudius Zwintzscher.
Slawische Stammbäume und erzgebirgische Baumstämme
Ich werde es sogleich ausplaudern. Wie ich zu diesen klangschönen Vornamen kam. Meine späteren Popelkameraden, die ich im Sandkasten kennenlernte, hießen Siegmar und Klaus, Brigitte und Peter, Christel und Evi oder bestenfalls Evelyne, scheu angesprochen mit Ehvelühne. Doch mir war nicht nur ein Vorkriegsfriedenswarenfragebogenexemplar in voller Länge in die Wiege gelegt worden, sondern auch jener Name, den ich später gern vorgehalten bekam. Als Beweis meines Internationalismus, meiner klassischen Bildung und meiner zwar nicht angeborenen, aber doch seit der Geburt untrennbar mit mir verbundenen Lust auf schönen Gleichklang. Ich, Mario Claudius, war der Beleg für eine Aufhebung des alten Unterschieds zwischen Schönheit und Funktionalität, zwischen Anmut und Mühe. An mir war ästhetisch nicht gespart worden, fürwahr: Ich hieß schon 1949 so, wie das bessere Deutschland erst noch werden sollte. Mario Claudius Zwintzscher. Internationalistisch, aber klassisch gebildet. Südlich der Klang, Spanien und Italien paarten sich hier, Partisanen bella ciao; doch nordisch-lüneburgisch, heidnisch fast, tönte der Dichter des Liedes vom aufgegangenen Mond heraus: Matthias Claudius. Östlich murmelten die Zischlaute in meinem Nachnamen, doch westlich-dreifaltig mutete das Ganze an – fast wie eine heute moderne, rassisch-klassische Namensbezeichnung mit Bindestrich. Schwungvoll und vokalreich. Dabei war meine Herkunft so bodenständig, wie mein Name Zwintzscher klang. Aufgemerkt nun also:
Unsere Sippe, deren weibliche Mitglieder man de Zwindschorn ruft, während bejahrte männliche Namensträger dor olle Zwindschor heißen, ist groß. Die Frauen der Sippe waren fruchtbar und schickten sich, während die Männer das ihre in die Frauen schickten. Heute appellieren die Weltwachstumsberichte an unsere Disziplin, und also disziplinieren wir uns: scheu, einzelkindhaft.
Einzelkindhaft, verkürzt: Kindhaft. Ein längeres Nachdenken wäre an dieser Stelle angebracht. –
Doch Näheres mag ich nicht ausführen, später vielleicht …
Unser Geschlecht jedenfalls wuchs und wuchs, gewaltig sich verästelnd, die dunklen Flusstäler der sächsischen Berglandschaften hinauf. Wilde Erzgebirgsbäume mussten Platz machen, wenn sie es auch nur wagten, einem Zwintzscher scheel im Wege zu stehen. Alsbald fielen die Hölzer ächzend beiseite. Die Baumleichen wurden als Brücken und Donnerbalken betreten und besessen. Seit es Kartoffelnahrung für die ganze Familie gab, starb man auch am Südrande Sachsens nicht mehr so fliegenhaft. Bis zum Kamm zwischen Lausitzer Bergland und Vogtland schoben sich die Zwintzschers und die Nitzsches und die Gruschwitzens und die Lommatzschens hinauf, bis zu jenem Kamm, hinter dem es steil bergab, jetzt ins Tschechische, geht, also ins wiederum Slawische und Zischlautende. Sie müssen sich vorstellen, dass im Dorfe Oberbobrutzsch/Erzgebirge, dem Herkunftsort meines Vaters, allein auf der linken Seite der Hauptstraße heute noch sieben Zwintzschers wohnen. Die auf der rechten Seite dieses hübschen Straßendorfes – wirklich hübsch übrigens, neulich musste ich eine eindringliche Rede dort halten – abgehende Berggasse hat zwar nur noch zwei bewohnte Häuser, aber in beiden hausen ebenfalls Zwintzschers. Nicht alle sind Verwandte väterlicherseits. In den Orten Crossen/Sachsen, Cranzahl, Crimmitschau und Chemnitz gibt es so viele Zwintschers oder Zwintzschers wie anderswo Mc-Donalds-Versorgungseinrichtungen. Gelegentlich sind die Zwintzschers auch arg verschliffen und unkenntlich gemacht worden, als Tschontschners, Zschirners oder gar Schachtschabels. Selbst der lang schon verstorbene österreichische Kanzler Schuschnigg ist nur die austriazistische Verballhornung unserer altehrwürdigen Namenswurzel, von der man annehmen muss, allein ein polnischer Landedelmann, ein solcher mit hängendem Schnurrbart und traurigen Augen, könne sie auf elegante Weise von Z bis R richtig lautbildnern. Es laufen mitten durch das hautpstädtische Berlin bis heute Leute, die sich Szczycziel schreiben und Schischiehl aussprechen lassen, während ein echter Zwintzscher sich bei heimattypischer Aussprache immer mit einem or auslauten lässt: Zwindschor! Ich deutete es schon an.
Falls meine Betrachtung langweilt, so will ich schnell entschuldigend einfügen, dass meine Funktion mich heute auch zu Entscheidungen über zeitgemäße Orts-, Straßen- und Flurnamen befugt. Wie sollten wir also in dieser großen Epoche der Veränderungen nicht auch die Namen kritisch hinterfragen und auf Verfälschungen durch vergangene Gewaltherrschaften hin abklopfen? Ein jeder Zwintzscher kann sich Zwindschor, mit kurzem, halbgeschlossenem or nennen, weiß er doch, dass er ein „Grünling“ ist, auch Grienling, ein Pilz, der in den Erzgebirgswäldern leicht mit dem Grünen Knollenblätterpilz zu verwechseln ist. Die Verwechslung ist zumeist einmalig.
Meine Sippe wird schon 1390 als Zwintzer erwähnt, obschon Weinbau im rauen Sachsen nur eine kurzlebige Modeerscheinung war. Hundert Jahre später sahen wir wieder sehr polnisch aus: Zcwintscher. Also rief meine Mutter auch erstaunt, als ich bald nach der Geburt die Äuglein aufschlug und sie anblinzelte: Ein echter Zwintzscher! – vielleicht hatte sie auch A äschdor Zwindschor freudestrahlend von sich gegeben. Denn natürlich wusste sie, dass unser Name sich von „zwinzen“ ableitet, was blinzeln bedeutet. Hingegen kam meinem Vater, als er mich erblickte, sogleich Na sau ä Zwunsch über die Lippen, was „Grünling, im Wachstum zurückgebliebener Mensch“ bedeutet und worauf der weniger stolze Zweig der Zwintzschers unseren Namen zurückführt. Jener Sprachprofessor Gunter Bergmann-Pohl aus dem „Haus des Deutschen Dudens“ zu Mannheim hingegen, der vor allem deswegen an meinem Kinderbettchen nicht erschien, weil meine Eltern zu unbegabt waren, ihn zu kennen, hätte halblaut das slawische „twarc“, also Quark!, gemurmelt und hinzugefügt, dass man doch deutlich sehe, dass dieser Grünling des Sachsengeschlechts, jener neue Menschenzwerg, vom Geburtskanal verdrückt, gequetscht und gefältelt, allein von „twerch“, also „schräg, verkehrt“, berechtigt sei, seinen Namen Zwintzscher herzuleiten.
Ich Zwunsch zwinzscherte also in die Welt. Etwas twerch.
Die Welt schaute ebenfalls twerch. Und zwinzscherte gleichermaßen zurück.
Da mochte ich zum ersten Male ahnen, dass schräges Blinzeln in meinem Leben jene Sichtweise sein mochte, mit der ich am besten in dieser verkehrten und etwas derangierten Nachkriegswelt, oder wie man in Sachsen sagte, zerwerschdn Gehschnd, zurechtkommen würde.
Ainitzsch an der Zschopau
Eine zerwerschde Gehschnd, das war wohl damals meine Heimat. Obwohl die Trassierung und Parzellierung von Wald, Wiese, Wasser mit Verbundleitungen der Freundschaft, mit Transportsträngen der Energiegiganten und mit Asphaltschneisen per Beschleunigungsgesetz für deutsche Einigkeit erst noch bevorstanden.
Die Gegend war, wie man in Sachsen gemeinhin sagt: behämmord (Bergbau), beglobbd (Eisenwaren), versponn (Textilindustrie) und vor allem erre (Gesundheitswesen).
Mein erstes Krankenhaus stand in Leipzig, eine ostzonale Geburtsfrauliche Hilfsklinik, wie mein Mitstreiter beim Ausschuss zur Bekämpfung Unsolidarischen Verhaltens, Dr. Schneider-Schußter, abfällig sagen würde. Mein Geburtsklinikort hatte mit Oma zu tun. Oma wohnte im Leipziger Nixenweg und beaufsichtigte, während ich den dunklen Weg ins Licht absolvierte, meinen gutartigen älteren Bruder Dietrich Gustav Zwintzscher, den Diddi. Auch konnte die Oma der jungen Mutter mit Tipps und Tricks beistehen; mein Vater musste seine Tricks hingegen beim Aufbau der jungen Republik einsetzen. Denn in jenen dunklen Jahren war Kinderkriegen noch eine rein weibliche Angelegenheit. Väter wurden erst zur Aufzucht des Nachwuchses herangezogen, wenn es galt, das schwierige Wort „Birne“ richtig auszusprechen und eine Entschuldigung zu formulieren, warum man nicht für eine Berufsoffizierslaufbahn geeignet sei.
Zurück zu meinen Anfängen, meinem ersten Ortswechsel: von der Leipziger Klinik wurde ich mit einem Kraftwagen ins zukünftige Heim verbracht, eine alte, aber überhaupt nicht zerschossene Villa in der Lessingstraße. Mein Vater hatte die Fahne der frischgegründeten DDR, damals noch schlicht schwarz-rot-gülden und von Hämmerkränzen und Ährenzirkeln ungeziert, zum Fenster hinausgehängt, so dass meine Mutter sacht verschämt dem Kraftwagenfahrer sagen konnte:
Haldense da, wo de Fahne naushängd … Unser Patriotismus flatterte immer zum Fenster heraus.
Die Lessingstraße war eine villengesäumte Allee aus jenen Tagen, da in meinem Heimatort die Industrie herrliche Gründerzeiten erlebte. Namensgeber Lessing, jener echte Sachse aus dem großartigen Kamenz, war leicht zu verwechseln. Meinen späteren Freunden, allesamt Mitglieder der Sandkastenpopelgruppe, ging es ähnlich. Lessing oder Messing, so hieß die kindliche Frage. Von ersterem gab es genug im brotarmen Nachkriegsland. Großväterliche Bücherschränke hielten ihn sorgsam hinter Glas. Um letzteres aber rankten sich kriminalistische Aktionen, Besorgungszüge, Tauschhandel. Heute, da ein lernfähiger Angehöriger der deutschen Großraumlande höchstens Leasing mit Lessing verwechseln würde, versteht wohl kaum jemand meine messingglänzenden Erinnerungen – es gäbe manch Stücklein zu erzählen von schwarzen Buntmetallschiebern aus jenen vom Winde der Geschichte bewegten Anfangsjahren. Als ich Lessing- und Messingstraße noch nicht auseinanderhalten mochte und meine Stadt vom Sozialismus unversehrt am Fluss hockte:
Ainitzsch an der Zschopau
Es wird gern mit Ainitzsch an der Freiberger Mulde verwechselt. Unser Ainitzsch an der Zschopau. Dabei sind wir älter, ruhmbedeckter und geschichtenbelasteter. Das andere Ainitzsch ist nur um ein paar läppische Einwohner größer. Im Zuge der sächsischen Verwaltungsreform könnte das ferne, das feindliche Ainitzsch weiteren Boden gutgemacht haben – doch manches schon konnte ich in meiner Funktion gegen die jahrhundertelange Benachteiligung unseres Ainitzschs an der Zschopau unternehmen.
Mein Ainitzsch liegt zentraler als alle anderen Ainitzschs: Verbinden Sie die drei großen Städte Leipzig, Dresden und Chemnitz mit Geraden. Wo befindet sich der Schwerpunkt jenes magischen Sachsendreiecks? Exakt auf dem Ainitzscher Marktplatz; vielleicht noch ein Stück in die Reußnitzer Straße hineinreichend, falls der Schwerpunkt, nicht klassischer Geometrie entsprechend, ein flächendeckender Hektar sein könnte. Von diesem gepflasterten Hektar sind es je 66 Kilometer bis Dresden und Leipzig und 22 Kilometer nach Chemnitz. Oder waren es zumindest damals, als es noch keine Umgehungsstraßen gab, sondern Hauptstraßen wichtige sächsische Marktplätze berührten.
Die Zschopau schlägt um Ainitzsch einen anmutigen Bogen. Genau so schlug sie ihn immer, recht zierlich altertümelnd wie diese Redefigur: einen anmutigen Bogen schlagen. Der Stadtbach, den wir hier von altersher die Bach nennen, fließt unter Ainitzsch durch. In zementenen Röhren mied er das harte, sonnige, sächsische Licht der Nachkriegszeit. Und in den Röhren hausten gruselige Ratten. Ungeheuer in Tiergestalt. Geschwänzte Gespenster.
Es war eine Mutprobe, eine dieser Rattenröhren zu durchlaufen. Zumal es verboten war. Bestimmt war es verboten. Auf jeden Fall war es das: Streng verboten! Man erinnere sich: Ich wuchs auf in einem Lande, in dem alles, was nicht ausdrücklich erlaubt war, als verboten galt. Es konnten ja Erwachsene kommen und brüllen: Was machdom da! Bei die Raddn! In dor Bach! Sohford gommder nauf! Abor zaagg-zaagg!
Dann krauchte man zaagg-zaagg und ziddomd hinauf. Vor groß aufragenden, ausgewachsen-ausgebeulten Manchesterhosenmenschen fühlte man sich selbst als Ratte. Denn es ist nicht zu übersehen: In den frühen Fünfzigerjahren, in denen sich die Dreijährigen zwischen Leuthaussen/Rhein und Schnarrenberg/Donau heimlich darauf vorbereiteten, chorisch „Ho! Ho! Ho-Chi-Minh! – Unter den Tala-Ren! Muff von Tausend Jah-Ren!“ zu rufen, auf dass diese Losungen in fünfzehn Jahren gehört und in vierzig Jahren in allen Redaktionsstuben wie ein Aufschrei nach Aufarbeitung gefeiert würden; zu dieser Zeit floss in dor Bach zu Ainitzsch nur Wasser, und feige Dreikäsehochs schlotterten, wenn sie den Kommandoton Abor zaagg-zaagg! vernahmen.
Ainitzsch übrigens ist auch auf Kommando entstanden. In die düsteren Mittelalterwälder, welche am Nordabhang des Erzgebirges Miriquidi hießen, war schwer hinein- und kaum herauszukommen. So geschah es, dass mitten im Walde Handelskarawanen sich aufs Überwintern einrichten mussten. Da hieß es dann: Handelswagen, aauseinaaanderziehen! Vorn rechts schweenkt! Und aufschließen! Und wieder reechts! Und reechts! Und wenn die Handelswagen dann wie bei einer Polonaise eine Weile im Kreise herumgeholpert waren, was man im Sächsischen über alle Maßen liebt, hieß es Haalt! Gleich einem Burgwall standen die Wagen sodann im trauten Rund, in dessen Mitte bald ein lustiges Feuer flackerte, Zelte aufgebaut und Erdlöcher gegraben wurden. Sogleich wuchs die Bevölkerung, und der Wald ließ sich knurrig (oder knorrig?) roden. Wo einst das Feuer geflackert hatte, dehnte sich der Marktplatz, wo Zelte aufgebaut waren, protzten Bürgerhäuser mit rötlichbraunen Rochlitzer Porphyrkonsolen. Erdlöcher wurden zu Scheunen und Schmieden ausgebaut und später zu Vereinsgaststätten der SG Einheit Ainitzsch.
Eine andere, wohl volkstümlichere Version der Namensherkunft von Ainitzsch besagt, dass der meißnisch-sächsische Herzog, vielleicht auch sein schönburgischer Vasall Dedo der Feiste, während einer Rast im tiefen Walde seinem Mundschenk nachrief: Ei! Nitsche! Wenn Ihr mir jetzt einen guten Trunk schaffen könnt, so soll Euch dies Waldstück zum Lehen gegeben werden. Nitsche fand die Quelle, und später in Einitsche oder Ainitzsch seine letzte Ruhestätte im Kreise der Grabsteine vieler Angehöriger.
Der Ort dämmerte durch dreißigjährige und siebenjährige Kriege, schon damals wurden die Felder nur noch für den Alten Fritzen bestellt wie heute für EG-Kommissare. Zu Napoleons Zeiten schlief Ainitzsch fast ein, da die Commandantur im benachbarten Franken(!)berg errichtet wurde, so wie hundertvierzig Jahre später die Komendatura im noch weiter entfernten Reuß(!)nitz, denn jeder Besatzungsmächtige liebt die Heimat in der Fremde, ob Franzmann oder Reuße. Bei der Achtundvierziger Revolution sammelte der progressive Kleinbürger Tzschirner auf dem heutigen Ainitzscher Tzschirnerplatz eine Kampfgruppe tatendurstiger Handwerkersöhne zum Marsch auf Dresden; bevor man dort ankam, war die Revolution bereits gewonnen, und bevor man wiederum Ainitzsch erreichte, hatte die Konterrevolution mit Preußens Hilfe den sächsischen König erneut auf den Thron gehievt. Richard Wagner, Bakunin und weitere bedeutende Sachsen besiedelten schnurstracks das Ausland, und die Ainitzscher Stadtoberen empfanden es als diplomatischer, bei dem ganzen Demoschlamassel lieber nicht dabeigewesen zu sein.
Dann aber kam Ainitzschs große Stunde: Die Textilindustrie schob sich die Flusstäler hinauf, ganz so, wie lange zuvor der Name Zwintzscher; es klapperten die Weberschiffchen und es rasselten die Ketten der Proletarier; ein Technikum gar, eine private Ingenieurlehranstalt nämlich, erhob sich bald auf dem einstigen Galgenberg der Stadt. Die Straßen reckten sich hinaus ins Heimatland, die Mühlen wurden zu E-Werken, backsteinerne Essen schafften den vertikalen Ausgleich zu horizontalen Gewerbeansiedlungen; die erwähnte Bach vorgriemelde sich damals in neimodschen Reehm. Bismarck kam zu Besuch; Bismarckeichen, Bismarcklocken und Bismarckheringe zeigten später wachsenden Wohlstand an. Ein gewisser Bäcker Weidenhammer begründete sein Geschäft, das später historische Bedeutung erlangen sollte; der Erste Weltkrieg schuf ein Kriegerdenkmal, und der Zweite rief die Amerikaner herbei, die sodann vierzig Jahre als Befreibesatzer galten, obgleich sie alsbald abgelöst wurden von den Befreiungsfreunden auf Panjewägelchen, die das Sachsenland mit Russischunterricht, dem angenehmen Spruch Nu budjet und roten Fünfzacksternen auf volkseigenen Betrieben zivilisierten.
Dann aber kam die Zeit, der ich nicht vorgreifen möchte, wo das sächsische Lot wieder ein sächsisches Lot sein durfte, – wir arbeiten im Ausschuss zur Bekämpfung Unsolidarischen Verhaltens gerade daran – und sich bayerische Katholiken und württembergische Protestanten um hoch bezahlte Würden auf allen sächsischen Ebenen stritten. Doch darf ich jetzt zu meiner Einschätzung, meiner Geschichte und meiner Sprache zurückkommen, in die Lessingstraße zu Ainitzsch?
Familienbande. Familienbande. Und alle gemeinsam im Chor: Familienbande!
Wissenschaftlichen Forschungen zufolge hat unverdientes Glück im Leben etwas mit jenen schwarzen oder lichten Wäldern zu tun, in denen wir uns als Kinder tummelten.
Ainitzsch hatte einen Stadtpark, in dem Messerbösewichter ihr Unwesen treiben sollten; die Rattenröhren und die Manchesterhosenmenschen mit ihren Zaagg-Zaagg-Befehlen erwähnte ich schon. Aber Ainitzsch hatte eben auch die Familie Zwintzscher mit ihren Gliedern Vater, Mutter, Kind (älterer Bruder), Kind (ich) und Kind (jüngerer Bruder).
Das Glück hielt mich also vollkommen umschlossen:
Meine Mutter stammte aus dem Nixenweg am Südrande Leipzigs. Ihre Vorfahren kamen vom Südrand Sachsens. Folglich war für mich schon als Büblein-klein klar, dass meine Mutter eine südländisch wirkende Schönheit sein musste. Sie hatte in der Tat einen sanft südlich-dunklen Teint und tiefschwarzes Haar, obwohl ihr Mädchenname Fleischer lautete; Madeleine Fleischer.
Teint und welscher Vorname machten sie in den Zeiten, als Sachsen lustvoll unter dem Joch des Österreichers und der mit ihm verbündeten preußischen Nazis stöhnte, für ihren Klassenlehrer zum Vorzeigeobjekt einer dinarischen Rasse, welche durchaus noch als völkisch deutsch galt. Ein Arisch, dem eine DIN-Normung vorgesetzt war. DIN-Arisch war eben nicht hellblond-nordisch und auch nicht dunkelblond-westisch. Es stand wohl auf einer Stufe mit dem Ostischen, dem slawisch verunreinigten Deutschen. Solches tummelte sich in Sachsen zuhauf, hatten doch sächsische Fürsten einst den Hochmut besessen, ihre diggn Nischl unter die polnische Krone zu zwängen. Und spricht nicht bis heute manch Sachse so weesch und zischlautend gliddschisch und wurschdisch, als sei er auch des Polnischen mächtig? Mein Vater trug zwar, wie ich schon ausplauderte, den auf gute sächsische Wurzeln gründenden Namen Zwintzscher-Helmut, seine Mutter aber hieß Szyczawski und deren Mutter Milkuschitznik. Weitere Verwandtschaft wurde nicht genannt; sie verlor sich aber wohl immer unaussprechlicher in oberschlesischen Bergen und galizischer Hundetürkei.
Die lange Ahnenreihe meiner Mutter hingegen konnte laut vogtländischen, böhmischen und oberfränkischen Kirchenbüchern stolz vor jedem arischen Ahnenschnüffler in Reih und Glied stehen: die Fleischers und Kassingers, die Haedlers und Buttelstedts, die Rückerswaldes und Kohlmeisels. Doch das Aussehen, besonders der weiblichen Familienmitglieder, ließ irgendeinen mit welscher Leidenschaft eingekreuzten Kesselflicker, Scherenschleifer oder Seiltänzer vermuten. Wie einst meiner Mutter von Opa Robert eingebläut wurde: Geh blohs ni hei de Zischeiner – die grabbschn disch glei weg, so wurde auch mir väter- und mütterlich bedeutet, wenn ich mich zu sehr einschmutzte beim Sandkastenspiel: Disch wern se glei middm hungerndn Indorgind vorwechsln.
Bei meinem Bruder Dietrich Gustav, dem Diddi, war das vermutete Zigeunerblut weniger auffällig. Er hatte einen großen, ostisch runden Kopf (Szyczawski! Milkuschitznik!), aus dem sich sanfte, braune Locken ringelten; ein großer und großartiger Bruder, der nur den kleinen Fehler hatte, den Kollektivismus des eben gegründeten Staates bis in die kleinste Zelle, die Familie, durchsetzen zu wollen. Ich wurde, eben der Landesfrauenklinik entkommen, als gewindelter Spiel-Ball entdeckt und in all seine Unternehmungen einbezogen. Kaum konnte ich ein so schwieriges Wort wie „Möbelwagen“ trotz der darin vorkommenden B-L-Häufung aussprechen – Sie werfen ein, es gäbe in diesem Wort lediglich ein B und ein L, von Häufung könne also keine Rede sein? Vermutlich haben Sie zum Möbelwagen immer schon Umzugstransporter oder Expressfrachtcontainer gesagt, können also weder über B noch über L je geschdollbbord, also gefallen sein – … Kaum also war ich dem Alter, in dem ich vermutete, der Mensch habe in seinem Leben nur eine gewisse Menge an Sprache zur Verfügung, irgendwann leere sich dieser Speicher und stumme Leute hätten eben in früher Jugend schon alles herausgeplaudert – vielleicht hatte diese Erkenntnis auch mein großer Bruder in mich gepflanzt, wenn er mal seine Ruhe haben wollte, obwohl er als kollektivliebendes Wesen diese eigentlich nie wollte … Kaum – jetzt muss ich zum dritten Mal beginnen, habe aber keine Lust, ein viertes Mal von eigenen Gedanken gestört zu werden. Jedenfalls musste ich, als mein Bruder eingeschult wurde, am Nachmittag mit bei seinen Schularbeiten sitzen und ihn bei der Aufgabenlösung bewundern – alleine hatte er keine Lust. Ich bewunderte nach Kräften, hatte ich doch große Glubbschoochn, die ich bei Bedarf noch herausschraubte, so dass mein Bruder ob dieses Strahlens überaus zufrieden war.
Möglicherweise kompensierte das die bei seinen Lehrern nicht in so reichem Maße vorhandene Anerkennung; ich war damals sein allerliebster, allerbester kleiner Bruder, da ein weiteres Brüderchen erst Jahre später in unser beider Leben treten würde. Der mir für mein strahlendes Zuschauen zuteil gewordene Lohn war die Tatsache, dass ich plötzlich lesen, schreiben und rechnen konnte, und sogar dividieren, was schwerer war als alle anderen drei Fähigkeiten zusammengenommen. Ich kann also nichts über jene Probleme mitteilen, die z.B. bei einfacher Silbenreihung hervorgerufen werden. Mochte meine Generation auch unter dem Joch des sich herausbildenden sozialistischen Schulwesens stöhnen, bei mir häuften sich die Einsen, und unter den Hausaufgaben wimmelten lange blaue (gute) Striche. Ganz selten setzte es mal ein kurzes rotes (böses) Strichstück.
Doch bevor ich zur Schule mit ihren farbigen Strichen ging, musste ich noch manch andere Prüfung überstehen. Meine Mutter sang ausgesprochen gern; den familiären Chorgesang aber liebte die Höhere Tischlermeistertochter Madeleine Fleischer inbrünstig. Und so mussten auch die beiden ihr geschenkten Söhne fleißig bei vorweihnachtlichen Familiengesängen mittun. Vorweihnachten begann bei uns im Januar und hatte seinen Höhepunkt in den folgenden elf Monaten. Diddi war natürlich hochmusikalisch; meine Stimme hingegen brummte eher in den Niederungen der Gitarren-E-Saite. Im Frühtau gingen wir familiär zu Berge, wenn am Morgen die Hähne krähten, bis sich der Tag nun zur Ruh legte und der Mond aufgegangen war mitsamt den prangenden Sternlein. Am ererbten Klavier saß meine Mutter, an der mühsam vom Munde abgesparten Gitarre gab mein Vater den Akkord an. Der schöne Alt meiner Mutter war immer dabei; der, wenn auch etwas dünne, so doch klangreine Tenor meines Vaters stützte ihn, der lieblich-knäbische Sopran Diddis jubilierte wie die Lerche hoch da droben, und ich hätte vielleicht den Generalbass geben müssen, aber da ich von klein auf alles auch immer unter ästhetischen Gesichtspunkten wertete – im Ausschuss zur Bekämpfung Unsolidarischen Verhaltens wird mir dies nicht selten zum Vorwurf gemacht –, unterließ ich das stimmhafte Mitsingen, sondern klappte nur willig und überdeutlich meine Schnute tonlos auf und zu. Da ich im Unterschied zu Diddi die Liedtexte fehlerfrei beherrschte, passierte es öfter, dass dessen Sopran fragend aussetzte, meine Flüsterstimme aber weiter den Ton ohne Ton angab. Übrigens kehrte dieses Verhalten bei meinen Eltern anders wieder: Mein Vater summte den Text ab der zweiten Strophe nur noch mit; meine Mutter aber hielt laut und klangrein selbst bis zu martialischsten Textschlüssen durch. Man denke nur an das acht Jahre nach Kriegsende recht froh tönende Weihnachtslied „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ mit den inständig bittenden Schlussversen „Fahn und Säbel und noch mehr/ Ja ein ganzes Kriegesheer/ möcht ich gerne hahahahaben“. Ein wenig klopfte das Herze beim Absingen solcher Zeilen, denn Kriegsspielzeug war für uns Brüder damals eine solch verbotene Verlockung wie heute vielleicht Marihuana für die mit Macht heranwachsende Generation.
In den ersten Liederbüchern der Jungen Pioniere „Kommt, singt mit“ gab es problematische Weihnachtslieder nicht, erst in späteren Auflagen hieß es dann gar festlich „Mein Bruder ist ein Panzerfahrer“ und „Grün ist unsre Waffenfarbe“.
Zwintzscher-Helmut, wie mein Vater von verwandtschaftlichen Erzgebirglern genannt wurde, die mit Vorliebe zu Geburtstagen in die Lessingstraße kamen und große Kuchenstücke über dem guudn Debbsch zerkrümelten, Zwintzscher-Helmut hatte den sechsjährigen Weltkrieg mit einer zweitägigen Gefangenschaft beim Engländor beschlossen, und war dann aus einer unbewachten Scheune herausgekrochen und stracks nach Leipzig zu Mutter Madeleine spaziert. Es gab ein vorzeidiches Hochzeitsfoto, auf dem Vater in Uniform und Mutter in Kränzchenschmuck zu sehen waren. Wir beiden Brüder bewunderten uneingeschränkt unsere wunderschöne Mutter. Ob Vater ein tapferer Soldat war, darüber wurde nicht gesprochen; auf die kindliche Frage, ob er auch mal jemanden totgeschossen habe, antwortete mein Vater nur mit einem schmerzlich-väterlichen Lächeln. Soldatsein galt zu diesen Zeiten wohl als sinnlos. Und der sächsische Soldat war, wie sein südlicher Bruder Schwejk, eine in sich unlogische Sache. Der deutsche Soldat war zackig, der sächsische machte höchstens zaagg-zaagg.
Zwintzscher-Helmut begann nach dem Kriege zunächst in einer Bilderfertigungsanstalt. Der akademische Maler und Chef ließ mit einem von russischer Requirierung verschont gebliebenen Dia-Bildwerfer Wald- und Heidelandschaften auf Leinwände projizieren; mein Vater und ein Kollege hatten sodann mit großen Pinselstrichen das Bild nachzumalen, der Chef setzte zu guter Letzt mit akademisch-kundiger Hand die Wasserperlen auf die Grasspitzen und die roten Säume an die Wolkengebirge. Eine Weile half mein Vater dann seinem Schwiegervater und Tischlermeister Robert Fleischer, doch dessen Geschäft wurde aus Gründen, nämlich solchen von Nazi- und Kriegsverbrechertum, enteignet. Großvater nahm die Schippe und reihte sich in die Schar der unfröhlich Aufbauenden.
Vater aber wurde akademisch: Er besuchte die Bildungseinrichtung für Taubstummenlehrer und hatte nach sechs Monaten ein Papier, das ihm amtlich bescheinigte, stumm Guckende zu verstehen und denen wiederum die Zeichensprache beibringen zu dürfen. Meine Angst, eines Tages mit geleertem Sprachspeicher dazusitzen und wortlos zu sein, mochte sich auch aus dem väterlichen Beruf ergeben haben.
Ainitzsch beherbergte eine Heimschule für Taubstumme, wie damals politisch unkorrekt die Hör- und Sprachförderschüler hießen. Auch ging die Rede, auf dem Lande, weit von den Trümmerwüsten Leipzigs entfernt, wäre die damals alles entscheidende Nahrungsfrage leichter zu lösen. Vielleicht mochten in meinem Vater auch erzgebirgische Heimatwälder summen, so dass er mitsamt der südländischen, schönen Madeleine, in der schon Diddi von innen bubberde, gen Süden und bergwärts zog, dahin, wo die uranreich strahlenden Wälder in der Ferne zu ahnen waren, nach Ainitzsch an der Zschopau.
Der Ort war im Jahre vier nach dem abrupten Ende der Welteroberung wie geschaffen, ein trautes Familienleben zu pflegen: Beim Bäcker Weidenhammer gab es wunderbar knusprige Brötchen auf Marken für fünf Pfennige das Stück; auf der Lessingstraße verwamsten einander ungeschlachte Ainitzscher Kinder und warteten nur, dass neues Prügelmaterial einzog; das nächste Fichtenwäldchen mit Brombeeren und Butterpilzen lag ein paar hundert Meter entfernt; die Ainitzscher nannten die offiziell „Umsiedler“ geheißenen Bürger Beemaagn und Bollaggn, glücklicherweise bewahrte die traumhaft sichere Beherrschung der hiesigen Umgangssprache meine Eltern vor diesem Schicksal; die Buntmetallschieber sägten des Nachts Bleirohre aus Wasserleitungen, und den Marktplatz schmückte über dem protzigsten Eckhaus ein mysteriöser Auftrag in roten Blockbuchstaben: „Baut vereint das friedliche Deutschland!“
Es blieb Zwintzscher-Helmut, Madeleine Zwintzscher, geb. Fleischer, Dietrich Gustav Zwintzscher und Mario Claudius Zwintzscher gar nichts anderes übrig, als vereint hoffnungsvolle Weihnachtslieder zu singen. Bis zum martialischen Ende der Strophen.
Die Sabotage des Großen Aufbruchs
Im Leben des Menschen gibt es wenige Höhepunkte; im Leben der frisch gegründeten Republik drängelten sie sich. Die Ernte wurde verlustlos eingebracht; der Zweijahrplan wurde verkündet, beschlossen, erfüllt und übererfüllt; die westdeutschen Kriegsbrandstifter wurden in die Schranken gewiesen; die neue Kreis- und Bezirkseinteilung holte die Edikte der Französischen Revolution von 1789 nach und entwickelte die Dekrete Lenins schöpferisch weiter. Ainitzsch war der Kreisstadtstatus wiederum vorenthalten worden, wie schon nach der Schlacht bei Mühlberg 1547, nach der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 und der nunmehr siegreichen Schlacht an der Buntmetallfront. Bleirohre waren durch solche aus Plast ersetzt, Messingleuchter durch Eloxallampen. Konterrevolutionäre Saboteure schlichen über die durchlässige Grenze Sachsens, hinein bis ins Mark des jungen Bezirkes Chemnitz, und versuchten schon im Kindergarten, sozialistische Pflänzchen zu knicken.
In einem Rundfunksender namens RIAS, was in sächsischen Ohren verwegen und exotisch klang, wurden die Rechte aufständischer Arbeiter, die die Berliner Stalinallee schöner denn je errichteten, diskutiert, und in Chemnitzer Maschinenbaubuden wurde ausgeholt zum Schlag ins Kontor der Geschichte. Der Dichter Volker Braun übte an seiner schwungvollen Unterschrift im fernen Dresden, und in Ainitzsch ließ ich mich willig an die Hand nehmen und im Kindergarten „Paul Fröhlich“ abliefern:
Der Kindergarten hielt für jedes Kind ein schönes viereckiges Fach bereit. Das Personal hieß Tante Maria und Tante Martha. Für einen sensiblen Sprecher, der schon mit der B-L-Häufung in „Möbelwagen“ Probleme hatte, ergaben sich Schwierigkeiten, Dande Madda und Dande Maddia entsprechend einzuordnen. Dande Madda war für die Großen zuständig, zu denen Bruder Diddi gehörte; Dande Maddia betreute die jüngste Garde des Ainitzscher Kindervorrates.
Angesichts heutiger Sparpläne im Sozialwesen, denen wir im Ausschuss zustimmen sollen, war ich neulich versucht, die Lage im Ainitzscher Kindergarten „Paul Fröhlich“ vergleichend heranzuziehen. Doch neben Dande Madda und Dande Maddia muss es weiß gekleidete Küchenfrauen, emanzipiert autofahrende Frauen, den Garten des Kindergartens betreuende Frauen, Schreibmaschinen bedienende Frauen und gewiss auch den Klassenkampf verschärfende Parteisekretärinnen gegeben haben; so habe ich lieber mangelnde Kenntnis und Befangenheit zur Grundlage einer flammenden Rede und konsequenter Stimmenthaltung bei der Finanzierung von Kinderbetreuungen gemacht.
Die Brottasche, in der ich gemeinhin einen halben Apfel und ein zusammengeklapptes Fettbrot trug, welches meine Mutter aus Gründen einer Höheren Tochtererziehung niemals Feddbemme wie alle übrigen Ainitzscher nannte, wurde an den vorbestimmten Haken gehängt; das gute Kindergartenkind nahm seinen Kindergartenplatz am Kindergartentisch ein, und wenn Dande Maddia zur Gitarre griff, begann ich eilfertig und geübt tonlos „Wind, Wind, Wind, Wind, fröhlicher Gesell“ mit deutlich auf- und zuklappenden Lippen zu artikulieren.
Wenn ich nach einem in der Gruppe verbrachten Kindergartentag von der im Arbeitskollektiv ermüdeten Mutter – sie war damals „Fakturistin“, vermutlich steuerte sie schwere Fakturen über Felder – abgeholt wurde, so beobachtete ich, ob „Die Sorgen“ sichtbar wurden. Feine graue Haare hießen „Die Sorgen“. Sie wurden immer sichtbarer. „Die Sorgen“ konnten nur von Zwintzscher-Helmutvati kommen, denn der hatte zwar weisungsgemäß den Kindern in der Stummenschule beigebracht, dass Stalin im Herzen aller guten Menschen wohnte, doch für Taubstummenlehrer galt es, diese Erkenntnis schöpferisch in dem Sozialismus wesenseigene Gesten umzusetzen. Zwintzscher-Helmut hatte dabei das gestische Element eines jeden Parteibeschlusses nicht bedacht, so war der Unterschied zwischen Stalinallee und Stalin alle