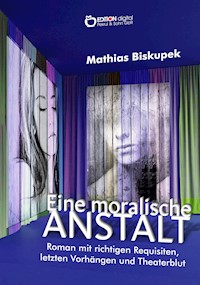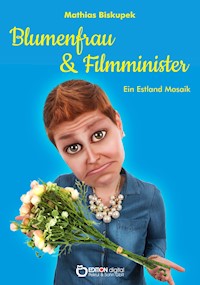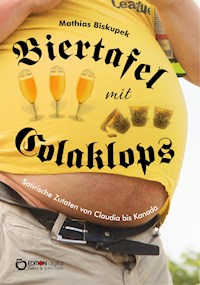4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
In 17 Geschichten schildert der Autor humorvoll und überspitzt den Alltag in der DDR mit seinen Menschen und Problemen. Helmut betreibt einen Kult um seine Lederjacke, die es in der DDR nicht zu kaufen gibt. Alfred rächt sich an seinen Kollegen, die seinen Garten mit seltsamen Pflanzen bei einer Grillparty verwüsten, mit von ihm gezüchteten schnellwachsenden Pflanzen. Autor und Verlagsmitarbeiter schrumpfen fast auf Däumlingsgröße. Hümpe bombardiert die Behörden mit Eingaben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
Matthias Biskupek
Leben mit Jacke
Geschichten
ISBN 978-3-96521-367-8 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien 1985 im Eulenspiegel Verlag Berlin
2021 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Leben mit Jacke
Als Helmut sechsundzwanzig Jahre alt geworden war, heiratete er eine Lederjacke.
Sie war schwarz und gut geschnitten. Wenn er mit ihr durch das Städtchen ging, fiel ein Glanz von ihr auf ihn.
Natürlich wusste man im Ort, dass er nicht auf gewöhnliche Weise an sie gekommen war. Es war bekannt, was in den lokalen Textilläden zu haben war. Eine solche Lederjacke wäre sofort aufgefallen. Und vermutlich wäre Helmut dann niemals gerade an diese Jacke geraten.
Er hatte sie per Annonce kennengelernt. Sie war als neuw. ungetr. angezeigt worden. Die Adresse war eine Telefonnummer und eine andere Stadt. Helmut hatte sich sofort zur Staatsbank und anschließend auf die Reichsbahn begeben.
Das erste telefonische Vorsprechen blieb ergebnislos. Eine männliche Stimme hatte ihm mit brutaler Offenheit mitgeteilt, dass nichts mehr zu machen sei.
Schließlich war es ihm doch gelungen, einen Termin zu erhalten. Er musste dafür eine ganze Reihe möglicher Annehmlichkeiten aufzählen.
Mit ihm waren noch zwei weitere Herren da. Er musterte die Konkurrenten misstrauisch. Dann wurde die Jacke hereingebracht. Von diesem Augenblick an wusste Helmut: Die muss es sein.
Sie sah wirklich völlig ungetragen aus. Das Leder glänzte sehr weich. Nichts Hartes, Steifes war an ihr. Keinerlei Falten, auch dort nicht, wo durch die Armbeuge unweigerlich Falten entstünden bei normalem Gebrauch. Die Knöpfe saßen straff; ihr Kragen war schmal und klein. Der Schnitt ihrer Seitentaschen zweifellos modisch, aber nicht von jener aufdringlichen Eleganz, die sie in wenigen Jahren würde veralten lassen.
Helmut war froh, dass sie nicht dabei war, als man sich, wie es beschönigend heißt, gütlich einigte. Man hatte die Jacke wieder ins Nebenzimmer gebracht. Die drei Herren hatten wie Kampfhähne ihre Trümpfe ins Feld geführt. Knisternde Scheine, laute Zusatzangebote.
Seltsam, dass in unserer aufgeklärten Zeit so etwas noch möglich war. Schließlich hatte Helmut mitgetan, und endlich war ihm die Jacke zugesprochen worden.
Ihm ging es nur um die Jacke. Wenn er sie erst trug, würde er das beschämende Spiel, an dem er sich beteiligt hatte, für immer vergessen können.
Die anschließenden Formalitäten waren rasch erledigt. Er musste etwas unterschreiben, was er niemals hätte mit gutem Gewissen unterschreiben dürfen. Doch es war so üblich.
Helmut widerstand der Versuchung, sofort die Jacke auf seinen Körper zu ziehen. Er musste hier Form wahren und ließ sie sich einpacken. Während der Bahnfahrt lächelte er versonnen aus dem Fenster und schob ab und zu das Packpapier, in dem sie leicht an seiner Seite ruhte, etwas auseinander.
Ihr tiefes Schwarz schimmerte ihm entgegen.
Später kam es Helmut seltsam vor, dass ihm nie der Verdacht gekommen war, sie könne vielleicht doch bereits getragen worden sein.
Was hieß denn neuwertig? Hieß das, dass sie nicht völlig neu war? Nur neuwertig?
Hatte schon einer sie besessen, entgegen der ausdrücklichen Zusicherung? War mit ihr durch eine fremde Stadt geschlendert, hatte sich anstarren, beneiden lassen, wie er jetzt?
Sah man einer Jacke an, ob sie ungetragen war beziehungsweise ob einer wirklich ihr allererster Träger war?
Hauptsache, dachte er, man dachte, er sei wirklich ihr erster Besitzer. Dann würde erst recht Neid aufkommen. Er, er allein, mit diesem exquisiten Stück.
Als ihn wiederholt solche Gedanken heimsuchten, schämte sich Helmut ob seiner Vorbehalte. Was bedeutete es denn, wenn eine Jacke bereits für kurze Zeit über einen anderen Körper gestreift worden war? Verlor sie damit irgendetwas von ihrer Neuwertigkeit? Von ihrem Glanz? Satt, schwarz.
War es nicht vielmehr so, dass sie sich mit jedem Tragen mehr und mehr seinem, nur seinem Körper anpasste? Harmonierten sie nicht zusammen? Besaß er sie nicht allein? Jede Falte in ihrer Armbeuge hatte er verursacht. Jedes leise Knacken in ihren Nähten rührte ganz allein von seinem Gebrauch.
Doch nutzen in solchen Fällen intellektuelle Beruhigungsversuche?
Immerhin ertappte sich Helmut später einmal dabei, dass er ihr Futter aufmerksam betrachtete. Sie lag etwas nachlässig über der Stuhllehne. Im grellen Licht der Frühlingssonne waren die feinen Stiche zu erkennen, mit denen der seidige, glänzende Futterstoff an das Leder genäht worden war. Er versuchte zu erkennen, ob dies Futter bereits einen andern gewärmt hatte. Ob vielleicht doch der Schweiß eines anderen Spuren an ihr hinterlassen hatte?
An diesem Tag war es auch, da er die ersten abgeschabten Stellen an ihr zu erkennen glaubte.
Solche Bedenken suchten Helmut immer häufiger heim. Dabei wusste er noch genau, wie er sie zum ersten Mal anprobiert hatte. Damals, vor den zwei Herren, mit denen er um sie gebuhlt hatte, wäre es ihm unwürdig vorgekommen. Er vertraute auf die Größenangabe.
Er hatte gewusst: Eine Lederjacke schmiegt sich an durchs Tragen, sie kann mitwachsen. Das hatte er gehofft: mit der Jacke verwachsen werden.
Damals, zu Hause, vor dem Spiegel; da zog er sie an. Langsam, ganz langsam. Etwas ungewohnt und fremd war ihr Leder auf seiner Haut.
Doch zugleich war ihm, als hätte er sie schon immer getragen.
Wenn sich später begehrliche Blicke auf sie richteten, dehnte sich sein Brustkorb. Die Knöpfe, die er immer wieder in anderer Verschlussstellung nutzte – mal einen, mal zwei, mal alle drei –, spürte er dann auf seinen Rippen. Er fühlte, die Jacke war da.
Glück: Das war der Druck dreier Knöpfe.
Bald ging er mit ihr in seine Stammkneipe. Er wusste, man bewunderte sie insgeheim. Auch wenn gutmütig gelästert wurde.
Es passierte schon mal, dass einer seiner Stammtischgenossen das Leder mit den Fingern befühlte. Helmut ließ das nur zu, wenn er schon viel getrunken hatte. Meistens klappste er dem betreffenden Kollegen auf die Finger. Bei der Lederjacke hörte sein Spaß auf. Anfangs.
Wenn er sie zu Haus über den Bügel streifte, zärtlich, und sie achtsam an der Flurgarderobe befestigte, roch er den Kneipendunst, den sie den ganzen Abend aufgesaugt hatte. Auch das machte ihn misstrauisch. Doch er hatte sie ja den ganzen Abend an sich gehabt.
Kneipenrauch: Das war ein Fremdling. Er hing an ihr, der Rauch, wie er selbst.
Als es Sommer und wärmer geworden war, ließ er sie öfter zu Hause. Schließlich, sagte er sich, man muss mal was anderes tragen. Die Freunde lachen ja schon über mich.
Als er die Jacke das erste Mal liegenließ, machte er sich Gewissensbisse. Er war bei Freunden zu einer Party gewesen. Man hatte ausgelassen getanzt, schließlich Fasching gespielt. Jeder verkleidete sich möglichst originell mit den vorhandenen Sachen. Dabei musste seine Jacke irgendwo abgeblieben sein.
Helmut war in einem fremden Regenumhang heimgeschwankt. Am nächsten Morgen ekelte es ihn vor dessen kalter, chemischer Glätte. Dabei glaubte, nein wusste er, dass er den Umhang extra erbeten hatte. Es goss mächtig in dieser Nacht. Helmut hatte gegrölt, seine Lederjacke sei ihm zu fein für diese gewöhnliche, proletarische Nässe. Er brauche etwas Rustikales, das den Regen von ihm abhalte.
Nun schauderte ihn vor dem farblosen Stück, das farblos und fischig in seinem Zimmer herumlag.
Helmut klingelte verkatert an der Wohnungstür seines Freundes. Es dauerte lange, bevor geöffnet wurde. Helmut wies mit beschämter Geste auf den Regenumhang, fragte nach seiner Lederjacke.
Der Freund grinste breit und verschwörerisch, bat Helmut herein. Auf dem Sofa lag seine Lederjacke. Achtlos. Ein Ärmel war roh umgewendet. Im Zimmer sah es wüst aus.
Helmut hängte seine Lederjacke über die Schulter und verschwand, ohne den Kaffee zu trinken, der ihm angeboten wurde.
Von diesem Tage an benutzte Helmut die Jacke auch zum Autoputzen. Er sagte sich, dass eine Lederjacke schließlich ein besonders praktisches Kleidungsstück sei. Warum sollte er es unnatürlich schonen? –
Er hatte sie lange getragen; abgeschabte Stellen wurden deutlich sichtbar. Ihr Glanz stumpfte ab. Zwar hatte er früher streng darauf geachtet, dass sie häufig mit Lederspray eingesprüht wurde. Doch das war lange vorbei.
Abgewetzt, grau, speckig, schimmerte sie an vielen Stellen durch das immer noch tiefe Schwarz.
Längst hatte Helmut es sich auch abgewöhnt, die Knöpfe über seinem Bauch zu schließen. Er war fülliger geworden. Die Jacke hatte mit ihm nicht Schritt halten können. Wer weiß, ob die Knöpfe das noch aushielten.
Er hatte keine Lust, mit abgerissenen Knöpfen herumzulaufen. Es musste nicht jeder sehen, dass die Fäden morsch geworden waren und dass er einfach keine Lust hatte, die Knöpfe sorgfältig nachzunähen.
Wenn er in seine Stammkneipe ging, nahm er die Jacke immer noch mit. Dort eingetroffen, hängte er sie gleich über den Stuhl. Da blieb sie, bis er bierschwer aufstand. Manchmal hatte er die Jacke nur noch aus alter Gewohnheit über dem Arm.
Schon oft hatte er sie liegengelassen. In der Straßenbahn, auf dem Wohnungsamt, selbst beim Fußball. Doch seltsam, immer wieder war sie ihm nachgetragen worden. Oder er hatte sie anderweitig, durch Zufall, wieder in die Hände bekommen.
Sie verstaubte mehrere Wochen auf dem Fundbüro. Weil er zufällig dort vorbeikam, fragte er nach. Sie war noch da, und das wunderte ihn nicht einmal. Er nahm dies und sie als Selbstverständlichkeit.
Eines Abends saß Helmut wie immer in seiner Stammkneipe. Ein junger Spund setzte sich zu ihnen. Sie redeten über dies und das.
Der junge Spund fragte leichthin, wem die Lederjacke gehöre, die da überm Stuhl.
Helmut brummte, er könne sie haben, das alte Ding, wenn er eine Lokalrunde ausgäbe. Sie tränken Korn.
Der junge Spund, hochgewachsen und gut gebaut, hängte die Jacke über seine Schultern, ging zum Kellner, bestellte die verlangte Runde und verließ die Kneipe schnell. Helmut starrte ihm nach.
Die Jacke schwang sehr leicht um den athletischen Körper des jungen Spundes.
D’Artagnan, dachte Helmut versonnen. Seltsam, wie so ein schäbiges Ding wirken kann. Die Eingangstür schwang wieder zu.
Als Helmut auf die Straße trat, fröstelte ihn.
Wachstum
Herr Alfred Steiner-Peil pflegte sein individuelles Gartengrundstück, das sein Einfamilienhaus umgab und in einer unserer freundlichen Landschaften lag, nach persönlichem Geschmack zu schmücken. Sein Geschmack war planmäßig ungezähmt. Dunkle Kuschelgrasbüschel, fleischige, stachelbesetzte Grünfinger, schnörkelndes Rankenwerk über ausladendenden Steinformen: Dies verlieh seiner Scholle die Aura wilder Gediegenheit.
Hier, während seiner bemessenen Freizeit, züchtete Herr Steiner-Peil das Schirmbildende Lungenwurzröhricht und das Dranghemmende Krauswollige Jungfernkräutlein. In seinen Urlaubswochen durchkreuzte er mit seinem Kleinfahrzeug, Produkt einer traditionspflegenden Automobilfabrik, nahe und ferne Kalksteingebirge, da nach seinen Erfahrungen dort seltene Flora siedelte. Traf er auf ein bisher von ihm noch nicht katalogisiertes Bergkraut, so hob er es vorsichtig aus der natürlichen Umgebung heraus, verpackte dieses sowie eine Prise Boden in Folie und kehrte über schnelle Fernverkehrsstraßen zu seinem Gartengrundstück zurück, wo er versuchte, das Kalkbodenprodukt heimisch zu machen.
Der Erfolg war wechselhaft, wie Wetter und Versorgungslage in Herrn Steiner-Peils Heimatkreis. Doch die Geduld des Hobbyforschers, der seine wahren Absichten achtdreiviertel Stunden täglich hinter öffentlicher Nützlichkeit zu verbergen weiß, wurzelte tief in Herrn Alfred Steiner-Peil.
Die Kollegen, mit denen Steiner-Peil großräumige Büros teilte, nutzten ihre Arbeitszeit zum Austausch von Erlebnissen mit den Frauen ihrer Freunde. Alfred Steiner-Peil sortierte wie seine neben- und übergeordneten Mitarbeiter Blätter, auf denen kooperative Pflanzenproduktionsergebnisse vermerkt waren.
Doch während seine Kollegen vorwiegend von neueren Methoden, zu tiefgründigeren Lusterfolgen zu gelangen, berichteten, mühte sich Steiner-Peil lustlos, aber ausdauernd, statistische Reihen über die Neubildung von Zellen mathematisch fassbar zu formulieren. Für projektierte Getreidekorngrößen stellte er Zahlenreihen auf, deren nachfolgendes Glied stets vom Quadrat des voraufgegangenen gebildet wurde. Die grafisch dargestellten Wachstumsraten schnellten planmäßig steil nach oben.
Lustlos ließ Steiner-Peil die aufregend farbigen Linien von einem Schreibgerät vervielfältigen. Mit glänzenden Tropfen auf den Stirnen lauschten seine Kollegen dem Kollegen Hartmann, der die feuchtwarme Begebenheit einer Gelegenheit mit der Sachbearbeiterin Karin Mosseldorf darlegte. Kollegin Mosseldorf kreuzte im angrenzenden Großraumbüro die Namen von aktiven Kollegen an, die für Sofortprämien oder Lehrgänge in Frage kamen.
Wenn morgens die Sirene weich, aber unüberhörbar einsetzte, befand sich Herr Steiner-Peil für gewöhnlich wenige Meter vor dem Betriebsgelände. Er setzte dann seine Schritte noch schneller, und unter den missbilligenden Blicken von Karin Mosseldorf, die im Gang vor ihrem Büro stand, eilte er an seinen Platz, unverzüglich die Arbeit mit Zahlen und Zeichen aufzunehmen. Seine Kollegen, die bereits ausgeruht an ihren Schreibplatten saßen, unterbrachen für wenige Sekunden ihren Erlebnisaustausch. Die Stille war keinesfalls mit Wohlgefallen gesättigt.
Natürlich war Herr Steiner-Peil sich bewusst, dass sein Verhalten wenig dazu beitragen konnte, begehrte Kreuze hinter seinem Namen als Zeichen für Zusatzfinanzmittel und Weiterbildungswochen auszulösen – letztere Veranstaltung wäre ohnehin für seinen Garten problematisch geworden –, auch war er sich der Verpflichtung voll bewusst, die er durch Unterschrift im Arbeitsvertrag eingegangen war, doch er brachte es nicht übers Herz, die morgendliche Pflanzenpflege auch nur um die eine notwendige Minute zu verkürzen, die ihm die allgemeine Anerkennung als pünktlicher Mitarbeiter hätte einbringen können.
Wenn das Interesse der Kollegen um den Kollegen Hartmann an der Theorie zwiegeschlechtlicher Einigungsvorgänge nach einem erzählerischen Höhepunkt dann plötzlich erschlaffte, wendete man sich meist praktischeren Veranstaltungen zu: Es ging dann um die Vorbereitung einer nächsten Feier bei einem nächsten Kollegen. Gärten, Terrassen, Bungalows, Bergvillen, Wassergrundstücke und Privatwäldchen waren bevorzugte Austragungsorte solcher abendlichen Zusammenkünfte, an denen teilzunehmen Herrn Steiner-Peil nicht vergönnt war, was er jedoch weniger als Mangel empfand denn als erleichternde Entpflichtung.
Als Mangel wurde jedoch vom kollektiven Bewusstsein empfunden, dass Steiner-Peil sich so konsequent ausschloss. Man hätte dies nicht gar so schmerzlich gespürt, wenn Herr Steiner-Peil nicht Besitzer eines individuellen Gartengrundstücks gewesen wäre, das an Größe die Spitze innerhalb der Grundstücke der Abteilung hielt.
Auf einer inoffiziellen Versammlung unter Ausschluss von Steiner-Peil und unter Leitung von Kollegen Hartmann wurden praktische Maßnahmen beschlossen, auch das Steiner-Peilsche Grundstück in die allgemeine, abteilungsverbindliche Feierlage einzubeziehen.
Was beschlossen wurde, ward.
Eines lauen Sommerabends, in dessen seidige Stille lediglich gelegentliche Hack- und Gießgeräusche im Steiner-Peilschen Garten Zäsuren setzten, erhob sich in der Ferne der Zufahrtstraße eine Staubwolke, die rasch näher kam. Herr Steiner-Peil wusste, dass dies von in Kolonne fahrenden Personenkraftwagen hervorgerufen wurde, und begann erstaunt nachzudenken über das seltsame Zusammentreffen einer größeren Anzahl von Autos auf dieser wenig befahrenen Straße, ein Fall, offenbar statistischen Randbezirken verpflichtet.
Noch war er zu keinem schlüssigen Resultat gelangt, als die Kolonne von sieben Fahrzeugen unmittelbar vor seinem schmiedeeisernen Gartentor zum Stillstand kam, nicht ohne letztmalig, gebunden an aufheulende Motortöne, kräftige Dünste veredelten Erdöls über Alfred Steiner-Peils gehegte Kulturen zu treiben.
Dem ersten Wagen entstieg Kollege Hartmann mit einem Sack voller Holzkohle und seiner Ehefrau. Beider Wirkungen kannte Steiner-Peil noch nicht. Dem nächsten Wagen entwand sich mit einer vollendeten Hüftdrehung, baumelnden Würsten und ihrem Gemahl Karin Mosseldorf. An weiteren fünf Fahrzeugen klappten die Türen, bevor das Gartentor aufschwang: Kollegen und Kolleginnen mit Gespielen und Gatten, mit Flaschen und Taschen, füllten den Weg, der ins Innere von Alfred Steiner-Peils sorgsam gehüteten Biotop führte.
Herr Steiner-Peil hatte eine langjährige Ausbildung an einer Schule in der gemäßigten Klimazone genossen; er konnte also nicht umhin, einige Worte zu sprechen, die ein gewisses Erstaunen mit einer durchaus vorhanden sein sollenden Freude über den unverhofften Besuch mischten.
Dieses tief eingepflanzte Herdenverhalten war im Plan der Kollegen kalkuliert; sogleich entfaltete Kollege Hartmann ein Metallrohrgerüst, gebeizt von Ruß und altem Fett, das er tief in die Flachwurzlige Doldenmoosdecke eingrub, wobei er Rufe der Anerkennung für solch gepflegte Grasfläche ausstieß. Sodann leerte er den Inhalt seines Holzkohlensacks zum Teil auf das Metallgerüst, zum Teil ins Doldenmoos und begoss Holzkohle, Schuhe von zwei Kollegen und eine größere Fläche von Steiner-Peils Zucht des Flammendroten Berggrillkrautes mit Spiritus. Das entfachte Feuer wurde eilends wieder gelöscht, wo es wenig zur späteren Erhitzung der zahlreichen Fleischscheiben und Wurstketten beitragen konnte, die in flachen Gefäßen warteten.
Unter Anleitung Karin Mosseldorfs begannen drei männliche Kollegen größere Steine im Kreis aufzustellen, wobei besonders bizarre Kalkkonglomerate wegen ihrer geeigneten und hochmodischen Sitzflächen Beifall fanden.
Um die Getränke vor den letzten über Herrn Steiner-Peils Garten nur noch zaghaft tastenden Sonnenstrahlen zu schützen, legte man sie in die Weißen Tränenfeuchten Moorbutten, die bekanntlich hochempfindlich sind gegen jede Art von Berührung.
Ein Kollege hatte bereits begonnen, dem Flaschenbier zuzusprechen, und schlug in einer noch wenig begangenen Ecke des Gartens sein Wasser ab. Das Geräusch erinnerte Steiner-Peil an seine Gießkanne, die er in Sicherheit bringen wollte. Frau Hartmann hatte jedoch bereits deren mögliche Funktion als Musikinstrument erkannt.
Kollege Hartmann war vollauf beschäftigt, die Bräunung des Grillgutes zu beschleunigen durch Luftzufuhr mittels großblättriger Pflanzen, deren lateinischen Namen Herr Steiner-Peil ihm hätte sagen können. Kollege Hartmann sah somit nicht, wie seine Frau, die doch für die Rückfahrt des Autos verpflichtet worden war, dem Brambacher ohne zusprach, Geschmack aus dem guten teuren Wodka hinzufügend.