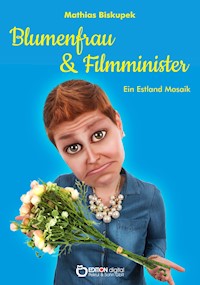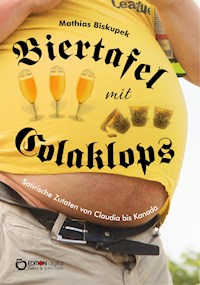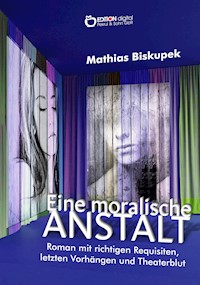
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein junger Mann betritt die Bretter, die die Welt bedeuten. Er wird gecastet, aber das heißt zu der Zeit noch Kadergespräch. Er findet sich wieder als Regieassistent mit Spielverpflichtung. Schnell merkt er, dass auch hinter den Kulissen ein spannendes Spiel läuft, in dem es um Liebe, Karriere und handfeste Intrigen geht. Matthias Biskupeks Roman führt in ein Provinztheater tief im Osten. Er ist eine Satire auf die Zeit, „da die Welt noch nicht in Ordnung war und die Theater keine Mängelbedarfsklagen hatten, sondern einen Anspruch".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
Matthias Biskupek
EINE MORALISCHE ANSTALT
Roman mit richtigen Requisiten, letzten Vorhängen und Theaterblut
ISBN 978-3-96521-491-0 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien 2007 im Eulenspiegel Verlag Berlin.
2021 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Vorangestellt
Sitzen Sie bequem? Reicht Ihnen das Licht? Warm genug und angenehm kühl? Haben Sie die Welt, wie man heut in miesem Deutsch formuliert, außen vor gelassen? Also, alles in der Ordnung unseres Jahrhunderts? Dann lassen Sie sich mitnehmen ins vorige. Gut drei Dezennien bummeln wir zurück, als die Welt noch nicht in Ordnung war, das Leben spitzfindig oder stumpf und die Theater keine Mängelbedarfsklagen hatten, sondern einen Anspruch.
Vor uns breitet sich eine hügelige Landschaft aus. Höchst anmuthig, meinte Friedrich Schiller, der just hier mit zwei reizenden Schwestern diverse Zuneigungshandlungen pflegte. Wein wuchs am Ort, bevor ihn die Reblaus zur Zeit Kaiser Wilhelms bis auf Stock und Stiel abfraß. Jetzt gibt es noch eine Weinbergstraße und wiederaufgerebte Flächen zur individuellen Nutzung in einer Kulturbund-Ortsfachgruppe „Historischer Weinbergbau“. Ansonsten aber sind landwirtschaftliche Flächen zusammengelegt und werden kollektiv bewirtschaftet. Hinterm Horizont geht’s nicht mehr weiter, denn dort lauert der schlimme, der menschenfeindliche, also der freie und humane Westen. Es ist heiter bis wolkig und wir sehen alles in einem schrägen, aber punktgenauen Licht der Zeit – im spotlight – direkt vor uns:
Das Bühnenbild
Das Theaterhaus ist weißblau und winzig. Geheimrat Goethe, der hier vorzeiten Theaterdirektor war, nannte es seine Bratwurstbude. Damals hatte es zwei Ränge plus Oberrang, über Außentreppen erreichbar. Die Bühne besitzt jetzt ein Achtmeter-Portal und einen fehlenden Schnürboden. Nichts kann von oben einschweben; immerhin lässt es sich aus dem Orchestergraben emporkommen. Zu Goethes Zeiten bestand das Theaterfoyer aus der anmutigen Gegend rings um die Bratwurstbude – bei Regen matschig, weil ungepflastert. In der Jetztzeit – also Ende der 1970er – gibt es vor dem Theater Betonplatten, Betonkübel und Betonstelen mit ein paar zarten Rissen, wie sie abgelagerte Errungenschaften immer aufweisen.
Im Innern ist das Haus mit dem Plast- und Flechtdeckchen-Charme der Fünfziger ausgestattet. Der Pförtner am Bühneneingang – das Theater hat eine mittelgroße Eingangstür und ein separates Mitarbeitertürlein –, der Pförtner, ein Rumbuff (Worterklärungen werden nur auf Anfrage gegeben), fragt einen bärtigen Herrn, was der denn möchte. Der Bartmann meint, er sei der demnächst hier tätige Oberspielleiter und wolle sich das Haus mal ohne Berufungskommission und Parteiöberschte ansehen. Der Pförtner meint, erstens habe die Partei hier immer das Sagen. Und das ohne Gemecker, gelle? Und zweitens ginge das nicht – derweil laufen fünf Leute an der Pförtnerbude grußlos vorbei. Hinein in den Zuschauerraum, rüber in die Requisite, runter ins Kon-Zimmer. Was ist ein Kon-Zimmer? Gemach, das wird geklärt werden. Im Moment versucht der designierte Oberspielleiter, friedfertig feixend, zu klären, warum ausgerechnet ihm der Eintritt verwehrt werde. Es ist heller, probenfreier Vormittag, und der Pförtner mit dem amtlich verbürgten Namen Ey diskutiert wild: Hier kann ja nunne nicht jeder reine. Erst Auserweis und Genehmdingsda.
Der künftige Oberspielleiter grinst: Du bist das Ey? Hab schon von dir gehört. Ich bin Bernt Violliné. Mein Name ist auch nicht doofer als deiner. Demnächst sagen sowieso alle Oberfiedler.
Das Ey, neben seinem Pförtnerdasein gelegentlich auch Bühnenarbeiter, Schuldenmacher bei allen neuengagierten Kollegen, Trinker und von Frauen Verführter, staunt. Und grummelt: Aber so ohne Auserweis und was Schrifterlisches …
Vor dem weißblauen Häuschen steht ein zweites, imposanteres Gebäude. Auch dieses blau-weiß, obwohl Bayern erst weit hinter den fernen, gutbehüteten Hügelketten beginnt. Zwei Säulen, ein güldenes Emblem über einer Art Tympanon. Schaukästen, Blumenrabatten davor. An der Seite ein Bretterlager, denn im linken Gebäudeflügel verbirgt sich die Theatertischlerei. Nichts ist mit zentralisierten Werkstätten; hier macht jeder alles, denn allüberall in der Stadt macht sich das Theater breit. Schneiderei, Requisitenwerkstatt, Kulissenlager … Das imposante Säulengebäude enthält im unteren Stockwerk das Klubtheater „Schminkkästchen“, im oberen Intendanz und Malsaal, in dem die größeren Mengen Theaterblut gemischt werden. Früher hieß das Gebäude „Knarzbierhalle“ – über das hiesige Knarzbier, urig, wie der Name, vielleicht später mehr. In der einstigen Knarzbierhalle hat auch der Musikdramaturg sein Plätzchen, auf dem er sich knurrend-schnurrend einrollt. Der Musikdramaturg wird so genannt, ist im Planstellenleben aber ein trotteliger und treuäugiger Bernhardiner und gehört dem Schauspieldramaturgen. Der hat einen Schnauzer und ähnlich goldfarbene Augen wie sein Hundetüm. Hundetüm ist des Schauspieldramaturgen Erfindung, auf die er stolz ist. Der real existierende Chefdramaturg des Hauses ist vor allem für die Musik zuständig, liebt einen Kellner und die große Kunst in der Hauptstadt. Es gibt noch eine Leiterin des Künstlerischen Betriebsbüros, einen Verwaltungsdirektor namens Strucks, den Operettenbuffo Zahmholz, der zurzeit die Rolle des Intendanten unter freundlichem Beifall der örtlichen Parteileitung gibt. Und es gibt eine Dramaturgieassistentin, das samtene Ännchen, die mit dem Chefdramaturgen sofort schlafen würde, wenn es jenem oder ihrer Karriere, auf jeden Fall aber dem Theater dienlich wäre. Doch der Chefdramaturg mag eben nur große und mannesmuthige Kunst. Wagner würde er gern betreuen. Auf dem Spielplan seines Hauses steht aber im Moment nur Aida. Wo bekommt man den Extrachor dafür her? Die Bürger der Stadt sind musisch; die Musikschule hat keinen Mangel an interessierten kleinen Violinisten, kleinen Paukisten, kleinen Trompetern und putzmunteren Blockflötenspielerkindern. Also wird man dort auch für die holde Aida den Background finden.
Doch nun fällt das dritte Gebäude des Theaterensembles ins Auge. Wir zwinkern. Das Haus, fast am Bahndamm gelegen, ist umstanden von Kastanien und zwei Arbeiterplastiken des Bildhauers Fritz Cremer, als er noch gemäß dem in lichte Höhen weisenden Stil der Fünfzigerjahre in teurer Bronze arbeitete. Verdammt teure Bronze, von Arbeitergroschen gekauft.
Das dritte Gebäude am Theaterplatz ist das größte. Fünf Säulen, die von Akanthusblättern gekrönt sind. Dreigeschossig. Lange Fensterfront, dahinter ein mit Fischgrätenparkett ausgelegter Saal. Garderobe, Kerzenimitate, Küchentrakt.
Das dritte, das größte Gebäude am Theaterplatz ist das Theaterrestaurant, das im obersten Geschoss die Nachtbar der Gemeinde beherbergt. Dienstag bis Freitag bis zwei Uhr geöffnet. Am Sonnabend angeblich bis vier. Doch die städtischen Einwohner schlafen nachts um vier oder wälzen sich schlimmstenfalls von ihren Ehepartnern hinweg oder herab. Sie haben aber davon gehört. Vom morgendlichen verderbten Leben bei Nikolaschka, Ginfizz und bulgarischem Rotwein, der landessprachlich Bichseneffner genannt wird.
Rings um diesen Dreiklang von Theaterbauten stehen weitere fest und wacklig miteinander verbundene Häuser. In einem Fachwerkbau am Anger verbergen sich Probebühne, Ballettsaal und Chorzimmer; früher war auch das eine Kneipe. Das „Probebühne Vier“ genannte Etablissement hört auf den Gaststättennamen „Pumpe“. Es gibt das Offene Ausheul-Zimmer, eigentlich „Café Zentra“, und weitere Wohnzimmer der Theaterleute: Schwarzer Adler, Goldener Löwe, Roter Bock, Karl-Liebknecht-Haus, Schuppen und Schimmelbude. Um die historische Innenstadt schlägt die Hauptstraße seit zwanzig Jahren einen uneleganten Bogen. Über der Stadt thront die Schnauferlburg, die trotz des heimeligen Namens ein Mordstrumm von Renaissance, Barock und Rokoko ist. Im Schlosshof wird zur Sommerzeit Sommertheater gegeben. Dadurch ist der gewerkschaftlich verbürgte Urlaub von Schauspielern und Technikern in ständiger Gefahr. Die Gewerkschaft sieht überhaupt immer eine Gefahr für Leib, Freizeit und Leben der ihr anvertrauten Theaterschäfchen. Die Theaterschafe würden gern Böcke sein und sich ganz und gar nicht von eingeschränkten Arbeitszeiten, Frauensonderplänen und einer erstickend warmen und weichen Wohlstandsdecke einhüllen lassen, doch rings um Theater, Stadt und Schnauferlburg herrschen tiefer Friede, tiefe Zuversicht, tiefes Vertrauen in die Weitsicht der Organe. Organe sind Ansammlungen lenkender, leitender, alleswissender Männermenschen. Sie durchziehen das Land bis an seinen hochgeklappten Rand.
Am allgemeinen Bühnenbild, das Glanz und Glamour zur Schauseite nicht ausspart, manchmal täuschend echt aussieht, aber auch mit modernen halbhohen weißen Vorhängen arbeitet, am Bühnenbild wurde ein Vierteljahrhundert lang gewerkelt. Ungehobelte Latten und verschmierte Leinwände sind von hinten zu sehen; nach vorne aber ist alles ganz hübsch, ganz adrett und manchmal recht putzig. Bernt Violliné, der künftige Oberfiedler, wirkt mit seinem zerlederten Kostüm nicht recht passend, auch Ey, der wachsame Bühnenarbeiter, ist strubbelig und sagt Auserweis und Schrifterlisches. Doch wenn man die pfundige, geschwind auch mal an- und auskleidende Dramaturgieassistentin sieht, die alles und noch mehr für ihr Theater machen würde, wenn man den schnippblonden Kellner bemerkt, der den Chefdramaturgen zappeln und zappeln lässt, bis dem Speichel in die Mundwinkel läuft, scheint die Welt doch in ganz hübscher Unordnung zu sein. Treten wir also beiseite und schauen uns an. Nein, nicht uns, das vielleicht später in der Maske, schauen wir einfach zu:
Ein Vorspiel
Zwischen den Bronzeplastiken und Betonstelen steht einsam eine Bank, die im Augenblick nicht einsam ist. Drauf sitzen links der Erich, rechts der Hans und mittendrin der freche Franz – Quatsch, kein Christian-Morgenstern-Programm fürs Klubtheater „Schminkkästchen“ soll geprobt werden, sondern ein Engagement besprochen. Wir Heutigen nennen solches Casting. Der/die zu Engagierende wird gecastet, und die einstellenden Arbeitgeberinnen sind die Casterinnen. Im längst vergangenen Theaterleben nannte man solches: Vorsprechen. Auch: Intendantenvorspiel. Nichts Sexuelles, eher politisch: Kadergespräch heißt der Vorgang in den zeitgenössischen Akten.
Links also sitzt der Chefdramaturg mit sauberem Igelschnitt, rechts der Oberfiedler Bernt mit unsauberer Lederjacke und mittendrin der Theaterlehrling. Ein Bursche mit wachen Augen, einem Diplom für Mathematik und dem Wunsch, am Theater sich zu verwirklichen. Martin heißt er mit Nachnamen und ebenso mit Vornamen. Vielleicht dachten seine Eltern bei der Taufe an Zsa Zsa Gabor oder Humbert Humbert oder die Go Go Girls; der doppelte Martin schien ihnen verheißungsvoll für ein aufregendes, großartiges, ein mitreißendes Leben, das sie ihrem Martin von Herzen wünschten. Ein Leben im gleißenden Ausland, abenteuerlich und nie gleichförmig. Ein erfülltes Dasein, das dereinst den elterlichen Lebensabend mit einem Schein von Ruhm vergolden könnte …
Martin beginnt mit achtzehn Jahren sein aufregendes, großartiges, mitreißendes Leben, indem er Mathematik studiert. Reine Mathematik. Also die blanke Mathematik. Nach einer Diplomarbeit über das Problem des Mengenalgorithmus in Chaos-Systemen und drei Jahren Arbeit in einem Großbetrieb, bei dem Martin das Prämiensystem einheitlich, vergleichbar und individuell absenkbar gestalten soll, was natürlich aufgrund des immer gewerkschaftlicher verankerten Lohngefüges nie angewandt werden wird, beschließt er, sein Leben zu ändern. Das Theater als Lebens-Änderungs-Schneiderei erscheint ihm für sich passend. Dort vermutet er jenes Chaos, dessen Besonderheiten er mit Fleiß studierte. Drum sitzt er jetzt zwischen Chefdramaturg und Oberfiedler geklemmt und lässt sich ausfragen. Wird gecastet. Muss vorspielen.
Zeigen Sie doch mal, Martin, wie Sie die Schülerszene im „Faust“ anlegen würden? Sie sind Regisseur und spielen den Schüler, ich bin Faust, der Chefdramaturg spielt Bühnenbild. Ein wahrlich faustisches Bühnenbild. Sie kennen doch die Schülerszene?
Martin murmelt mäßig mitteilsam.
Stabreime nützen Ihnen nix, kichert schnarrend der Oberfiedler. Der Chefdramaturg verdreht die nach innen getunkten Augen.
Also, Martin, folgendes: Der Schüler will unbedingt bei Faust die Philosophie, Juristerei und leider auch die Theologie studieren. Nun muss er dem um den Bart gehen. Nun machen Sie mal. – Der Oberfiedler streicht sich das Kinn.
Martin stellt sich hin, verschränkt die Arme, blickt zum Himmel und spricht: Ich hab das Zählen gelernt und das Manipulieren von Zahlen. Aber was soll ich in dieser Welt damit anfangen? Einer Welt, in der alles längst definiert ist. Wenn auch Sie mich nicht brauchen, sagen Sie’s doch gleich. Oder wollen Sie mich foltern, auf kleiner Flamme rösten? Ich kann auch meiner Wege ziehen, wie sollt ich jemals ohne Arbeit sein in diesem schmalen Ländchen?
Das war schöner klassischer Duktus, hüstelt der Chefdramaturg: Von Volker Braun? Er schaut sich den ziemlich schlanken Theaterlehrling an und meint eilfertig zum Oberfiedler: Vielleicht, Herr Violliné, sollten wir‘s einfach mit ihm als Regieassistent versuchen? Wir haben doch noch eine Planstelle?
Sagen Sie zu mir Bernt, Chefdramaturg, knurrt der, Bernt genügt. Ich habe noch eine zweite Aufgabe für Sie, Martin. Ich hätte jetzt Lust auf einen Kaffee, was schlagen Sie vor?
Wir gehen ins „Café Zentra“, lassen uns einen servieren und Sie bezahlen, sagt Martin.
Und wenn ich Kaffee hier, in freier Natur, trinken möchte?
Dann, sagt Martin, bitten wir den Chefdramaturgen, dass er die Dramaturgieassistentin, ein ansehnliches Persönchen, bittet, dass sie uns auf ihrer dramaturgie-eigenen Kaffeemaschine einen echten Kaffee braut – das kann sie großartig – und alles mit Milch und Zucker hier serviert.
Gut, sagt Oberfiedler, eingestellt. Als Regieassistent mit Spielverpflichtung, sechshundertneunzig brutto. Die Spielverpflichtung bedeutet ein Drittel Steuerermäßigung. Bedingung: Sie heißen ab heute theaterintern Matti, weil ich noch einen Regisseur namens Martin einstellen will. Mit dem ich Sie nicht verwechseln möchte. Martin (Regisseur) ist Regisseur Martin und Martin Martin Matti. Alles klar? Aber Sie nennen mich nie Puntila. Der Zahmholz macht den Vertrag mit Ihnen, sechshundertneunzig plus Spielverpflichtung, sagen Sie’s ihm. Sie müssen Besetzungs- und Spielpläne machen. Als Mathematiker bringen Sie bestimmt Ordnung in mein verlottertes Theaterleben. Weil ich unpünktlich bin, brauche ich einen ganz und gar pünktlichen Menschen um mich. Morgen um neun sind Sie da, zur Briefstunde. Sie müssen meine Briefe schreiben, ich sag Ihnen, an wen und warum. Sie formulieren, ich unterschreibe. Chefdramaturg, sind Sie auch meiner Meinung?
Der Chefdramaturg blickt in die Sonne, vor der der schlanke Theaterlehrling steht und seufzt: Jaja.
Prolog im Parteihimmel
Ein frischer Wind fegt durch die Straßen der Bezirksstadt. Die heißt intern ZK-Süd. ZK heißt Zentralkomitee und stellt den innersten, den am besten informierten Kern des Landes dar. Ein Kern von Männern, mit zwei Frauen am äußeren Rand.
Das ZK-Süd setzt am uneingeschränktesten die Weisungen aus der Hauptstadt um. Das ZK-Süd beaufsichtigt die staatliche Leitung des Bezirkes, welche zwei Theater zu beaufsichtigen hat. Das der Bezirksstadt, in der einst der Kommunist Hans Otto gemeinsam mit dem Theaterherzog Heinrich spielte. Und das im bezirklichen Südwesten gelegene Theaterchen unter der Schnauferlburg, das als Abstechertheater bis zum Rand nach Bayern hin die Bühnen der Kreisstädte, der Kleinstädte und der Großgemeinden zu bespielen hat. Selbstverständlich auch die Große Bühne im blau-weißen Theaterhäuschen, das „Schminkkästchen“ und das Sommertheater im Hof der Schnauferlburg.
Ungemach hat sich vom Theater unter der Schnauferlburg ausgebreitet bis in bezirksstädtische Leitungshöhen. Es stinkt, und kein frischer Wind fegt sie fort, die Miasmen. Kein Schauspieler mag bleiben an der Nudelbühne, kein Theatermann von Rang hat Lust, dort zu inszenieren. Das Publikum hasst schon immer seine Komödianten. Nehmt die Wäsche rein, die Theaterzigeuner klauen wie die Sauen. Die Sänger wandern ab zur örtlichen Musikschule. Da verdient man besser und hat ein Ansehen. Die Werkstätten verschlampen. Der Intendant Zahmholz ist bei der örtlichen Parteileitung hoch angesehen, weil er feige ist und nichts wagt.
Gerhard Kanthe will etwas wagen. Gerhard Kanthe sitzt im bezirklichen Leitungssessel. Gerhard Kanthe ist jüngstes Ratsmitglied für Kultur der Republik. Ich beweise meine Mitgliedschaft. Ich beweise meinem Mitglied, was es schafft. Ich schaffe dem Mitglied den Beweis – Quatsch! Gerhard Kanthe verbittet sich solche Süffisanzen. Er ist blond, klein und feist und brüllt los, wenn ihm etwas nicht in den Kram passt. Jetzt passt ihm die Theaterpolitik nicht in den Kram.
Er will aus dem Theater unter der Schnauferlburg eine Vorzeigbühne machen. Drum sagt er im Sitzungszimmer zu seiner Referentin Janni Maus: Genosse Violliné bekommt den Parteiauftrag, ein Schauspielensemble mit Beispielcharakter zu formieren. Er soll Absolventen der Theaterhochschule engagieren. Er bekommt einen Sonderfonds. Die Schauspielleitung wird personell verstärkt. Er darf einen zusätzlichen Regieassistenten einstellen. Ich weise hiermit an: Er inszeniert Stücke von höchstem künstlerischem Rang.
Referentin Janni Maus hat am Stadttheater Frankfurt an der Oder vor zehn Jahren den Puck gespielt. Einen weiblichen Puck. Das stellte einen Durchbruch dar. Der „Sommernachtstraum“ als Erfüllung des Wunsches nach Gleichberechtigung. Janni Maus wirft ein: Bernt Violliné ist nicht in der Partei.
Gerhard Kanthe brüllt los: Dann wirst du ihn werben! Das ist dein Parteiauftrag!
Janni Maus sagt: Der will nicht. Das weiß ich. Der will Theater machen. Mit jungen Leuten. Ensembletheater. Der will – sie will nicht sagen, was sie weiß. Sie liebt Theater.
An der Seite Kanthes sitzt Rohrscheich. Mitarbeiter. Verbindungsmann. Genosse Kanthe, sagt er, du solltest dich vorher informieren, wem du vertraust. Es gibt Kräfte, die planen von der künstlerischen Seite eine neue Linie. Erst die künstlerische Frage, dann die gesellschaftspolitische, dann die Machtfrage. Und irgendwann kommt alles ins Rollen. Das können wir nicht dulden. Du läufst in die Messer der Gegner.
Ich laufe nicht, ich stehe fest, betont Kanthe. Sein blaues Auge blitzt, von seiner sanften, von wenig Bart besetzten Kinnhaut tropft eine Perle und rollt sacht am Kragen vorbei Richtung Bauchnabel. Kanthe sagt: Ich kenne keine Knieweichen. Der verantwortliche Genosse aus dem ZK steht hinter meiner Entscheidung.
Der Mitarbeiter macht sich eine Notiz in seine Unterlagen.
Janni Maus blickt wild umher: Der Oberfiedler geht nicht in die Partei. Das weiß ich.
Haben wir nicht genügend Genossen dort im Hause?
Werden die nicht die Linie zu bestimmen wissen? Warum so kleinmütig, Janni? Gerhard Kanthe lässt einen Blitzstrahl auf seine Mitarbeiterin hernieder. In der Ferne grollt der Donner von Lastkraftwagen, die wichtige Güter in alle Teile der Erde transportieren. Denn das Ratsmitglied für Kultur hat sein Dienstfenster offen zur Welt. Die heißt Ernst-Thälmann-Straße. Die Revolution rollt auf Gummirädern, und sie wird jetzt das Theater unter der Schnauferlburg ergreifen.
Der Verbindungsmann macht einen scharfen Haken an seine Notiz und setzt noch ein Kreuz hinzu. Janni Maus sagt, sie gehe anrufen. Gerhard Kanthe fasst zusammen: Beschlusskontrolle! Das Schauspielensemble an der Südwestflanke wird gestärkt. Es beginnt einen Frontalangriff auf die bürgerliche Publikumsstruktur. Wir müssen das Volk dort abholen, wo es auf uns wartet. Der Genosse – der Kollege Violliné – hat unser wachsames Vertrauen.
Gerhard Kanthe schließt seine Schenkel fest zusammen. Das blaue Tuch seines Anzugs kratzt ihn sanft. Janni Maus blickt auf und eilt an ihren Schreibtisch. Der Mitarbeiter verlässt den Raum keinesfalls konspirativ.
Alle drei telefonieren in verschiedene Richtungen. Ganz oben im Rat des Bezirkes freut sich der Genosse Herbert, dass seine fleißigen Mitarbeiter fleißig sind. Er weist an, sie noch umfassender zu kontrollieren. Das Jahr strebt einem Höhepunkt entgegen. Über allen Wipfeln in der Hauptstadt regen sich fleißige Hände zum Applaus. Dann wiegt man den Kopf. Man zuckt die Schultern. Man zuckt nicht zurück. Man ist besorgt. Man ist bedacht. Man zeigt Verständnis. Man zeigt sich von der richtigen Seite. Der Genosse Gerhard Kanthe ist ein zu entwickelnder Kader. Doch es gibt Mitteilungen über den Genossen Kanthe, die in Schubläden gehören. Punktum.
Eiserner Vorhang
Er dient zweierlei: zum einen der geräuschlosen Abschirmung der Bühne vom Zuschauerraum. So kann dort geprobt werden, während da gearbeitet oder herumgesessen wird. Zum andern ist er eine Einrichtung des Brandschutzes. Feuer lässt sich somit entweder aufs Parkett oder auf die Bühne begrenzen.
Das Große Haus des Theaters unter der Schnauferlburg besitzt keinen Eisernen Vorhang. Goethes Bratwurstbude brauchte keinen; jetzt fehlen die Kapazitäten. Geld wäre vorhanden, aber Kapazitäten gibt es nicht. Wir befinden uns in einer Epoche mittleren durchschnittlichen Widersinns, da zwischen Geld und Kapazität ein Abgrund klafft. Jede Erklärung, warum das so ist, zerschellt an einem Gebirge von Absurditäten.
Zuschauerraum und Bühne sind gleichmäßig ausgeleuchtet. In den Parkettsesseln sitzen die Mitarbeiter: Sänger und Techniker, Kraftfahrer und Schauspieler, Gagensachbearbeiter, Zweite Geiger und Ankleiderinnen. Am Bühnenportal lehnt, in zerlöcherter Lederjacke, Bernt Violliné, seit heute ordentlich bestallter Oberspielleiter Schauspiel und hält seine Antrittsrede:
Was ich will, sollt Ihr wissen. Ich will eine Zusammenarbeit aller Sparten. Die Sänger sollen sich fürs Schauspiel interessieren, die Souffleusen für die Tänzer, und die Requisiteure sollen wissen, was wir mit ihren mühsam angefertigten Kunststückchen auf der Bühne treiben. Ja, ich bin Schauspieler, aber ich bin auch wahnsinnig gern Zuschauer.
Theater juckt mich. Es kratzt mich nämlich, was aus unserer Gesellschaft wird. Wir reden so gern davon, dass die Bühne zum Zuschauerraum hin geöffnet werden muss und der Zuschauer sich auch auf der Bühne bewegen soll. Wir beobachten einander, wir klauen voneinander, wir lernen miteinander. Natürlich kann man einen Steg in den Zuschauerraum bauen; meine nächste Inszenierung wird so was brauchen. Theatertischler, denkt Euch was Besonderes aus! Elegant soll er sein und praktisch. Wir rasen viel zu oft durchs Leben ohne jede Eleganz. Man kann im Rang oben spielen lassen und die Leute unten treffen, und man kann im Foyer die Zuschauer schlichtweg ins Spiel einbeziehen durch Provokation. Das Publikum denkt, da sind zwei Besoffne, aber es sind zwei von uns. Nüchtern wie Funktionäre.
Doch das sind alles nur formale Dinge: Steg, Provokation und Foyerspiel. Worauf es uns ankommt, uns, ich meine die Schauspielleitung, die jungen Kollegen, die erfahrenen Mitarbeiter, die mitziehen wollen, ich meine Kollegen Zahmholz und Kollegen Strucks und alle Theaterverrückten, worauf es uns ankommt: Wir probieren für uns und unser Leben. Was uns später vielleicht teuer zu stehen kommt, machen wir erst mal hier. Da kostet es nur den Theateretat. Und unsern Grips. Was wir zwischen erstem Auftritt und letztem Vorhang treiben, verantworten wir. Wir ganz allein. Der Chefdramaturg liest Stücke. Aber warum liest er die denn? Matti, mein neuer Assistent, er sitzt dort drüben, links, macht doch mal’n Spot drauf – also der muss Pläne machen. Als Mathematiker sollte er so was können. Aber warum macht er das? Claudia Pompetzky, noch in der Absolventenzeit, Spot! – ach ihr schlaft! – soll die „Geschlossene Braut“ spielen, ein Zeitstück von einem jungen begabten Dramatiker. Günther Müllerbacher ist für den „Komischen Alten“ besetzt, das ist eine Erstaufführung des polnischen Dramatikers Rozewicz aus Wroclaw. Jetzt plaudere ich schon was aus, gelle? –
Breites Grinsen, schnarchendes Lachen. –
Ja das sind unsere Pläne. Aber warum sind das unsere Pläne? Warum soll der und der das und das spielen? Damit wir sehen, ob unsere Gesellschaft veränderbar ist. Ich träume davon, dass eine Abiturklasse von der Neubauer-Penne ins Theater geht. Scheinbar schläfrige Stille, doch plötzlich ruft einer laut: So geht’s doch nicht! Das muss man anders machen! Na, erst mal –würde ich protestieren: Warum stören die unsere schöne Vorstellung?
Merkt Ihr: Vorstellung – unsere Vorstellung stören! Das ist herrlich doppelsinnig.
Violliné schaut in die Runde, ob er bewundert wird. Drei Techniker kloppen Skat in der Stuhlreihe.