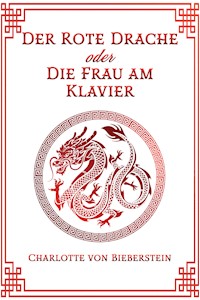
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Walther wächst in Sachsen des 19. Jahrhunderts in einem behüteten und wohlhabenden Umfeld auf. Den Ersten Weltkrieg überlebt er wie durch ein Wunder. Sein Einsatz an der Front führt ihm die Sinnlosigkeit eines Krieges vor Augen. Nach der Revolution und dem Diktat von Versailles bricht eine Welt für ihn zusammen. Wie viele andere auch, sieht er unmittelbar nach der Wirtschaftskrise eine Chance im Nationalsozialismus. Er geht zur Polizei, wird Stellvertreter des Präsidenten der Gestapo. Die anfängliche Sympathie für den Nationalsozialismus verfliegt schnell, als ihm bewusst wird, für welches verbrecherische Regime er arbeitet. Seit 1934 ist er im Widerstand. Im Zweiten Weltkriegs wird er bei der Abwehr eingesetzt, dabei reist er quer durch Europa. Sein dortiger Chef wird später als Top-Spion bezeichnet. Während der Besetzung von Paris ist er mit dem Leiter des militärischen Geheimdienstes der Wehrmacht, Admiral Canaris, im selben Hotel untergebracht. Bei der Abwehr hat er Kontakt zu den Leuten, die am 20. Juli 1944 das Attentat auf Hitler ausübten. Die Biografie erzählt die Lebensgeschichte eines stillen Helden und spannt eine Brücke, indem es das Erlebte detailreich in den historischen Kontext bringt. In dieser überarbeiteten Neuauflage geht die Autorin der Frage nach, was wir aus unserer Geschichte gelernt haben. Und sie stellt fest, dass sich die Demokratie in einer echten Krise befindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Moritzburg
Zwei Generationen zurück
Der Heilige Abend
Schulzeit
Studentenjahre
Der Erste Weltkrieg
Schwere Jahre
Arno Dreschers Erinnerungen
Bekannte und Freunde
Das Gemälde
Die Begegnung, die mein Leben veränderte
Modewarenhaus R. Bernhardt
Hildes Familie
Hauskauf in Moritzburg
Die 1930er Jahre, August Winnig
Widerstand
Der 2. Weltkrieg
Der Untergang Dresdens
Landeskirchenamt
Rekonstruktion um die Frauenkirche
Unmögliches möglich machen
Aus der Geschichte lernen
Wegbegleiter von Walther Hultsch
Der Rote Drache
oder
Die Frau am Klavier
von
Charlotte von Bieberstein
Impressum
Der Rote Drache oder Die Frau am Klavier
2. Auflage Februar 2022
Text: Charlotte von Bieberstein
Umschlaggestaltung: Melanie Popp/
MP-Buchcoverdesign & mehr
Bildquelle: 9comeback/123rf.com
Bilder: Aus dem Familienbesitz
Charlotte von Bieberstein
Schweidnitzer Straße 14
21337 Lüneburg
© 2022
www.charlottevonbieberstein.de
Alle Rechte vorbehalten.
Jede Verwertung bedarf der schriftlichen Genehmig-ung des Autors. Das gilt insbesondere für die Verviel-fältigung, Verwertung, Übersetzung und die Einspei-cherung und Verarbeitung in elektrischen Systemen.
Vorwort
In dieser überarbeiteten und erweiterten Neuauflage meines Buches habe ich die mehr als 300 Seiten umfassenden Erinnerungen meines Großvaters zusammengefasst und seine Lebensgeschichte in den geschichtlichen Kontext gebracht.
Die Erinnerungen wurden von ihm zum Ende des Zweiten Weltkriegs und in der späteren Sowjetischen Besatzungszone aufgeschrieben. Ich habe dieses Werk sehr viel später immer wieder gelesen. Was ich dort las fand ich spannend und ich wollte mehr darüber erfahren. In seinem Vorwort schreibt mein Großvater:
„… Ich möchte alles für unsere Nachkommen niederschreiben, was ich von meinen Eltern und Großeltern gehört habe und was ich selbst erlebte. Mögen unsere Nachkommen Ehrfurcht vor der Vergangenheit, Treue für die Gegenwart und Glaube an die Zukunft von Familie, Volk und Vaterland empfinden.“
In Rezensionen zu der vorangegangenen Auflage heißt es, das Buch sei eher sachlich, ein bisschen würde die persönliche Note fehlen und es fällt schwer eine Beziehung zum Protagonisten aufzubauen. Diese Kritik kann ich nachvollziehen.
Dass das so ist liegt mit daran, dass ich nie eine echte Beziehung zu meinem Großvater, dem Protagonisten, aufbauen konnte. Auch hatte ich leider keine Gelegenheit, mit meinem Großvater über das Erlebte zu reden.
Mein Opa starb mit 93, da war ich 17 Jahre alt. Ich erinnere mich eigentlich nur noch an einen alte Mann, der bei den gemeinsamen Mahlzeiten verschmitzt lächelnd über den Tisch schauend in die Runde fragte „was muss weg?“. Denn die 1980er Jahre in der DDR waren nicht gerade von Überfluss geprägt und als genügsamer Mensch war ihm das Wohl seiner Familie wichtiger als sein eigenes.
Mein Großvater lebte nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR, ich bin in Westdeutschland geboren und aufgewachsen. Beide Teile Deutschlands trennte der eiserne Vorhang. Einmal im Jahr, in den Sommerferien, besuchte ich meine Großeltern in Moritzburg für maximal zwei Wochen. Unsere Nachbarn in Westdeutschland fuhren an die Adria oder nach Spanien, ich fuhr mit meinem Vater mit dem sogenannten Interzonenzug der Deutschen Reichsbahn von Westdeutschland nach Dresden und verbrachte meine Ferien dort. Moritzburg und das Umland haben einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wohnte ich sogar für ein paar Monate im Haus meiner Großeltern in Moritzburg.
Dass mein Großvater in seinen Erinnerungen nicht Klartext schreiben konnte lag daran, dass er zu Beginn der Aufzeichnungen in Nazi-Deutschland und nach dem Krieg in der Sowjetischen Besatzungszone lebte. Er musste also verdammt auf der Hut sein. Beide diktatorischen Regime waren gefährlich und ihm zutiefst zuwider.
Ich wollte mehr zu ihm und zu seiner Geschichte wissen. Dies war dann schließlich der Treiber für mich und der Anlass, dieses Buch herauszubringen.
Das Buch ist kein historischer Roman. Es ist ein Streifzug durch das Leben dieses Menschen. Die einzelnen Lebensabschnitte habe ich versucht in den Kontext zu bringen.
Einiges ist noch unklar – und wird es vielleicht auch bleiben. Denn er war etwa 20 Jahre in der Spionageabwehr tätig und aus diesem Bereich ist nur wenig überliefert. In Unterlagen der CIA und dem britischen National Archive habe ich einige spannende Zusammenhänge zu seiner Zeit bei der Abwehr gefunden. Bei meiner Recherche fand ich auch heraus, dass Admiral Canaris (Leiter der Abwehr, des militärischen Geheimdienstes der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg) und er im besetzten Paris im gleichen Hotel untergebracht waren. Opas Freund und Vorgesetzter Hans Meißner war ein Freund von Canaris. In einer Ausgabe der Zeitung Die Zeit las ich, dass Meißner einer der Top-Spione zu dieser Zeit gewesen ist. Mein Großvater hat viel erlebt. Im Zweiten Weltkrieg ist er als Offizier bei der Abwehr herumgekommen, durch ganz Europa.
Das ganze Kapitel ist aber noch nicht abgeschlossen. Ich bleibe neugierig und suche weiter.
Viel Spaß beim Lesen wünsche ich.
Charlotte von Bieberstein
Januar 2022
Moritzburg
Das Läuten der Kirche auf der anderen Straßenseite der Schloßallee, schräg gegenüber von unserem Haus, weckt mich an diesem Morgen. Es ist ein strahlender Sommertag, die Vögel zwitschern fröhlich, einige scheinen ein eigen komponiertes Lied singen zu wollen. Noch liegt der feuchte Dunst der Nacht über allem.
Von unserem Schlafzimmer im ersten Stock, gehe ich die knarrende Treppe hinunter in das Erdgeschoss unseres um 1723 erbauten Hauses, das im Ort Kellerhaus genannt wird. Man vermutet, dass man hier früher den Wein für das Moritzburger Schloss aufbewahrte.
Die geschwungenen Türöffner im Haus sind genau solche, welche auch im Schloss an den Türen angebracht wurden. Durch den dunklen, nach Feuchtigkeit und altem Holz riechenden Flur, spaziere ich pfeifend und fröhlich die Treppen hinunter. Durch einen runden Türbogen, der aus sächsischem Sandstein besteht, gehe ich hinaus in den sonnendurchfluteten Garten.
Dort angekommen, atme ich erst einmal tief durch und richte mein Gesicht gen Himmel, um die ersten Sonnenstrahlen dieses wunderschönen Morgens einzufangen. Dann gehe ich beschwingt an dem alten Aprikosenbaum, der weinberankten Hauswand und den alten Rosenstöcken vorbei. Auf der linken Seite lasse ich das alte Schwimmbecken vor der alten Birke und der Pappel liegen und wandere weiter zur großen Wiese. Diese fällt zum Bahnhof hin weit ab. Einige hundert Meter bis dorthin ist sie mit alten, knorrigen Obstbäumen besetzt.
Von Weitem hört man schon den auffallenden Ruf eines Schwarzspechts, ein lautes Kliäh, gefolgt von einem Kwih, Kwih, Kwih. Diese schrillen Töne drän-gen das Zwitschern der anderen Vögel beiseite. Vom Bahnhof zieht der Qualm einer Dampflok zu uns herauf. Von den Personenzügen dringen dichte weiße Rauchschwaden, die einen Geruch von Kohlefeuer über die Gegend verbreiten. Dazu kommt noch der frische Duft nach gemähter Sommerwiese und nach behandeltem Holz. Nochmals hole ich tief Luft.
Vom Kohlenmüller dröhnt es dumpf zu mir in den Garten. Sein Grundstück grenzt direkt an unseres und das Geschäft mit dem Verkauf von Kohle befindet sich gegenüber vom Bahnhof. Immer wenn eine große Schaufel Kohle in einen der kleinen LKW Multicar geschüttet wird, welche die Kohle zu den Kunden im Ort transportieren, gibt es einen dumpfen Laut, der über den ganzen Ort hallt. Ohne Braunkohle läuft in der DDR so gut wie nichts. Diese fossilen Ablagerungen sind mit einem großen Abstand der Energieträger Nr. 1 diesem Land.
Der Schwarzspecht ist jetzt ganz still, dafür hört man nun Laute anderer Vögel, viele verschiedene Insekten schwirren über das noch feuchte Gras. Der alte Kirschbaum mit seinen knorrigen Ästen trägt reichlich Früchte, welche bald reif und essbar sein werden. Aber leider wird uns von dieser Ernte wohl wieder nicht viel bleiben, denn die Stare werden auch in diesem Jahr wieder schneller sein als wir.
Der Himmel ist klar, die Sonne strahlt. Es ist einfach ein traumhafter Morgen. Einer der zwei Züge verabschiedet sich mit einem lauten und hellen Pfiff aus dem Bahnhof Moritzburg. Der andere Zug startet kurz darauf fauchend und mit läutender Zugglocke in die entgegengesetzte Richtung, bevor er vor einem der Bahnübergänge zweimal laut pfeift und anschließend das Geräusch der synchron klackenden Wagenräder verhallt. Die Bahn verbindet den Dresdener Stadtteil Radebeul mit Radeburg im Nordosten. Im Moritzburger Bahnhof treffen sich beide Züge auf halber Strecke. Von Radebeul, der Wein- und Karl-May-Stadt, schlängelt sich der Zug durch die Stadt. Ab dem Haltepunkt Weißes Roß hat man einen fantastischen Ausblick auf die Radebeuler Weinberge der Hoflößnitz.
Danach taucht die Bahn langsam in den malerischen Lößnitzgrund ein, bevor sie nach einer steilen Steigung über einem Damm durch die Dippelsdorfer Teiche fährt. Moritzburg ist ein beliebter Ausgangspunkt für viele Ausflugsziele und ein Touristenmagnet. Es laden als Hauptattraktionen Schloss Moritzburg, vielen bekannt durch die Verfilmung Drei Nüsse für Aschenbrödel, und das Fasanenschlösschen zu einem Besuch ein. Aber auch das Landstallamt Moritzburg mit den im Herbst stattfindenden Hengstparaden und der Leuchtturm am Großteich sind beliebte Ziele.
Schloss Moritzburg bei Dresden
Mit dem Hauskauf in Moritzburg während des letzten Krieges hatten wir nach dem Untergang Dresdens 1945 zumindest eine Bleibe für die ganze Familie. Ursprünglich waren das Haus und das Grundstück für meine Schwester gedacht.
Da wir aber nach dem Angriff unser stattliches Haus in Dresden und all unser Hab und Gut verloren hatten, bezogen wir nun dieses behaglich aussehende Gebäude aus der Barockzeit in dem typisch sächsischen Ocker und mit dem Krüppelwalmdach.
Da es nach Kriegsende nichts gab, baute meine Schwester auf dem Grundstück Getreide, Kartoffeln und Gemüse an, manchmal auch eine Reihe Spargel und im alten Schuppen hielt sie Gänse und Ziegen. Dazu gab es reichlich Him-, Stachel- und Johannisbeeren auf dem großen Grundstück und die vielen Obstbäume lieferten zuverlässig eine reiche Ernte an Äpfeln, Birnen, Süß- und Sauerkirschen.
So überstanden wir mit der Familie und den drei Kindern die Nachkriegsjahre auf der eigenen Scholle. Das ist nun alles schon wieder so viele Jahre her. Aber unser Nachbar lässt es sich nicht nehmen, dass er so wie früher mit seinem Pferdegespann sein Feld bearbeitet.
Im Spätsommer stehen dort immer Strohpuppen auf dem abgemähten Feld. Jetzt in den 1980er Jahren in der DDR zeigt sich dort jedes Mal ein Bild wie aus alten Tagen.
Mit laut dröhnenden Motoren kommen mehrere schwere LKWs der Sowjetarmee vom Schloss her die Allee herauf. Es wird vermutet, dass sie aus Großenhain kommen. Wie sich nach der Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands ab 1990 herausstellte, gab es auf dem Flugplatz Großen-hain eine Bunkeranlage. Diese wurde von den Sowjetischen Streitkräften zur Zwischenlagerung von Sonderwaffen während des Kalten Krieges genutzt.
Im Kriegsfall sollten Flugzeuge atomare Munition gegen Ziele im feindlichen Hinterland im Westen einsetzen. Die dafür nötigen Kernwaffenlager wurden auf oder in unmittelbarer Nähe des Militärflugplatzes angelegt. Ab der Moritzburger Kirche lassen sich die oliv gestrichenen LKWs mit den großvolumigen Motoren und den auffälligen runden weißroten Abzeichen CA auf den Fahrertüren, was für Sowjetskaja armija steht, den Berg hinabrollen.
Sie fahren Richtung Dresden, wo die sowjetischen Kasernen sind. Das Motorengeräusch ebbt langsam ab, zurück bleibt eine Abgaswolke, die zu mir herüberzieht. Der so typische süßlich-aromatische Geruch nach russischen LKWs, beziehungsweise deren Abgasen, bleibt lange in der Luft, bis auch er verschwindet.
Die Moritzburger Kirche in ihrer neobarocken Form, soll mit dem Schloss in seiner jetzigen Form korrespondieren.
Mit Moritzburg als unserem Wohnsitz, haben wir eine sehr gute Wahl getroffen. Das wunderschöne Schloss mit den vier großen Türmen, allesamt in einem markanten sächsischen Gelb gestrichen und eingebettet in den Schlossteich, ist nur wenige hundert Meter von unserem Haus entfernt. Im Schloss wohnte bis Kriegsende 1945 Prinz Ernst Heinrich, der von den Russen flüchtete und von dem ich noch erzählen werde.
Wir leben in einer traumhaften Landschaft, umgeben von Teichen, Wiesen, Feldern und Wäldern. Angrenzend liegt die Lößnitz mit ihren historisch-wertvollen Gebäuden und dem Weinanbau. Einst kurfürstliches Weingut und ländlicher Rückzugsort der Wettiner, ist die heutige Stiftungsanlage Hoflößnitz, ein idyllisches Kleinod im Zentrum der sächsischen Weinkulturlandschaft.
Ein wenig abseits der barocken Paläste und der großen Touristenströme besticht dieser Hof mit romantischem Charme, schlichter Eleganz und der stillen Heiterkeit der einzigartigen Landschaft.
Deprimierend und belastend für mich ist allerdings die politische und die wirtschaftliche Situation hier in der DDR.
Ich hatte eine glückliche Kindheit und wuchs in einem sehr behüteten, gut situierten Umfeld auf. Die Familie, Kunst und Kultur spielten eine große Rolle in unserem Leben.
In den vergangenen Jahrzehnten habe ich viele interessante Menschen kennengelernt. Zum Beispiel Personen aus dem Sächsischen Königshaus, bekannte Maler, Musiker und Sänger.
Es waren Menschen, die durch ihren Einsatz im Widerstand in die Geschichtsbücher eingegangen sind und Bischöfe der Landeskirchen. An beiden Weltkriegen habe ich als Offizier der Reserve teilgenommen und wie durch ein Wunder habe ich beide Kriege überlebt.
Für dieses Leben bin ich sehr dankbar. Mein Leben war aber auch ein Leben voller Entbehrungen, großer Enttäuschungen und diverser Schicksalsschläge. Hiervon möchte ich nun erzählen.
Nach der Kapitulation der deutschen Streitkräfte Ende des Zweiten Weltkriegs wird von den Alliierten beschlossen, Deutschland in vier Besatzungszonen und Berlin in vier Sektoren zu teilen.
Die Sowjetunion setzte in der von ihrer besetzten Zone die Sowjetische Militäradministration ein. Diese sollte den Aufbau des politischen Systems im Sinne der Sowjetunion steuern und die Besatzungszone verwalten. Die Wirtschaft in der Sowjetischen Besatzungszone wurde zunächst durch die sowjetischen Demontagen massiv beeinflusst. Bis Ende 1946 ließ man über 1.000 Betriebe, vor allem den Maschinenbau, die chemische und die optische Industrie sowie das jeweils zweite Gleis und die Elektrifizierung fast aller Bahnstrecken abbauen. In einer zweiten Etappe wurden Reparationen aus der laufenden Produktion entnommen und etliche Betriebe, die schon bestanden oder neu gegründet wurden, als sowjetische Aktiengesellschaften in das Eigentum der Sowjetunion überführt.
Dadurch gingen der späteren DDR etwa 50 Prozent der industriellen Kapazitäten verloren, die auf ihrem Territorium bei Kriegsende bestanden hatten. 1945 führte man eine Bodenreform durch, bei der ungefähr ein Drittel der gesamten Wirtschaftsflächen zur Verteilung kamen. Eine Million Hektar überführte man in staatseigene Güter. Das Ziel war die Gründung von Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften.
Insbesondere Bauern und kleine Handels- und Gewerbebetriebe sollten durch erhöhte Abgaben zur Aufgabe ihrer Selbstständigkeit gezwungen werden. Auch der Kurs gegenüber den Kirchen verschärfte sich. Größere Privatunternehmen wurden enteignet und in volkseigene Betriebe überführt.
Auch in der Landwirtschaft begann die Kollektivierung. Die Bauern, die zum Teil erst in der Bodenreform wenige Jahre zuvor ihr Land bekommen hatten, wurden nun gedrängt, in landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften einzutreten. Nachdem weit über eine Million Menschen aus der DDR geflüchtet waren, wurde ein Gesetz verabschiedet, das ein Verlassen der DDR ohne staatliche Genehmigung als „Republikflucht“ kriminalisierte. Bis 1961 hatten knapp drei Millionen Menschen die DDR seit ihrer Gründung verlassen. Da es sich dabei oft um gut ausgebildete Menschen handelte, bedrohte diese Abwanderung die Wirtschaftskraft der DDR und letztlich den Bestand des Staates.
Ab dem 13. August 1961 wurde deshalb die Berliner Mauer aufgebaut, um eine weitere Abwanderung zu stoppen.
Höhere Löhne und Renten, staatlich subventionierte Mieten und Lebensmittelpreise sowie ein Wohnungs-bauprogramm gehörten zu den Sozialleistungen, die das SED-Regime ausbaute, um die Zufriedenheit der Ostdeutschen zu steigern.
Da die Devisenknappheit weiter zunahm, baute Alexander Schalck-Golodkowski die Abteilung Kommerzielle Koordinierung innerhalb des Ministeriums für Außenhandel auf. Diese sollten mit allen Methoden zusätzliche Devisen beschaffen und bestehende Embargos gegen die DDR umgehen.
Gegen Ende der 1980er Jahre wurde der wirtschaftliche Verfall der DDR-Wirtschaft trotz dessen zunehmend sichtbar. Bereits seit langer Zeit zehrte sie nur noch von ihrer Substanz, da sie Neuinvestitionen oder Reparaturen nicht mehr finanzieren konnte. Das Ende nahte, was zu diesem Zeitpunkt aber niemand voraussagen konnte. Allein Improvisationskunst und der westliche Devisentropf vermochten den wirtschaftlichen Verfall halbwegs aufzuhalten. Doch die ständig steigenden Kreditzinsen und Tilgungsraten ließen die Schuldenlast der DDR gegenüber dem Westen bis 1981 auf 23 Milliarden DM der Deutschen Bundesbank anwachsen.
1982 stand die DDR kurz davor, die Zahlungsunfähigkeit zu erklären. Rettung in der Not brachte 1983 ein Milliardenkredit bundesdeutscher Banken, den der staatliche Devisenbeschaffer Schalck-Golodkowski mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß eingefädelt hatte.
Diese Finanzspritze in Milliardenhöhe rettete zunächst die Zahlungsfähigkeit der DDR und sorgte für wirtschaftliche Entspannung. Im Gegenzug musste die DDR die Zügel lockern. Abbau von Selbstschussanlagen und Minen an der deutsch-deutschen-Grenze, sowie Erleichterungen bei Familienzusammenführungen mussten stattfinden.1
Für mich war es eine Qual und eine unendliche Belastung, meinen Lebensabend in diesem Teil Deutschlands verbringen zu müssen. Eingesperrt, reglementiert, im Visier der Staatssicherheit, getrennt von meinem ältesten Sohn und seiner Familie, der 1957 in den Westen Deutschlands ging und dortblieb. Vor allem in den staatlichen und großen Betrieben der DDR wuchs die Unzufriedenheit. Es fehlte an technischen Ausrüstungen, Ersatzteilen und Rohstoffen, sodass sich die Zeiten des Stillstands der Maschinen in den Betrieben häuften. Arbeitsorganisation und Arbeitsdisziplin waren miserabel und die Motivation der Beschäftigten näherte sich dem Nullpunkt. So kam es vor, dass Einkäufe von knappen Konsumgütern während der Arbeitszeit erledigt wurden. Gleich nebenan in der Kaufhalle stand man für grüne Orangen, die es meist nur zur Weihnachtszeit gab, bis auf die Straße an.
Die ökologischen Probleme, mit denen sich die Regierung de Maizière im Frühjahr 1990 konfrontiert sah, waren verheerend. Auch für die Bevölkerung der DDR waren die Umweltbelastungen fast überall wahrnehmbar.
Besonders gravierend war die Luftverschmutzung durch Schwefeldioxid und Kohlendioxid, die durch die Verbrennung von Braunkohle entstand.
Braunkohle war der größte Energieträger der DDR, doch die Kraftwerke waren veraltet. Es fehlte an Entschwefelungsanlagen. Die Belastungen waren so stark, dass viele Menschen in den betroffenen Regionen zum Beispiel rund um die Industriezentren über-durchschnittlich oft an Atemwegserkrankungen und Ekzemen litten. Der Industrienebel sorgte regelmäßig für Smog-Alarm in den Städten und Dörfern und hinterließ Staubschichten auf Autos, Fensterbänken und zum Trocknen im Freien aufgehängter Wäsche.
Auch die Gewässer waren hochgradig belastet. Die chemische Industrie leitete ihre Abwässer ungeklärt und schadstoffbelastet in die Flüsse und Seen ein. Insgesamt waren viele Flüsse und Seen in der DDR 1990 ökologisch völlig zerstört.2
www.bpb.de↩
https://deutsche-einheit1990.de/ministerien/muner/verschmutzung↩
Zwei Generationen zurück
Mein Großvater war Grundstücks- und Mühlenbesitzer, geboren 1826 in Steinigtwolmsdorf. Der Ort liegt eingebettet in der malerischen Landschaft des Oberlausitzer Berglandes und ist heute eine Gemeinde im Landkreis Bautzen, im Südosten des heutigen Freistaates Sachsen.
Wegen seiner Besonnenheit und seines klugen Rates genoss mein Großvater großes Vertrauen und Ansehen im Dorf. Als Gelegenheitsdichter war er sehr geschätzt. In der unruhigen Zeit um 1848 war er Leutnant der Bürgerwehr, die zum Schutz der Einwohner gegründet worden war.
An jedem Sonnabend besuchte er zu Fuß den Bautzener Getreidemarkt, wo er sein Getreide einkaufte. Dort traf er immer den Mühlenbesitzer Zumpe, mit dem er sehr gut befreundet war. Zumpe war der Vater des 1850 in Oppach geborenen Dirigenten, Komponisten und Wagner Schüler Herman Zumpe, von dem ich später noch erzählen werde. Aus der Ehe der Großeltern gingen eine Tochter und fünf Söhne hervor. Unser Vater lernte in seinem 5. Lebensjahr Lesen und Schreiben. Seine ersten Klavierübungen spielte er auf dem Spinett seines Großvaters. Da er ein zartes Kind war, sagten die Nachbarsfrauen zu seiner Mutter ständig in einem mitleidigen Ton „Den kriegt ihr nicht groß“. Das Leben in der Familie war durchweg harmonisch. Bei der allgemeinen mangelhaften Beleuchtung bildete der Kienspan die einzige Lichtquelle, befestigt an einem eisernen Ring an der Wand.
Bei diesem kümmerlichen Licht las Großvater abends das Bautzener Wochenblatt im Ohrenlehnstuhl, während das übrige Zimmer im rembrandt‘schen Halbdunkel lag. Erst später kamen Öl- und Petroleumleuchten auf. Jeder Tag wurde mit einem Abendgebet beschlossen.
Während seine Brüder Landwirte wurden, zog es unseren Vater zu einem geistigen Beruf. Im Jahre 1867 wurde er im Landständischen Seminar in Bautzen aufgenommen. In diesem Internat lebte sich unser Vater schnell ein.
Die Disziplin war damals strenger als heute. Schlafsäle und Waschräume waren im Winter eiskalt. Urlaub gab es nur sonntags von 12:00 bis 19:00 Uhr am Abend. Unser Vater nutzte diesen Zeitraum für einen Besuch in der Heimat. Nach einem dreistündigen Fußmarsch erreichte er Steinigtwolmsdorf. Dort konnte er im Elternhaus gerade einmal eine Stunde Rast halten, danach musste er, mit Wäsche und Lebensmitteln versehen, wieder forteilen, um pünktlich im Internat anzukommen.
Unser lieber Vater hat uns viel aus seiner Kindheit erzählt, er erzählte uns von Familie, Land und Leuten. Auf vielen Reisen hat er uns unser Vaterland gezeigt, für dessen Geschichte und vor allem Kunstgeschichte er uns Kinder von frühester Jugend an begeisterte.
Der Vater fand als Seminarist viel Freude am Zeichnen, an Kunstgeschichte und Musik, besonders am Klavier- und Orgelspiel. Sein Lehrer war der Kgl. Musikdirektor Karl Eduard Hering. Spielte dieser die Orgel, so kam es schon einmal vor, dass er unserem Vater „Ablösen“ zurief, damit er ihn ablöste.
Mitten im Choralspiel nahm er plötzlich die Hände von den Tasten und mein Vater musste als Orgelpräfekt schnell in die Tasten greifen. War der Gottesdienst schwächer besucht, so sagte der schwerhörige Hering „Spielen ‘se schneller. Es sind wenig Leute da“ sehr laut.
Unser Vater lauschte begeistert den Erzählungen alter Bauern, die noch zu der Zeit Napoleon I. mitgekämpft und 1812 mit in Russland gewesen waren. Die alten Bauern trugen damals langes, nach hinten gekämmtes Haar, das am Hinterkopf mit einem Kamm festgehalten wurde.
An Spinnstubenabenden wurden Spukgeschichten erzählt, so auch vom Baron Starschedel, dem das Rittergut Steinigtwolmsdorf einst gehörte, und der dort als Geist umgehen sollte. Als das Herrenhaus abgebrannt war, blieben nur die vom Baron bewohnten Räume unversehrt. Das wurde als ein Zeichen des Teufels gedeutet. Mit dem jungen, netten Freiherrn Oppen von Huldensberg, deren Familie die Rittergüter Steinigtwolmsdorf und Neukirch gehörten, hatte unser Vater als Kind oft gespielt. Die von Oppen gehörten zum Uradel Obersachsens und verbreiteten sich auch in der Niederlausitz, in Schlesien, im Königreich Sachsen und im Herzogthum Anhalt.
Gern erzählte unser Vater, wenn wir als Kinder an kalten Winterabenden mit ihm auf dem Sofa saßen, und ich mich in seinen Schlafrock wickelte, von der Beobachtung der Nordlichter in seiner Jugend. Auch von Irrlichtern über sumpfiges Gelände, die mit ihrem plötzlichen Aufleuchten und Verschwinden etwas Geheimnisvolles darstellten und manchen Wanderer in der Nacht vom rechten Wege abbrachten.
Vater besuchte die Königliche Kunstgewerbeschule in Dresden. Später wurde diese zur Kunstgewerbeakademie ausgebaut, welche damals am Antonplatz neben der Markthalle untergebracht war. Als der begeistere Kunstjünger das Schulgebäude betrat, begegnete er einem würdigen Herrn mit „Vatermörder“ in Biedermeiertracht, die er stets zu tragen pflegte.
Professor Dr. August von Eye, bekannt durch sein Werk „Leben und Wirken Albrecht Dürers“. Prof. von Eye gab unserem Vater Gegenstände aus dem Kunstgewerbemuseum als Modell, die er zeichnen musste. Bald lebte sich der junge Kunstschüler in Dresden ein. Eine passende Wohnung fand er bei Kantor Alscher in der Breitestraße. Bei diesen waren einst zur Weihnachtszeit Tiroler Sänger aus dem Zillertal erschienen und hatten ihn gebeten, am Heiligen Abend in der Kirche zu singen. Sie sangen das bis dahin in Sachsen unbekannte Weihnachtslied “Stille Nacht, Heilige Nacht“, das in der Folgezeit zum Volkslied wurde.
Unser Vater, dessen Geldmittel in seiner Dresdner Zeit sehr beschränkt waren, hatte ein Stipendium des Grafen Luckner erhalten. Luckner, der durch seine originellen Späße bekannte Kgl. Sächsische Kammer-herr. Vater sollte auf Empfehlung von Geheimrat Graff die Jungen einer in Dresden lebenden, englischen Familie auf ihren Spaziergängen begleiten.
Die Familie bestand aus der Mutter, einer jungen, schönen Frau, zwei schönen Töchtern im Alter von etwa 14–16 Jahren und den Söhnen im Alter von etwa 8–10 Jahren. Sie wohnten in der Strehlener Straße in einer sehr großen Wohnung mit viel Personal.
Der Vater war angeblich im Zweikampf gefallen. Ein echt englischer Butler in Kniehosen und Schnallen-schuhen empfing mit undurchdringlicher Miene immer die Besucher. Beim Besuch des Zoologischen Gartens erfuhr er, dass der kleine Engländer Algernon Fitz Roy und der andere Charles Herzog von Southampton hieß. Fitz Roy war später ein britischer Politiker der Conservative Party und Speaker des Unterhauses. Die mit dem englischen Königshaus verwandte, hochadlige Familie lebte in England. Die gemeinsamen Ausflüge führten sie ins Elbsandsteingebirge und in Museen. Den Museumsbesuchen schloss sich die Mutter mit ihren zwei Töchtern oft an, zumal Vater die Bilder erklärte und auf besonders hervorragende Werke hinwies.
Er ging mit den Jungen schwimmen und Rollschuhlaufen auf der Bahn in „Lüdeckes Wintergarten“ in der Nähe des Großen Gartens. Da er niemals Rollschuh gelaufen war, erregten seine ersten Laufversuche helle Begeisterung bei den fröhlichen Jungen. Bei Ausflügen wurden Molche, Salamander und Blindschleichen gefangen. In der Wohnung hielten sie weiße Mäuse, die infolge ihrer starken Vermehrung schnell zur Plage wurden, sehr zum Leidwesen des vornehmen Butlers.
Vater und ich waren viel zusammen mit seinem ehemaligen Schüler Arno Drescher, der später Direktor der Akademie in Leipzig wurde und für dessen Sohn Christoph ich später Patenonkel war. In seiner Dresdner Zeit war für unseren Vater seine Reise zur Weltausstellung in Wien im Jahre 1873 eine bedeutsame Unterbrechung seiner Studien nötig. Meine Schwester hat seine Erlebnisse in Wien niedergeschrieben.
In meiner Jugend waren die Reisen nicht so umfangreich. Mein kleines Dorf hatte meistens Leineweber, die wöchentlich 6–19 Mark verdienten, und von denen einige mit ihrer Leinwand die umliegenden Jahrmärkte besuchten.
Nach Bautzen, dort wo mein Vater jeden Sonnabend sein Getreide kaufte, durfte ich jährlich zweimal mitfahren. Dort kaufte ich mir dann für einen Sechser eine dicke Grützwurst.
Mein Großvater, der nachts wegen der Mühle viel wach sein musste, lieh sich jede Woche von einem alten Büchermann ein Buch. Darunter waren vielfach Reisebeschreibungen, die ich auch lesen durfte. Daher mag es wohl auch kommen, dass der Wandertrieb in mir sehr geweckt wurde. Bei einem Besuch in Dresden lief ich mit meinem Bruder ungefähr 45 Kilometer bis Schandau, zurück fuhren wir dann mit dem Dampfschiff.
Mit meinem gesparten Geld konnte ich meinen Bruder freihalten. Ich bestellte mir in einem Gasthaus eine gefüllte Taube, mein Bruder entschied sich für einen Schweinebraten. Als das Essen kam, erhielt mein Bruder eine tüchtige Portion, mein Täubchen war etwa nur so groß wie eine Zitrone.
Der Schweinebraten kostete 60 Pfennige, die Taube 10 Neugroschen. Zu meinem Leidwesen war mein Bruder satt, ich jedoch noch hungrig wie zuvor.
Auerbach sollte für meinen Vater zur zweiten Heimat werden. Dort lernte er unsere geliebte Mutter kennen. Ihre Eltern rieten ihr allerdings von der Heirat ab, denn sie wollten für sie einen Fabrikanten als Mann haben.
Deren Firma C.H. Lange blühte zu dieser Zeit richtig auf. Nach dem Ausland, insbesondere der Schweiz, wurden Geschäftsbeziehungen geknüpft und durch persönliche Reisen vertieft.
Die Firma C.H. Lange war eine der führenden Gardinen- und Spitzenwebereien und Bleichereien und als einzige ihrer Art, die nach einem Jahrhundert noch der Familie angehörte. Beide Großeltern waren unermüdlich darin tätig. Der Großvater zeichnete die Spitzen- und Stickereimuster selbst. Ein noch vorhandenes Musterbuch zeigt sein zeichnerisches Geschick und seinen feinen Geschmack. Im Göltzschtal hatte der Großvater eine Bleicherei und Appretur Anstalt mit viel Grundbesitz und in der Nähe des Bahnhofs eine Gardinenfabrik errichtet.
Vorne links die Firma C.H. Lange in Falkenstein
Nach einigen Jahren kaufte er das Göltzschwerk dazu. In Oberitalien errichtete er die erste Gardinenfabrik in Somma die Lombardo bei Mailand.
Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Firma enteignet und arbeitete nun unter dem Namen „VEB Falkensteiner Gardinenweberei und Bleicherei“ weiter.
Später wurden weitere Firmen angeschlossen, schließlich wurde sie in „VEB Gardinen- und Spitzenwebereien Falkenstein“ umbenannt. Die FALGARD besaß 16 Produktionsstätten. Mit der Vereinigung 1970 zum Großbetrieb „VEB Plauener Gardine“, dem größten Textilbetrieb Europas, umfasste die Belegschaft ungefähr 5500 Beschäftigte.1
Im Jahre 1878 trat unsere Mutter ins Töchterpensionat von Madame Daulte de Giez in Vevey am Genfer See ein. Dort verbrachte sie zwei herrliche Jahre, lernte fließend Französisch und schloss viele neue Mädchenfreundschaften. Bis zu ihrem Tode schwär-mte sie von dieser schönen Zeit. Ihre sehr gute Freundschaft mit Frieda Kraft aus Berlin übertrug sich auch auf uns, besonders auf unsere Schwester Marthel. Deren Familie entstammte auch General Karl Litzmann. Er war der Sieger von Brzeciny und Kowno, mein Korpskommandeur im Ersten Weltkrieg und der Maler Hans Lietzmann in Torbole, bekannt durch seine Bibelillustrationen.
Friedas Besuche hatten immer viel Munterkeit in unser Haus gebracht. Da Frieda einen sehr großen Bekanntenkreis hatte, waren ihre Erzählungen und Briefe überaus interessant. Später las sie aus ihren Werken vor, die meist die Geschichte Preußens behandelten.
Schließlich fand aber die Verlobung unserer Eltern im Oktober 1882 statt. Sie zogen als Neuverheiratete in das Haus von Frau Hetzer, wo sie das geräumige 2. Stockwerk bewohnten. Das stattliche Haus mit seinen Fensterläden stand in einem großen Garten an der Göltzsch am Spittelberg. Fast täglich besuchte das Paar die Großeltern.
Im großelterlichen Hause versammelte sich sonntags meist die gesamte Familie. Die Enkel hatten ihre Freude im großen Garten mit den beiden Springbrunnen, der Kegelbahn und dem Spielplatz. Im Sommer wurden gemeinsame Reisen unternommen. Zum Beispiel an den Rhein, in die Schweiz und nach Italien mit Besuch von Somma di Lombardo. Zu Pfingsten pflegten die Lausitzer Verwandten zu Besuch zu kommen. Wir verbrachten eine frohe Jugend.
In der Zeit meiner Jugend machte wir eine Reise nach Italien. Während der Überfahrt über den Comer See erkrankte plötzlich meine Mutter. Wie ein Lauffeuer ging es durch das Schiff. „Die deutsche Dame hat die Cholera“, munkelten einige Passagiere. Der Kapitän isolierte daraufhin meine Eltern, welche dann lediglich einige Erfrischungen durch ein kleines Schiebefenster gereicht bekamen.
In Somma stellte sich aber dann heraus, dass unsere Mutter nicht an Cholera, sondern an einer Blinddarmentzündung erkrankt war. Trotzdem hing ihr Leben am seidenen Faden. Als meine kranke Mutter nach wochenlangem Krankenlager nun endlich der Genesung entgegenging, konnte unser Vater sie wieder für einige Stunden allein lassen. In diesen traf er sich dann meistens mit dem Herrn Apotheker Dolci, einem freundlichen Italiener.
Mit ihm fuhr er nach Mailand, dessen Bauten ihn unheimlich begeisterten. Herr Dolci war es auch, der die Firma meines Vaters später kaufte. Als es unserer Mutter wieder besser ging, konnte endlich unsere Heimreise in kurzen Tagesreisen angetreten werden. Unsere Mutter schilderte uns später oft ihre große Sehnsucht, mit der sie nach uns Kindern, nach den Eltern und nach ihrer Heimat verlangte.
Wir Kinder besuchten die dem Königlichen Seminar angegliederte Seminar-Übungsschule. Enge Freund-schaft hielt ich mit dem zwei Jahre älteren Nachbarsohn Ernst Thrändorf. Er war der Sohn von Prof. Thrändorf. Diese Freundschaft hielt durch die ganzen Studentenjahre hindurch und fand leider mit seinem Tod im 1. Weltkrieg ein jähes Ende.
Am Vorabend des 1. Mai zu Walpurgis, beteiligten wir uns am Besenbrennen am Bendelstein. Hierbei wurden alte Reisigbesen mit Hobelspänen umwickelt und in Pech getaucht, danach wurden sie angezündet und im Kreise geschwungen. Auf allen Höhen loderten nach dem Brauchtum unserer Ahnen die großen Feuer.
Im Sommer fuhren wir auf Bretterflößen auf dem kleinen Teich im großelterlichen Garten, den wir im Winter zum Schlittschuhlaufen benutzten. Im Winter war auf dem Maschinenteich eine Eisbahn. Vetter Curt, ein begabter Bastler mit großer technischer Begabung, unternahm vom Schuppendach aus Flugversuche, fotografierte viel und legte Telefonleitungen.
Welch herrliche Verstecke gab es, wenn wir „Räuber und Gendarm“ spielten. Da war das Gewächshaus mit seiner herrlichen weißen Rose und dem Feigenbaum, das „Lusthaus“ mit seinen bunten Glasfenstern auf einem Hügel am Teich und der Schuppen. Dann war da noch der Eiskeller, in dem später der treue Kutscher Onkel Gustavs durch eigen entwickelnde Gase auf tragische Weise den Tod fand, die Wagenremise, in der die Landauer, die offenen Kutsch- und Jagdwagen und Schlitten standen und in der die Ledergeschirre ihren unvergesslichen Geruch verbreiteten. Abends las unser Großvater in Gegenwart unserer Großmutter uns Kindern den Abendsegen vor, danach gingen wir ins Bett. Nach dem Studieren der Morgenzeitung ging unser Großvater häufig in sein Kämmerchen, eine regelrechte Handwerkerstube, ausgestattet mit Hobelbänken, Buchbindemaschine und allem erdenklichen Geräten. Auf dem Gaskocher brutzelte der Leimtopf. In diesem Kämmerchen entstanden verschiedene Bastelarbeiten, besonders die Pyramiden, die zu Weihnachten Alt und Jung erfreuten.
In den Ferien begleiteten wir unseren Großvater nach Falkenstein, wo er auch nach seinem Austritt aus der Firma immer wieder nach dem Rechten sah. Bei den Arbeitern war er immer sehr beliebt.
In der kleinen Schänke neben der Bleicherei saß er in den Pausen mitten unter ihnen und bezahlte die ganzen Getränke. Zuhause pflegte er immer zu sagen „Wir müssen alles auf dieser Erde zurücklassen“. Aufmerksam verfolgte er die Politik und er war ein glühender Anhänger Bismarcks. Als sozial denkender Arbeitgeber bekämpfte er jede Lohndrückerei, wie sie von vielen heimischen Fabrikanten leider betrieben wurde.
Erwähnenswert ist noch die Tante unserer Großmutter Lange, die mit dem Direktor der Kaiserlich Russischen Lithografischen Anstalt in Petersburg, Johann Carl Pohl, verheiratet war. Lange Freundschaft verband Carl Pohl mit dem russischen Ministerpräsidenten Fürst Gortschakow, der ihn auch in Dresden besuchte. In großer Gunst stand Pohl bei dem Zaren Nikolaus I., den er häufig durch das Kabinett führte.
Noch heute besitzen wir Ringe, Vasen und Gebrauchsgegenstände, die der Zar ihm geschenkt hatte.





























