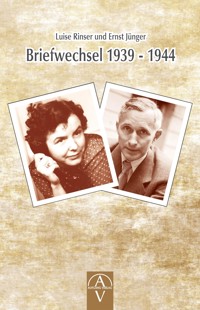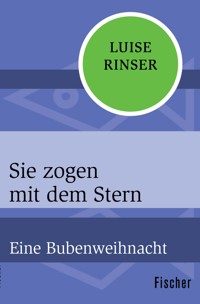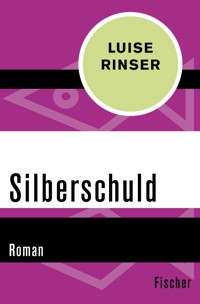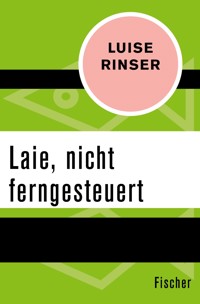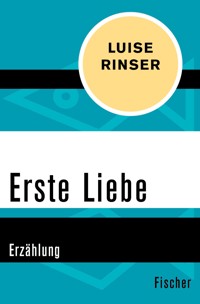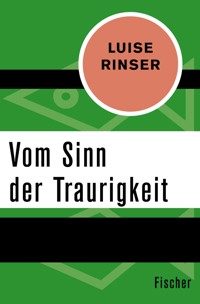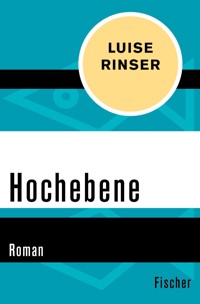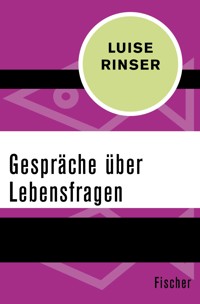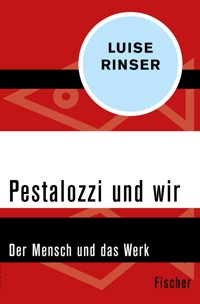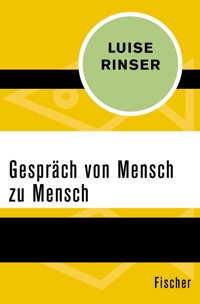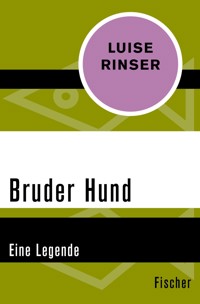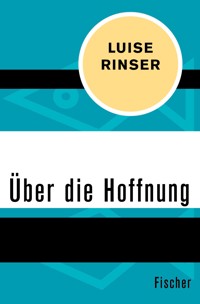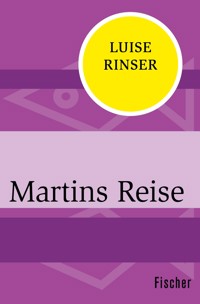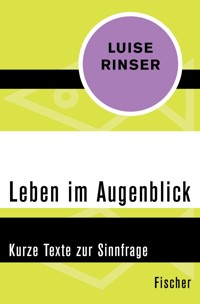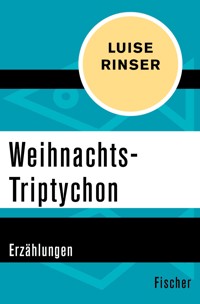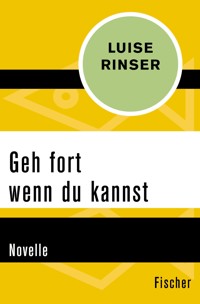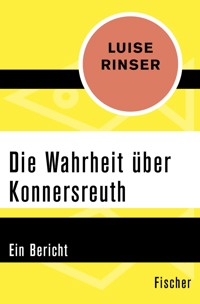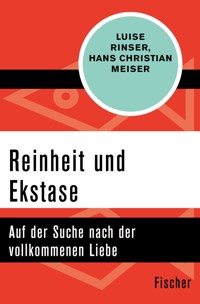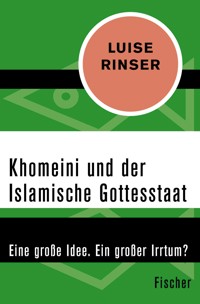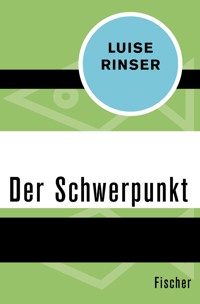
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Luise Rinser porträtiert fünf Zeitgenossen: Annette Kolb, Franz Werfel, Carl Zuckmayer, Elisabeth Langgässer und Bertolt Brecht. Gemeinsam ist diesen Essays das Eingehen auf grundlegende Fragen unserer Epoche, und ihr Reiz besteht in der Gegenüberstellung der Dichter, die hier charakterisiert werden. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Luise Rinser
Der Schwerpunkt
Über dieses Buch
Dieser Band enthält Porträts von fünf Zeitgenossen: Annette Kolb, Franz Werfel, Carl Zuckmayer, Elisabeth Langgässer und Bertolt Brecht. Gemeinsam ist diesen Essays das Eingehen auf grundlegende Fragen unserer Epoche, und ihr Reiz besteht in der Gegenüberstellung der Dichter, die hier charakterisiert werden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Luise Rinser, 1911 in Pitzling in Oberbayern geboren, war eine der meistgelesenen und bedeutendsten deutschen Autorinnen nicht nur der Nachkriegszeit. Ihr erstes Buch, ›Die gläsernen Ringe‹, erschien 1941 bei S. Fischer. 1946 folgte ›Gefängnistagebuch‹, 1948 die Erzählung ›Jan Lobel aus Warschau‹. Danach die beiden Nina-Romane ›Mitte des Lebens‹ und ›Abenteuer der Tugend‹. Waches und aktives Interesse an menschlichen Schicksalen wie an politischen Ereignissen prägen vor allem ihre Tagebuchaufzeichnungen. 1981 erschien der erste Band der Autobiographie, ›Den Wolf umarmen‹. Spätere Romane: ›Der schwarze Esel‹ (1974), ›Mirjam‹ (1983), ›Silberschuld‹ (1987) und ›Abaelards Liebe‹ (1991). Der zweite Band der Autobiographie, ›Saturn auf der Sonne‹, erschien 1994. Luise Rinser erhielt zahlreiche Preise. Sie ist 2002 in München gestorben.
Impressum
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei FISCHER Digital
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Copyright © by Christoph Rinser
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München
Covergestaltung: buxdesign, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-561134-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
L.D.
Annette Kolb
Franz Werfel
Carl Zuckmayer
Elisabeth Langgässer
Bertolt Brecht
Bibliographische Notiz
L.D.
Annette Kolb
BEINAHE ALLEs, was es über Annette Kolb zu sagen gibt, hat sie bereits selbst vor langem gesagt: im ›Exemplar‹, diesem ihren frühen Roman. Denn die Heldin Mariclée ist die junge Annette selbst. Sie hat sich scharf gesehen, aus beträchtlichem Abstand zu sich selber, und sie hat sich dem Leser mit entzückend wohldosierter Offenheit vorgestellt, mit überaus gescheiter und etwas melancholischer Selbstironie, mit anmutigem Stolz und einer schwebenden Gelassenheit (die Sympathie des Lesers zugleich erheischend und nonchalant abweisend), fern von intellektueller Lust an der Selbstanalyse, doch mit einem bisweilen durchdringend scharfen Blick in die Tiefe. Ein Meisterstück der Selbstdarstellung (und nicht zu vergessen: ein bezaubernder und eigentümlicher Liebesroman).
Und was ist es, das Annette Kolb von sich selber sagt, und das nur mehr zu kommentieren verbleibt? Wir werden es hören. Beginnen wir mit jenem fast trivialen Satz, mit dem sie eine komplizierte Betrachtung über Mariclées Stolz abschließt: »Kurz, sie war ein Original.«
Annette Kolb ist ein Original: ursprünglich, aus erster Hand, ein besonderer und darum köstlicher Wurf; und sie ist ein »Original« auch im heute gebräuchlichen Sinne: ein wenig verquer, und, wie sie von Mariclée sagt, behaftet mit einem »Spleen«, das will heißen: mit der Neigung zu absonderlichen Launen.
Als Original dieser Art zeigt sie sich gewöhnlich ihren (zahlreichen) Besuchern. Vor allem ihre ein wenig närrisch anmutende Zerstreutheit ist es, die auffällt. Es gibt keinen, der sie je sah und dabei nicht Zeuge wurde einer jener ebenso komischen wie aufregenden und hintergründigen Szenen der besessenen Suche nach irgendeinem Gegenstand, der sich schließlich dicht vor ihr findet. Diese Zerstreutheit ist ihr nicht etwa im Alter erst entstanden: sie scheint ein Familienerbteil zu sein, und wir könnten uns damit begnügen, auf ihren Roman ›Die Schaukel‹ hinzuweisen; er ist autobiographisch, und »Frau Lautenschlag« ist Annettes Mutter, eine Träumerin, »auf chronischer Suche nach ihren Schlüsseln und Tagebüchern«, und auch vom Vater sagt sie, seine Zerstreutheit sei ungemein gewesen. Doch will uns scheinen, daß hinter Annette Kolbs Zerstreutheit etwas anderes steht. Doch was? »Sie war nicht zerstreut, sie war abgewandt«, erzählt sie von Mariclée. Wovon ist Annette abgewandt und wohin gewandt? Diese Frage zielt pfeilgerade in ihr innerstes Wesen. Doch ist die Antwort nicht leicht zu finden. Die einfache Erklärung wäre dies: Wer in hohem Maße mit sich selbst beschäftigt ist, mit den Vorgängen im eignen Innern, der wird alle Erscheinungen der äußeren Welt nur »zerstreut« wahrnehmen. Doch trifft es auf Annette Kolb nur halbwegs zu. Denn sie, äußerlich nirgendwo wirklich beheimatet, ist nicht einmal in sich selber ganz daheim. Mit voller Bewußtheit ist sie nur flüchtiger Gast bei sich. Und weshalb? »Mariclée mußte immer vergessen.« Das ist die Erklärung. Und was mußte und muß Annette Kolb vergessen?
Gleich Mariclée hat sie nicht nur ein Leben, sondern ein verstricktes Netz von Leben. Diese vielen, auf so verschiedenen Ebenen angesiedelten und eigensinnig auseinanderstrebenden Leben zur Einheit zu bringen, – was für eine Aufgabe! Es ist nicht Annette Kolbs Sache, in harten Widersprüchen und dramatischen Spannungen zu leben, noch ist es ihr gegeben, das Widersprüchliche aufzuheben in der strengen Ordnung unter eine einzige Idee. Sie findet eine originelle Lösung: sie »vergißt«. Sie vergißt das jeweils Nicht-Passende, das Sperrige; so findet sie ihre Art von Harmonie, eine höchst kunstvolle, eine stilisierte, eine überaus leicht zu störende Harmonie, deren Künstlichkeit sie selbst recht gut durchschaut, die sie gleichwohl annehmen muß, da sie die ihr einzig mögliche Art der Bewältigung des Lebens ist.
Und welches sind die Widersprüche, die es durch »Vergessen« zu überwinden gilt? Es sind deren viele.
Da ist zunächst das Widersprüchliche ihrer gesellschaftlichen Stellung. Nicht wichtig für uns, gewiß, doch nicht zu übersehen, da es sich um eine Zeit handelt, in der Rangordnungen dieser Art noch lebenbestimmend sein konnten. Ihre Eltern waren »Bürgerliche«, dem geistigen Habitus nach obgleich nicht eigentlich ausübende Künstler, so doch Künstler mehr als irgend etwas anderes. (Die Mutter war einst Pianistin, der Vater Leiter des Botanischen Gartens in München.) In ihrem Haus verkehrten der bayerische Adel und die Münchener Hochfinanz so gut wie prominente Künstler, geistliche Würdenträger und hohe Militärs. Man gehörte also zur Gesellschaft und gehörte doch nicht hin; man war bewundert und doch nur geduldet, denn man war weder reich noch comme il faut noch berühmt, dafür »ein wenig größenwahnsinnig«, nach Annette Kolbs Bericht, kurz: man zählte nur halb und nur kraft einer unbestimmten Anziehung, die dieser Bohème-Haushalt ausübte. Man stand nicht auf solidem Boden, man saß in einer fliegenden Schaukel. ›Die Schaukel‹ heißt denn auch der Roman ihrer Familie. Was das Gesellschaftliche anlangt, blieb Annette Kolb zeitlebens auf der Schaukel: Freunde hatte sie in allen Kreisen, und sie bewegt sich genauso sicher und genauso flüchtig in den Schlössern englischer Lords wie in billigen Pariser Hotelzimmern und in den Regierungsgebäuden am Quai d’Orsay und in Genf, obwohl sie nirgendwo hingehört. Diese ihre Souveränität, die so natürlich erscheint, ist in Wahrheit recht kunstvoll. Sie ist nicht das Ergebnis der Anpassung an dieses oder jenes Milieu; sie ist vielmehr eine Frucht des »Vergessens«. Annette Kolb vergißt ihre Umgebung, und der Boden, auf dem sie steht, ist immer ihr eigener. So geht sie den Schwierigkeiten aus dem Wege und hat immer recht.
Viel wichtiger das Widersprüchliche in ihrer Abstammung: sie ist in München geboren, Kind einer französischen Mutter und eines Vaters, der ebenso münchnerisch war wie seine Frau pariserisch. »Vous êtes des Allemands«, pflegte die Mutter zu ihren Kindern zu sagen, und so sehr sich die Kinder ihr gegenüber als Deutsche fühlten, so sehr unterschieden sie sich von den unproblematisch deutschen Kindern anderer Leute. Ihr so münchnerisches Elternhaus war gleichwohl der coin de France für alle Franzosen, die der diplomatische Dienst oder sonst irgend etwas nach München führte. »Ein unverbindliches Terrain« nennt es Annette Kolb. Wie verbindlich aber blieb es für Annette Kolbs ganzes Leben, daß ihre Mutter mit allen Kräften zurückstrebte nach Paris, und daß diese Rückkehr vereitelt wurde durch den Deutsch-Französischen Krieg. Nie war es Annette Kolb möglich, unverbindlich zwischen Frankreich und Deutschland zu stehen, für immer war ihr Herz zerrissen. »Meine Sympathien, diese ewigen Überläufer …« Eine Zeitlang bewohnte sie ein sehr hübsches Haus in Badenweiler, mit dem Blick aufs linke Rheinufer. Das Haus gehört ihr heute noch, doch sie blieb nicht dort. Es ist ihr nicht gegeben, Wurzeln zu schlagen. Jetzt lebt sie in Paris, in einem Hotelzimmer, Gast auch hier. Keines ihrer Bücher und kaum einer ihrer Aufsätze, der nicht diesen Konflikt verriete. Die Politik war und ist eins von Annette Kolbs »stets gewillten Paradepferden«. Politik, das bedeutet für sie die Frage des Verhältnisses zwischen Deutschland und Frankreich. Nur wer selbst so münchnerisch, so bayerisch ist wie Annette Kolb, kann sie darin ganz verstehen. Denn nie, so sagt sie, werden wir es verschmerzen, daß wir an Preußen statt an Frankreich gebunden wurden. (Welche Kultur wäre aus unsrer Verbindung entstanden!) Annette Kolb plädiert für den Frieden. Sie findet scharfe Worte gegen den Krieg, gegen jeglichen Krieg. Der Weltfriede scheint ihr garantiert, wenn der Friede zwischen Deutschland und Frankreich gesichert ist. Warum liebte sie Luwig II. von Bayern so sehr? Weil er Wagners Freund war? Vor allem, weil er anti-militaristisch war. Sie hat auch ein Buch über Briand geschrieben. Warum gerade über ihn? Weil er in der großen Locarno-Rede 1926 die europäische Einheit und damit den Frieden propagierte. Und warum schrieb sie einen Essay gerade über Catharina von Siena, deren Briefe sie herausgab? Weil diese Heilige eine Politikerin war, und zwar eine Friedensstifterin. Heilige und Politikerin, was für ein Ideal! Das geheime Ideal Annette Kolbs; vielleicht. (Die Verleihung des Frankfurter Goethe-Preises 1955 rührt daran.)
Damit kommen wir zum dritten der Widersprüche, die es zu bewältigen gab. Annette Kolb ist katholisch. In Altbayern ist der Katholizismus nicht so sehr eine Konfession und eine dogmatische Angelegenheit, als vielmehr Sache des Temperaments. Man ist katholisch oder ist es nicht, so wie man künstlerisch ist oder nicht. Annette Kolbs Katholizismus ist von südlichlateinischer Weltoffenheit, und er ist sinnenfreudig und künstlerisch. Ein mozartischer Katholizismus sozusagen, der es sich gestatten kann, tolerant zu sein und alle Häresien ohne Schaden innerhalb seiner Mauern gelassen zu dulden, auch jene der Annette Kolb. Sie geht sonntags in die Kirche, nach Saint Séverin, wenn sie in Paris ist, und einer ihrer schönsten späten Aufsätze gilt der ›Gefährdung der Messe‹. So lateinisch-kosmopolitisch ist Annette Kolb, daß ihr schon die moderne Manier, die Messe in der jeweiligen Landessprache laut mitlesen zu lassen, als Konzession an protestantisch-nationalistische Neigungen erscheint. Kaum ein Werk, in dem sie nicht vom Katholizismus spricht, doch meist nur so, wie eben ein Habitué der Kirche es tut: als über das Selbstverständliche. Kein Exkurs ins Metaphysische, keine religiöse Diskussion, obgleich sie – zwischen den Zeilen zu lesen – sich bisweilen dieserhalb in geistigen Nöten befand. (Nicht umsonst bemühte sie sich, Bergson zu treffen, und andrerseits spielt das »Wunder«, auch das »Okkulte«, in ihrem Leben eine Rolle.) Ein paarmal nur eine Andeutung, so in ihrer Mozart-Biographie, oder in dem für das Begreifen ihres Wesens so wichtigen Aufsatz ›Monseigneur Duchesne‹ (›Blätter in den Wind‹) oder in ihrem Essay über ›König Ludwig II. von Bayern und Richard Wagner‹, oder am Schluß des schönen und tiefen Aufsatzes über die Messe: »Ohne Mystik, ohne sie ist dies nur eine abgeblühte, winterliche Welt«. Doch, so schreibt sie in dem Roman ›Daphne Herbst‹: »Ein Glaube kommt an Intimität nur unserm Tode gleich.« Man spricht nicht darüber.
Annette Kolb spricht nicht gern darüber, denn über etwas sprechen heißt sich erinnern. Sie aber will vergessen. Und was gibt es hier Störendes zu vergessen? Annette Kolb ist in einem Innsbrucker Kloster erzogen worden, und sie hat sich dort eine Aversion gegen den »Umgang mit katholischen Personen«, gegen »religiöse Erörterungen« und den »Jargon der Kirche« geholt; dazu kam später die Abneigung gegen gewisse kirchlich-politische Attitüden. Aber, obgleich ihr die Kirche bisweilen wie ein brüchiges Haus erscheint, das zu beziehen sie niemandem rät, bleibt sie darin wohnen; denn sie gehört dorthin. Sie ist fromm, aber ihre Frömmigkeit ist leicht zu stören. Ein unsensibles Wort von der Kanzel, ein fanatischer Priester, der deutsche Text der Messe, der Kitsch, der sich in der kirchlichen Kunst breitmacht, die Kirchenpolitik, – dies alles ruft ihren Protest hervor. Sie gehört zu den intra muros so verpönten »liberalen« Katholiken, aber sofern die Kirche die Hüterin der abendländischen Mystik und der Kunst ist, läßt Annette Kolb nichts über sie kommen. Mit Freude begrüßt sie die Trennung von Kirche und Staat in Frankreich, und ihre Liebe zu Briand rührt nicht zuletzt her von seiner ebenso nobeln wie bestimmten Haltung bei dieser sauberen Trennung.
Voller Widersprüche ist auch Annette Kolbs Verhältnis zur Natur und daher auch zu ihrer eignen weiblichen Natur und zu den Männern. Annette Kolb war niemals verheiratet und niemals ernsthaft gebunden. Aber sie ist auch niemals eine alte Jungfer geworden. Sie ist ein Mädchen geblieben, mit allen Mädchen-Problemen. »Das Stürmische und Elementare ihrer Natur, von ihrer Gedanklichkeit getrennt …«, so schreibt sie von Mariclée, und in ›Monseigneur Duchesne‹ (wo diese Bemerkung schon gar nicht hinzugehören scheint) spricht sie von ihrem Leben als einer »Mosaiktafel heftiger, aber größtenteils unerfüllter Wünsche«. Daß ihr Wunsch nach einem Manne (und nur auf einen kam es ihr an) unerfüllt blieb, woran lag es? An ihr selbst. »Diese Jongleuse der Entsagungen« (so nennt sie Mariclée), sie war, obgleich sonst das Absichtslose ihre Stärke war, hierin nicht ohne Berechnung. »Es fragt sich, wer mehr zurückbehält: der alle Dinge auskostet, oder der, dem es glückt, sich von keinem fangen zu lassen.« Sie hätte sich schon fangen lassen, vom »Exemplar«; doch hier war das Schicksal jeder Bindung zuwider, und schließlich (»Mariclée war nicht resigniert, sondern zuckte die Achseln und war einverstanden«), schließlich war Annette es zufrieden, »den Pakt ewig ungenannt zu lassen«. Da sie »das Exemplar« nicht bekam, verzichtete sie auch auf die andern, und sie »vergaß«. Sie ist weit entfernt davon, ihren Verzicht für moralisch zu halten! (Wenn sie gegen Cosima Wagner zu Felde zieht, so nicht ihres Ehebruchs wegen, sondern ihrer »bürgerlichen Berechnung« wegen.) Annette Kolb hatte vielmehr ihr Vergnügen am Verzicht, und mehrmals kehrt das Wort vom »Rausch des Alleinseins« wieder. Was denn hatte sie eingetauscht für den Verzicht? Die Freiheit. »Die Befriedigung, niemandem zu gehören, ist so überbietend, daß man ebenso mächtig daran hängen kann wie ein andrer am Genuß.« Der Verzicht ist ihr Genuß, er ist ihr Sport. (So behauptet sie von Mariclée.) Nun: jedenfalls scheint für Annette Kolb der Verzicht niemals lebensgefährlich gewesen zu sein, nicht einmal beim Exemplar. Sie war keine der großen Liebenden. Auch hierbei ist sie ganz sie selber: flüchtiger Gast allerorten. Freilich bemerkt sie da und dort mit Melancholie, daß sie »wieder einmal nicht habe mittun dürfen«, und von Mariclée sagt sie: »An der großen Tafel des Lebens war, obwohl oder weil jeder Platz für sie so denkbar schien, nicht für sie gedeckt. So saß sie abseits an einem Katzentischchen, wobei ihre Beziehung zum Genuß ebenso ausgesprochen blieb wie ihre Distanz.« Dabei war Annette Kolb, obgleich sie ihr »Pferdegesicht« nicht für schön hält, doch sehr reizvoll, und ihre Art zu schreiben ist weiblich genug, um zu verraten, wie weiblich Annette Kolb war, ehe sie sich dafür entschied, es zu vergessen. Mit ein wenig Spürsinn kommt man dahinter, was sie zur Haltung des Verzichts bewog. War sie nicht die Jüngste in der Familie, und waren nicht die Schwestern »Hespera« und »Gervaise« (aus der ›Schaukel‹) die Schönen, die Bevorzugten? Und hieß nicht sie selbst »der Mathias«? Erklärung genug. Sie fühlte sich im Nachteil, und ihre Antwort war einerseits die rührende Bewunderung ihrer Schwestern, andrerseits aber Trotz, getarnt durch ein Übermaß an Anspruch. Ein Anspruch, der so hoch ist, daß er nicht erfüllt werden kann, gibt das Recht zum hochmütigen Verzicht auf jedes Angebot. So vergrößerte sie mit Fleiß die Kluft zwischen Wunsch und Erfüllung, und so lange tat sie es, bis sie »vergaß«, was sie gewünscht hatte. In der Nicht-Erfüllung lag nun die Erfüllung. Eine gewagte Volte. Doch sie gelang. Denn sie entsprach dem »kühnen Mangel an Gewicht und Schwere«, den Annette Kolb Mariclée zuschreibt, und der so ganz der ihre ist.
Verliebtheit und Distanz bestimmen Annette Kolbs Verhältnis zum Leben überhaupt. Sehr selten war es ihr vergönnt, »zu fühlen, daß sie lebte«. Das aber war ihre eigene Schuld. Sie liebte das Leben, aber sie ertrug seine Vergänglichkeit nicht. Das Leben wirklich lieben aber heißt, es eben um seiner Vergänglichkeit willen lieben. Vergänglichkeit, Alter, Tod, dies waren oder sind für Annette Kolb Erscheinungen, die schwer zu vergessen sind. Vielleicht, so denkt sie, erträgt man sie leichter, wenn man sich von vornherein nicht allzu leidenschaftlich einläßt mit dem, was man doch nicht halten kann, wenn man vielmehr das Vergehen und den Abschied unaufhörlich und grundsätzlich vorwegnimmt. Daher ihr Hang zum Schweifen, zum Flüchtigen, zur schmerzlos leichten, folgenlosen Berührung. Ihrer eignen Zerbrechlichkeit sich ganz bewußt, ist der Verzicht auf Leidenschaft ihr Schutz. So wird ihre Liebe zum Leben eine Verliebtheit etwas geisterhafter Art. Dennoch ist ihr der Tod statt Teil des Lebens sein äußerster Widerspruch, und sie »verfolgt« ihn mit ihrem Haß, so schreibt sie. Trotzdem findet sie plötzlich in ihrem Nekrolog auf den Prinzen Alexander Hohenlohe ein so schönes und tiefes Wort: »Diese halbgeöffneten Augen hielten einen Blick von unendlicher Sanftmut zurück wie einen süßen Schreck des Entkommenseins«.
Ohne Konflikt, so scheint es, ist allein ihr Verhältnis zur Musik. Hier ist nichts zu vergessen (es sei denn eine schlechte Aufführung, und Annette Kolb ist hierin höchst empfindlich), vielmehr ist Musik selbst ihr ein Mittel des Vergessens. »Mariclée liebte Musik über alles.« Annette Kolb ist musikalische Dilettantin im wahren und genauen Wortsinn: Liebhaberin. Kein Wunder: Kind einer so musikalischen Mutter und aufgewachsen in der Glanzzeit des Münchener Musiklebens! Ihr Geschmack hat sich für immer gebildet an den Muster-Aufführungen unter Mottl, und ihr Maßstab ist sehr streng, wir lesen es in ihren Berichten über die Salzburger Festspiele von 1934 bis 1938. Sie versteht etwas von Musik, auch wenn ihre Urteile Musikern oft recht seltsam erscheinen, und sie spielt Klavier; ihr Flügel zog mit ins Pariser Hotel. In Badenweiler hörte ich sie selbst noch spielen, vor ein paar Jahren. Das Hütchen auf dem Kopf wie immer, gestrickte schwarze Halbhandschuhe an den Händen, so spielte sie Mozart. Ihn liebt sie vor allem. Über ihn hat sie ein Buch geschrieben. Auch über Schubert schrieb sie, doch ist dies mehr eine Fleißarbeit, und was sie über Wagner schrieb, galt nicht so sehr seiner Musik als seiner Person, die sie ein wenig verklärt sieht für unsern Geschmack, doch wer weiß, hat sie recht; dennoch war sie keine Wagnerianerin, auch hier nicht willens, sich fangen zu lassen. Ihr Mozartbuch vor allem aber ist schön, und hier liebt sie ganz. Dieses Buch entsprang der reinen und frischen Intuition. Nirgendwo sonst ist uns Mozart so nahegebracht und zugleich in eine so große und strenge Ferne gerückt. Der Standpunkt, den Annette Kolb hier wählte – wie bezeichnend für sie selbst –, ist jener, von dem aus sie Mozarts so rasche Ablösung vom Irdischen verfolgen kann, sein Wissendwerden, seine Vereinsamung und schließlich seinen Aufflug.
In Annette Kolbs Feuilleton-Sammlung, ›Beschwerdebuch‹ genannt, steht ein ›Bestelltes Selbstportrait für Quartaner‹; darin schreibt sie von sich: »Zum Schreiben drängt sie nicht das Talent, sondern ihre Meinungen, und darin liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeiten«. Nun wohl, so mag es sein. Doch wie gut schreibt sie, was für einen besondern, unverwechselbaren Stil! Was für atemraubend schöne Wendungen findet sie, und unübertrefflich ist ihre Kunst, in ein paar Sätzen einen Menschen ganz zu zeichnen. Dieser ihr Stil ist ungemein weiblich, das will heißen: er entspricht der weiblichen Art, sich der Welt zu bemächtigen. Annette Kolb lebt von Impressionen, und sie denkt in Einfällen, in Aperçus, in blitzschnellen Assoziationen. Es ist ein Pizzicato-Stil, bald schwebend zart, bald nervös und scharf. Die großen Cantilenen fehlen, und der dramatische Akzent ist ebenfalls nicht ihre Sache. Ihr Stil im Leben wie im Schreiben ist der Spitzentanz. Wie schwer er zu lernen ist, das weiß nur die Tänzerin.
»Ihr wahres Leben aber ahnte niemand«, so sagt sie von Mariclée. So wird es sein. Doch möchten wir glauben, daß auf Annette Kolb zutrifft, was sie von ihrer Mariclée schreibt: »Sie, die so kümmerlich Umfriedete, war vielleicht letzten Endes die Gesicherte und Gerettete.«
Franz Werfel
FRANZ WERFEL HÄTTE HEUTE, an diesem Tag, an dem sich sein Todestag zum fünften Mal jährt, seinen sechzigsten Geburtstag gefeiert. Er starb im August 1945 an einem Herzschlag. Lebte er noch, wäre er gewiß längst zu uns gekommen, aus seinem kalifornischen Exil, und wenn ihn etwas abgehalten hätte, an dieser Feier teilzunehmen, so wäre es jene Bescheidenheit gewesen, die ihn einige Jahre vor seinem Tode dichten ließ:
Und kann doch nie den Rang genießen,
Denn würd ich nur die Augen schließen,
Stünd gleich ich buß- und grußbereit
Vor ewiger Unerreichbarkeit.
Keinesfalls hätte ihm Haß Rückkehr und Teilnahme verwehrt, obgleich er Grund genug gehabt hätte zur Abkehr von dem Volk, das ihm nach dem Leben trachtete.
Er konnte nicht hassen. Er scheint allen Haß, dessen er fähig war, in einer kurzen aggressiven und polemischen Epoche seiner Jugend so verbraucht zu haben, daß nichts verblieb fürs weitere Leben. Seine Begabung war nicht das strenge, saubere Hassen, sondern das alles verstehende Lieben. Er war ein weicher Mensch, dem es leicht fiel, mit den Leidenden zu leiden, so wie vieles – alles – ihm leicht fiel: das Dichten, der Erfolg, die Erkenntnis und selbst, soweit das Menschen möglich ist, das Leben. Denn er war reich begabt, und das Leben liebte ihn. Sogar die Spannung zwischen jüdischer Herkunft und starker Neigung zum Katholizismus, eine Spannung, die geeignet ist, furchtbare Konflikte zu erzeugen, selbst sie löste sich ihm auf sanfte und glückliche Weise; und noch das Exil, vielen anderen ein harter böser Rückschlag, erwies sich ihm mehr als gnädig: es brachte ihm nicht nur seine großen Erfolge, sondern die wirkliche geistige Vollendung seines Werks. So war er stets, er sagt es selbst, ein »Deserteur des Sorgenvollen«.
So viel breiter und lebenslang treuer Publikumserfolg, so viel musische Leichtigkeit und privates Lebensglück ist ganz und gar geeignet, uns mißtrauisch zu machen, zumal da auch das Werk die Spuren dieser Leichtigkeit und Lebenslässigkeit trägt, und nicht zum Heil der Dichtung. Zweifel über Zweifel an der Lauterkeit seiner künstlerischen Persönlichkeit quälen den genauen und wachsamen Leser bei der Lektüre, angefangen beim allerersten Gedichtband des Zwanzigjährigen bis zu den späten Romanen, der ›Bernadette‹ und dem ›Veruntreuten Himmel‹. Sie verstummen erst beim allerletzten Werk seines Lebens, dem ›Stern der Ungeborenen‹, diesem tiefen und übermütigen, diesem spirituell spielerischen und philosophischen Buch, das er zwei Tage vor seinem Tod vollendete und uns als ein bezauberndes und überwältigendes Testament hinterließ.
Überwältigung und Zweifel, das sind die Reaktionen, die Werfels Werk im Leser hervorruft, beide fast gleichzeitig oder doch rasch aufeinander, von Kapitel zu Kapitel wechselnd, oft von Passage zu Passage. Hier und dort und hundertmal ärgert uns die Nachlässigkeit, mit der er die Sprache behandelt, und wer sprachliches Entzücken sucht, wird es bei Werfel nur in der Lyrik, fast nirgendwo in der Prosa finden. Einer strengen handwerklichen Kritik hält keiner seiner Romane stand. So müssen wir in dem wichtigen und politisch erregenden Roman ›Die vierzig Tage des Musa Dagh‹ eine Anzahl ganz farbloser Personen und zudem eine zentrale Frauengestalt in Kauf nehmen, die gar nicht wahr ist, sondern banalstes Klischee; und so passiert uns das Unglück, miterleben zu müssen, wie der so groß gedachte Familienroman ›Die Geschwister von Neapel‹ von starrer, düsterer und poetischer Großartigkeit unaufhaltsam abgleitet in den – sagen wir es ruhig – sentimentalen Kitsch. Ebenso finden wir in den Gedichten oft atemraubend schöne Anfänge gekoppelt mit nachfolgenden Strophen, die nackter Gedanke oder leeres Pathos blieben. Selbst das ergreifende ›Lied der Bernadette‹ bewegt sich stellenweise scharf an der Grenze des billigen Effekts.
Die Waage, auf der ganze und halbe Kunst unbarmherzig gewogen wird, sie schwankt beängstigend. Am frühesten bemerkte das der unbestechlichste aller Kritiker, Karl Kraus. Er hat als einer der ersten das unbezweifelbare Genie des jungen Werfel erkannt, er hat seine Gedichte in der exklusiven ›Fackel‹ abgedruckt, und er hat sich bald tief enttäuscht von ihm abgewandt. »Und die Gefühle gehen wie geschmiert«, so schrieb er. Ein böses Wort, doch nicht von der Hand zu weisen, wenn ein Karl Kraus es schrieb.
Werfel selbst war früh und immer wieder gewarnt von seinem Mißtrauen ins eigne Wort. Selbstquälerische Unzufriedenheit mit seiner literarischen Tätigkeit ließ ihn Gedichte und Verszeilen voller Selbstvorwurf schreiben:
Du hast die Welt entweltet,
Du hast sie verwortet.
Oder an anderer Stelle:
Ach, es ist nicht gut, zu sagen.
Denn wer sagt, versagt.
Seine Klage richtet sich sogar gegen den, der ihm die zu hemmungslose Begabung zugeteilt hatte:
Was schufst du mich, mein Herr und Gott,
Zur Eitelkeit des Worts?