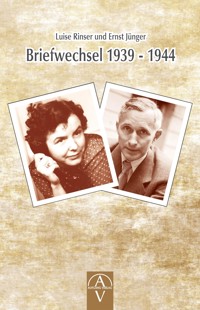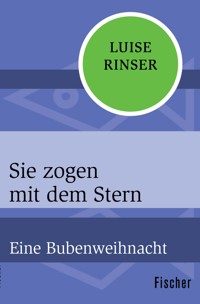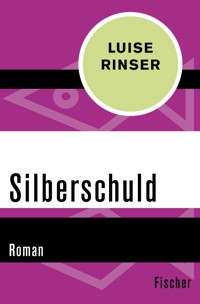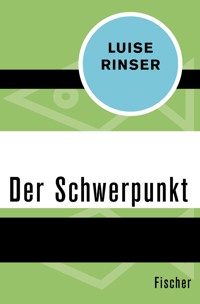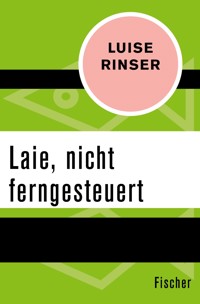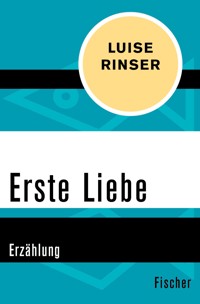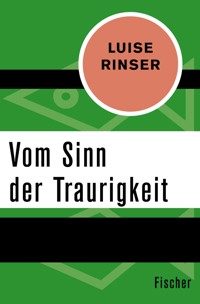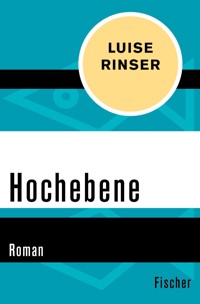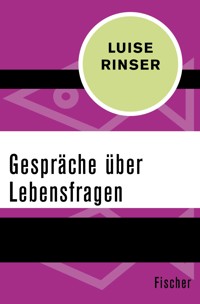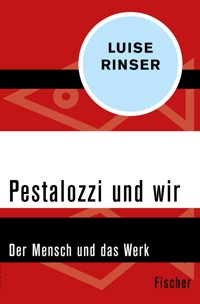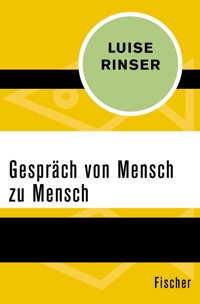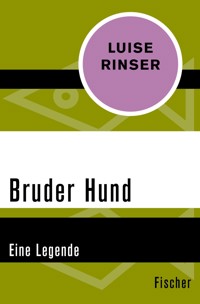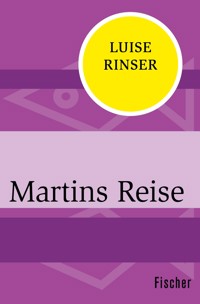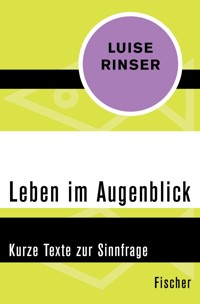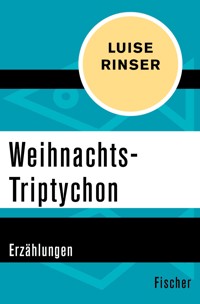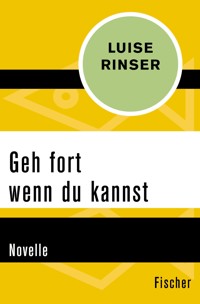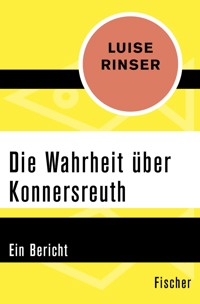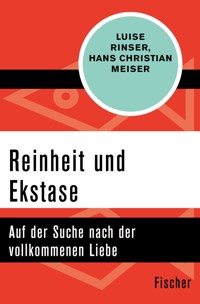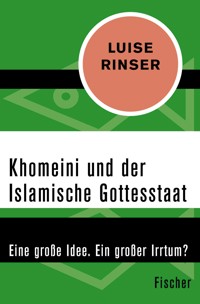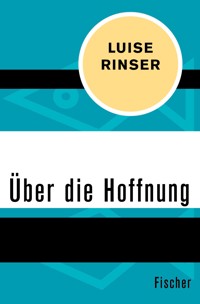
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem erstmals 1964 erschienenen Essay geht Luise Rinser dem Wesen der Hoffnung, dem Ausgangspunkt aller Lebenstriebe, auf den Grund. Sie erläutert, warum es nicht das Gleiche ist, zu »hoffen« und »hoffend zu sein«, und sie führt aus, inwiefern die Hoffnung eine Fähigkeit ist, die uns verliehen wurde, und eine Tat, die wir aktiv zu leisten haben. »Die Hoffnung ist eine«, die Liebe ebenso. Alles ist »Welt« und Gott ist in allem. Luise Rinser fragt danach, was es bedeutet, Gott zu lieben, und führt es auf das »hoffend sein«, auf das bedingungslose Vertrauen zu Gott, zurück. Damit erkennt sie letzten Endes die gläubige, hoffende Liebe als den Quell ihres Lebens. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 27
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Luise Rinser
Über die Hoffnung
Über dieses Buch
In diesem erstmals 1964 erschienenen Essay geht Luise Rinser dem Wesen der Hoffnung, dem Ausgangspunkt aller Lebenstriebe, auf den Grund. Sie erläutert, warum es nicht das Gleiche ist, zu »hoffen« und »hoffend zu sein«, und sie führt aus, inwiefern die Hoffnung eine Fähigkeit ist, die uns verliehen wurde, und eine Tat, die wir aktiv zu leisten haben. »Die Hoffnung ist eine«, die Liebe ebenso. Alles ist »Welt« und Gott ist in allem. Luise Rinser fragt danach, was es bedeutet, Gott zu lieben, und führt es auf das »hoffend sein«, auf das bedingungslose Vertrauen zu Gott, zurück. Damit erkennt sie letzten Endes die gläubige, hoffende Liebe als den Quell ihres Lebens.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei FISCHER Digital
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Copyright © by Christoph Rinser
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Montasser Medienagentur, München
Covergestaltung: buxdesign, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-561238-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Über die Hoffnung
Über die Hoffnung
Es ist gar nicht so leicht für einen «normalen» Menschen, auf die Frage, aus welchen Quellen er lebe, wahrhaftig und mit sachlicher Treue zu antworten. Es bedeutet, sich mehr als üblich in seiner intimsten Sphäre nach außen zu öffnen, und dabei gilt wie eh und je das Wort des erfahrenen Goethe: «Sagt es niemand, nur dem Weisen …» Aber gleichviel: Wenn dieses Büchlein nicht nur «Literatur» unter vieler anderer Literatur sein soll, dann muß man sich selber wagen, hoffend und liebend, um dem Nächsten, vielleicht einem einzigen (das würde genügen), eine Wegspur zu zeigen (nicht mehr als das, und es genügte). Es gibt, so denke ich, schlechthin nur einen einzigen wirklichen Lebensantrieb: die Hoffnung