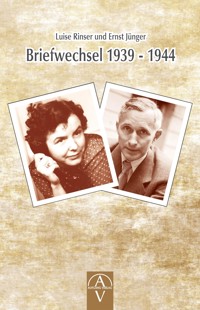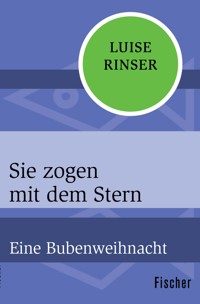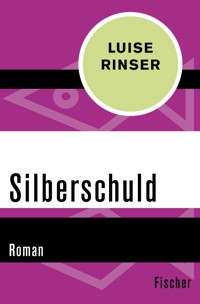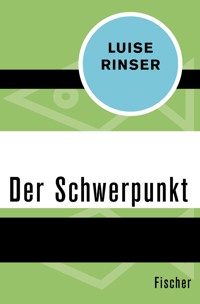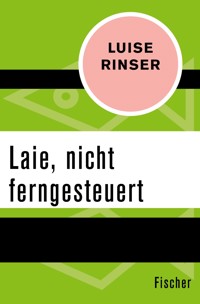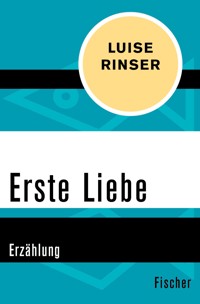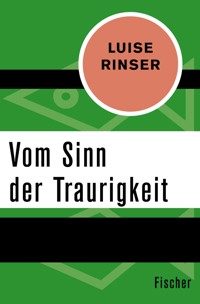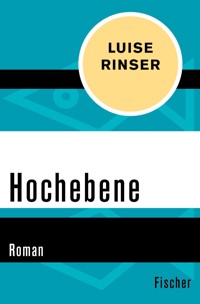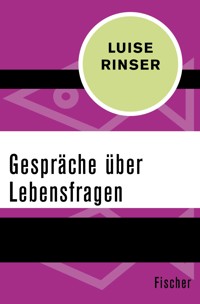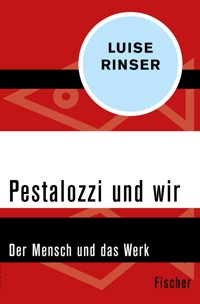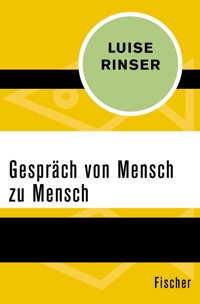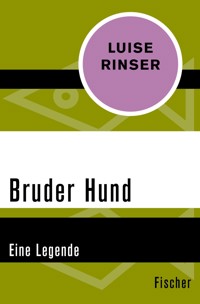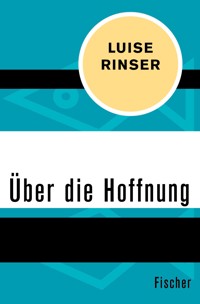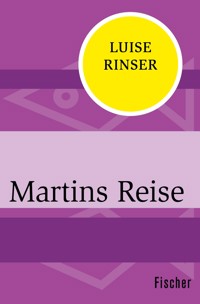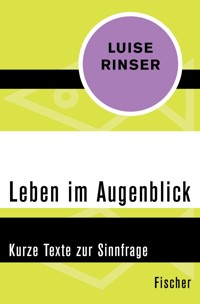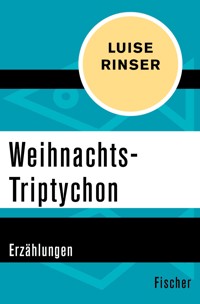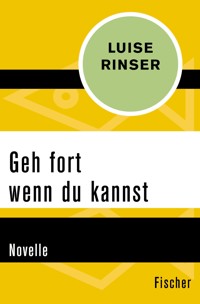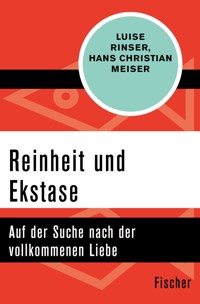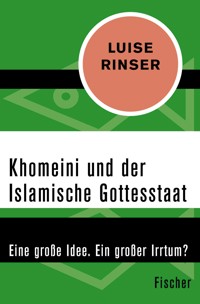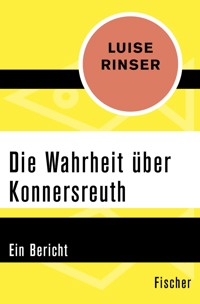
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Der »Fall Konnersreuth« stellt uns vor Phänomene, die sich rationalen Erklärungen entziehen. Der Bericht Luise Rinsers, der nach persönlicher Begegnung mit Therese Neumann entstand und auf eingehendem Studium der bestehenden Literatur über Konnersreuth fußt, will diese Phänomene nicht »erklären«, sondern Zeugnis von einer »höhern Realität« ablegen, die »die einzige Quelle ist, die uns wirklich das Leben erhalten kann.« (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Luise Rinser
Die Wahrheit über Konnersreuth
Ein Bericht
Über dieses Buch
Der »Fall Konnersreuth« stellt uns vor Phänomene, die sich rationalen Erklärungen entziehen. Der Bericht der Dichterin Luise Rinser, der nach persönlicher Begegnung mit Therese Neumann entstand und auf eingehendem Studium der bestehenden Literatur über Konnersreuth fußt, will diese Phänomene nicht »erklären«, sondern Zeugnis von einer »höhern Realität« ablegen, die »die einzige Quelle ist, die uns wirklich das Leben erhalten kann.«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Vorrede
Die Frage nach dem Wunder
Die große Krankheit
Stellvertretendes Leiden
Wunder in Konnersreuth?
Hysterie oder religiöses Phänomen?
Deutungsversuche
Die Stigmata
Medizin und Stigma
Stigma und Heiligkeit
Thereses Nahrungslosigkeit
Die Methoden der Untersuchung
Das Sprachenwunder
Die Echtheit der Visionen
Prophezeiungen und Voraussage
Therese von Konnersreuth und die Zeitereignisse
Konnersreuth und der moderne Mensch
Literaturhinweise
Vorrede
Der Titel dieses Buches stammt nicht von mir. Ich hätte nie gewagt, auch nur den Anschein zu erwecken, als wüßte ich »die Wahrheit« über Konnersreuth. Ich weiß sie nicht, und ich glaube, daß niemand sie weiß, wenngleich es einige Personen gibt, die weit mehr über Therese Neumann wissen als ich, und der »Wahrheit über Konnersreuth« sicher näher sind als ich. Diese Personen aber schweigen. Sie werden vielleicht eines Tages, nach Therese Neumanns Tod, reden.
Im Bewußtsein der Schwierigkeit des Stoffes und der Unzulänglichkeit meiner Mittel der Erforschung hätte ich niemals gewagt, über Therese Neumann zu schreiben, wenn mich nicht ein Verlangen getrieben hätte, das nicht allein und nicht vor allem auf die Klärung des »Falles Konnersreuth« gerichtet ist. Meine Absicht ist, am »Fall Konnersreuth« als an irgendeinem Beispiel zu zeigen, daß das, was wir mystische Religiosität nennen, nicht etwas Mittelalterliches, etwas Nebelhaftes und Abwegiges ist, das sich mit einem gesunden, klaren und festen Geist in unsrer Zeit nicht verträgt, sondern daß es vielmehr etwas höchst Aktuelles ist, das zu ignorieren einen Mangel an Mut und Geist verrät, und zudem ein stolzes oder leichtfertiges Zurückweisen der großen Hilfe bedeutet, die in der Anerkennung einer »höhern Realität« liegt. Diese höhere Realität, die durch die Worte »Gott«, »Gnade«, »Wunder«, »Gebet«, »Heiligkeit« etwa umrissen wird, ist heute, da alle andern Lebensquellen – Natur, Konvention, Ethik, Patriotismus, Wissenschaft – uns nicht mehr oder nicht mehr allein zu tränken vermögen, die einzige, die uns wirklich das Leben erhalten kann. Denn wir sind sehr allein und verloren, von gefährlicher Schwermut bedrängt und der Versuchung zur Verzweiflung ausgesetzt. Wer aber sich der Möglichkeit bewußt ist, sein scheinbar so verlorenes einzelnes Leben mit den Mächten einer andern Welt zu verbinden, der wird eine neue, höhere und dauerhafte Geborgenheit finden, und er ist schon auf dem Wege zur Rettung.
Nicht wissenschaftlicher Ehrgeiz und Eifer also sind der Anstoß zu diesem Buch, sondern der Wunsch, die Spur eines Weges aufzuzeigen, der, bei aller Gefährlichkeit, doch der sicherste zu sein scheint. Mögen darum, trotz meiner ausgedehnten Vorstudien, einige wissenschaftlich anfechtbare Stellen in diesem Buche sein – welches Buch über ein derartiges Thema ist nicht anfechtbar, zumal wenn es, um allgemeinverständlich zu sein, komplizierte Phänomene vereinfacht darstellen muß! – wenn es in einigen Menschen das Gefühl für die Existenz jener höheren Welt erweckt, so ist genug getan.
Die Frage nach dem Wunder
DIE WELT, die uns zwar nicht gerade aufs beste geordnet erscheint, aber doch bestimmten natürlichen Gesetzen zuverlässig gehorchend, durchbricht immer wieder ihre eigene Ordnung, indem sie dem Außer-Ordentlichen, dem Ungesetzlichen, dem Unerklärbaren den Einbruch ins Gewohnte und Begreifliche gestattet. Solche Einbrüche beantworten wir je nach Veranlagung und je nach Stand und Richtung unserer geistigen Entwicklung mit betonter Gleichgültigkeit, mit brennendem Interesse, mit Ehrfurcht, mit Skepsis oder auch mit schroffer und haßvoller Ablehnung. Atif jeden Fall stören sie uns und verlangen nach Auseinandersetzung. In solchen Auseinandersetzungen wächst jeder von uns und wächst das geistige Bewußtsein der Menschheit überhaupt. Das geistig Unbequeme ist das Notwendige und Fördernde.
Zu den geistig höchst unbequemen Einbrüchen des Unerklärlichen gehört der Fall Konnersreuth. Seit drei Jahrzehnten beunruhigt er die Welt: Mediziner, Psychologen, Philologen, Historiker, Theologen vom einfachen Landpfarrer über Universitätsprofessoren bis zu den höchsten geistlichen Würdenträgern, und selbstverständlich Journalisten aus aller Herren Ländern beschäftigen sich damit, zeitweilig sogar die Politiker. Eine Flut von Literatur über dieses Konnersreuth entstand, gute und schlechte, naiv populäre, reißerische, exakt wissenschaftliche, pro und contra. Heftige wissenschaftliche und menschliche Streitigkeiten entbrannten zwischen Medizinern und Theologen, zwischen Medizinern und Medizinern, zwischen Theologen und Theologen, selbst zwischen kirchlichen Behörden kam es um dieses Konnersreuth willen zu einer internen, wenn auch offiziell bald beigelegten Kontroverse.
Was ist dieses Konnersreuth, das so viel Unruhe verbreitet? Nichts weiter als ein kleines bayrisches Dorf im Fichtelgebirge, nahe der tschechischen Grenze, ungefähr dort, wo heute Westdeutschland, Sowjetdeutschland und die Tschechoslowakei zusammenstoßen. Ein armes Dorf in einer rauhen Landschaft, mit der Bahn schwer zu erreichen – und doch von unzähligen Besuchern aus aller Welt erreicht. In diesem Dorf, das sich oberflächlich besehen in nichts von tausend anderen kleinen Dörfern unterscheidet, lebt eine Frau, deren Name international bekannt ist, ohne daß sie irgend etwas tut, um die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zu lenken, ja die die Aufmerksamkeit als eine große Last empfindet und nichts sehnlicher wünscht, als ganz und gar in Ruhe gelassen zu werden, um einzig dem Außerordentlichen zu leben, dessen – ich möchte fast sagen »Opfer« sie geworden ist: Therese Neumann.
Fast jedermann weiß irgend etwas von dieser Frau. Man mache einmal den Versuch und frage eine Reihe von Menschen; man wird hören, daß Therese Neumann »seit Jahrzehnten nichts ißt«, »daß sie Voraussagen macht, die eintreffen«, »daß sie niemals schläft«, »daß sie Visionen hat« und »eine Heilige ist«. Richtiges und Falsches gemischt. Zudem wird man eine Anzahl von Anekdoten erzählt bekommen, die recht phantastisch und nicht sehr glaubhaft klingen, die aber mit solcher Überzeugung vorgebracht werden, daß doch gewisse Gründe dafür bestehen müssen. Je mehr man von Therese Neumann hört und je mehr man sich mit ihr beschäftigt, desto unabsehbarer, ja gefährlicher erweist sich die geistige Landschaft, in die man sich begeben hat. »Konnersreuth« ist nicht ein Problem – es ist ein ganzer Komplex von Problemen, und in der Mitte dieses Komplexes steht die größte Frage unserer Zeit und aller Zeiten: die Frage nach dem Wunder – anders gesagt: die Frage, ob es eine Macht gibt, die außer und über der Natur steht und die Natur beherrscht, und ob und inwieweit der Mensch teil hat an dem, was man »das Übernatürliche« nennt. Eine Frage, die harmlos klingt und die eine ungeheure Sprengkraft enthält. Die Frage, die unser letztlich noch immer materialistisches Weltbild revolutioniert.
Therese Neumann hat sich in ihrer Jugend gewiß nicht damit beschäftigt und ganz sicher nicht gedacht, daß sie selbst eines Tages Anlaß zur Aktualisierung dieser Frage sein würde. Heute, 56 Jahre alt, weiß sie, daß ihr Leben einzig der Aufgabe dient, Zeugnis abzulegen von der Existenz des Übernatürlichen. Sie lebt ganz und gar im Bewußtsein dieser Aufgabe, und nichts hat Raum in ihrem Leben als einzig diese Aufgabe. Doch ist sie fern davon, eine Fanatikerin zu sein, und fern davon, das »Übernatürliche« sinnenfällig zu repräsentieren, obgleich sie einzig aus dem Übernatürlichen lebt – und das ist buchstäblich zu verstehen: ihre Nahrung besteht seit Jahrzehnten in nichts als der kleinen weißen Hostie, die sie in der täglichen Kommunion zu sich nimmt. Keine andere feste Nahrung, ja nicht einmal ein Schluck Wasser kommt über ihre Lippen. Niemand sieht ihr das asketische Leben an, das nicht einmal wirklich ein asketisches ist, denn diese ihre Nahrungslosigkeit ist keine freiwillige; sie ist über sie verhängt wie alles andere Seltsame, das sie erlebt; sie vermochte einfach eines Tages nichts mehr zu essen, ihr Körper oder vielmehr ihr Geist weigerte sich, teil an irdischer Nahrung zu haben. Seit 25 Jahren …! Dabei sieht sie blühend aus, eine mittelgroße, fast stattliche Frau mit reiner gesunder Haut, mit großen, klaren, ruhigen, blaugrauen Augen, ohne eine Spur von asketischer Gespanntheit, ohne Nervosität, ohne geistige Anmaßung – weit eher das Bild einer gesunden, klugen, temperamentvollen Bäuerin als das einer Hysterikerin, zu der man sie abstempeln wollte, oder als das einer in der Fülle des Außerordentlichen, Geheimnisvollen, Übernatürlichen Lebenden. Und doch ist diese Frau gezeichnet: ihre Hände tragen, deutlich sichtbar, seltsame Wundmale, auf den Handrücken viereckige, mit sauberem, trockenem Schorf bedeckte Narben, etwa ein Zentimeter im Quadrat, in den Handflächen etwas kleinere und runde, genau gegenüber denen, die sich auf den Handrücken befinden. Man sieht es nicht, aber man weiß es: an den Füßen hat sie ähnliche Male, und auf der linken Brustseite eine größere, längliche und tiefe Wunde wie von einem Messerstich. Therese ist eine Stigmatisierte – keine Seltenheit übrigens in der Geschichte der katholischen Heiligen, aber darum nicht weniger seltsam und aufregend und auch nicht weniger in ihrer Echtheit angezweifelt. Diese Stigmen versucht Therese weder zu verbergen noch betont zu zeigen; sie trägt sie ruhig und gelassen und mit jener schönen Selbstverständlichkeit, mit der sie alles andere trägt, was ihr auferlegt ist. Nichts sonst an Therese deutet auf ihre Besonderheit, wenn man ihr zum erstenmal gegenübersitzt – es seien denn allenfalls ihre Augen, die voll von einer zwingenden, jedoch ganz ruhigen Kraft und Klarheit sind und denen man nichts vormachen kann. In diesen Augen liegt die natürliche, trockene, leicht skeptische Klugheit einer Bäuerin, durchleuchtet von jener mehr als natürlichen Klugheit, die sie befähigt, in fremden Herzen zu lesen, unbekannte Schicksale zu wissen, Zukünftiges vorauszusehen und bindende Ratschläge in lebenswichtigen Fragen zu erteilen. Von diesen Gaben erfährt der Besucher zunächst meist nichts, wenn er nicht das Glück hat, gerade an einem Freitag in Konnersreuth und Zeuge der Passionsekstasen der Therese zu sein. Dann erlebt er die Verwandlung dieser sympathischen, trocken klugen Bäuerin in eine Ekstatikerin und Visionärin, der das Mit-Leiden mit dem leidenden Christus buchstäblich das Blut aus Augen, Stirn und Stigmenwunden treibt und sie fast zu Tode erschöpft, so daß sie nach vielstündiger körperlicher und geistiger Qual einer Sterbenden gleicht, aber Stunden später, in einem seltsamen, geheimnisvollen Zustand der Entrücktheit, auf Fragen der Besucher antwortend Zukünftiges voraussagt, geheime Absichten errät, echte Reliquien von gefälschten unterscheidet, unter zivilen fremden Menschen ehemals geweihte aber abtrünnige Priester herausfindet, geschlossene Briefe liest und Szenen sieht, die sich weit von ihr entfernt abspielen.
Nach den Leiden und den Entrückungszuständen ist sie wieder eine einfache Frau, die über alles Blumen liebt und auch Tiere und Kinder, die, so gut es die stets schmerzenden stigmatisierten Hände erlauben, im Garten arbeitet und die Kirche schmückt, die den Kranken und Sterbenden im Dorf beisteht, sich um die Jugend kümmert, und, entgegen ihren eigenen Wünschen, aber aus dem Gefühl der geistigen Verpflichtung heraus, unzählige Besucher aus aller Welt empfängt: Kardinäle und Bischöfe, Arbeiter, Wissenschaftler, kleine Angestellte, Ärzte, Mönche, Hausfrauen, Katholiken und Protestanten, Buddhisten, Ungläubige, Fromme und Suchende. Allerdings hat nicht jeder, der nach Konnersreuth kommt, das Glück, Therese zu sehen. Oft ist sie krank – entweder simpel krank wie andere Leute auch, oder sie hat ein Sühneleiden für irgend jemand übernommen –; oft ist sie nicht im Dorf, sondern bei ihrer Schwester in Eichstätt oder auch bei irgendwelchen religionspsychologischen und theologischen Untersuchungen, oft aber hat sie »keine Lust«, Menschen zu sehen, denn sie ist von Natur und durch ihr seltsames Schicksal menschenscheu und höchst zurückhaltend und sie ist keine sanfte Heilige, die jederzeit und für jeden sich zu opfern bereit ist. Sie ist ein Mensch mit hohen Qualitäten und mit einer besonderen Berufung, aber eben ein Mensch mit menschlichen Schwächen, mit einem heftigen Temperament, das nur Gott selbst zu bändigen vermag. Ihm und seinem irdischen Stellvertreter, ihrem Beichtvater Pfarrer Naber, gehorcht sie. Mit anderen Menschen, und seien es auch Bischöfe und Gelehrte, kann sie bisweilen zusammenstoßen, denn sie ist ebenso unbestechlich und eigenwillig wie heftig bestrebt, demütig zu werden. Alles an ihr ist echt und ganz, und sie ist durchaus eine Persönlichkeit von Format und Kraft, keine bloß duldende, hinfällige, schwächliche, nervöse Frau, wie man sich Stigmatisierte vorzustellen pflegt. Der Inder Jogananda hat sie vor einiger Zeit besucht, und er war tief beeindruckt von ihr.
Therese besitzt geheimnisvolle Kräfte, deren Herkunft schwer zu erklären oder überhaupt unerklärbar ist. Seit einem Vierteljahrhundert bemühen sich Wissenschaft und Öffentlichkeit um eine Erklärung dieser Phänomene. Die Meinungen stoßen hart und feindselig aufeinander:
Therese ist eine Betrügerin.
Therese ist eine Hysterikerin.
Therese ist eine künftige Heilige, mit übernatürlichen Gaben ausgezeichnet.
Eine gültige Entscheidung ist bis heute nicht gefallen. Sie wird erst nach dem Tod Thereses gefällt werden, und zwar nicht von der Wissenschaft – denn diese ist hier letzten Endes nicht zuständig –, sondern von der Kirche, die sich bis heute noch nicht offiziell geäußert hat. Am 28. Februar 1952 schrieb Generalvikar Buchwieser vom erzbischöflichen Ordinariat München:
»Im Gehorsam gegen die Dekrete des Papstes Urban VIII. erklären wir, daß den geschilderten Vorgängen (in Konnersreuth; d. V.) keine andere als menschliche Glaubwürdigkeit zugesprochen werden kann, solange die Kirche hierüber nicht entschieden hat.«
Nun: solange die Kirche nicht offiziell gesprochen und solange – oder insofern – die Wissenschaft zu keinem endgültigen Ergebnis kam, sollte eigentlich über den »Fall Konnersreuth« nicht geschrieben werden. Aber andrerseits geht uns dieser Fall so sehr an, so unmittelbar, daß wir uns jetzt schon damit auseinandersetzen müssen, und zudem wird so viel Unrichtiges und Ungenaues darüber geschrieben, daß es gut ist, einmal wieder Authentisches zu hören.
Therese selbst hat es nicht gern, wenn man über sie schreibt. Jeden, der sich ihr in der Absicht nähert, über sie zu schreiben, betrachtet sie mit tiefem Mißtrauen. Mit Recht; denn meist ist es nichts weiter als die Lust am Sensationellen, was Journalisten treibt, sich dieses Falles zu bemächtigen. Die Rechtfertigung meines Versuchs, über Konnersreuth zu berichten, liegt in meinem brennenden religiösen Interesse am Wunder schlechthin. Daher habe ich auch so etwas wie eine Erlaubnis von Therese bekommen, über sie zu schreiben. Als ich ihr bei meinem ersten Besuch sagte (ihre Augen zwangen mich zu diesem Geständnis), daß ich es tun wollte, sagte sie: »Ich hab’s nicht gern.« Als ich weiter fragte, ob sie mir abrate, es zu tun, schaute sie mich aufmerksam an, dann erst antwortete sie: »Ich sag’ nicht ja und sag’ nicht nein.« Später fügte sie hinzu: »Dann schreiben Sie halt.« Einige Wochen später erhielt ich auf Umwegen eine Einladung von ihr zu einem zweiten Besuch – eine aufregende Seltenheit bei ihrer spröden Zurückhaltung; bei diesem Besuch wollte sie mir vielerlei sagen. Auf diese Weise also erhielt ich, wie gesagt, eine Art Approbation, die eine starke Verpflichtung zu äußerster Genauigkeit der Berichterstattung bedeutet.
Ehe ich weiter und gründlicher berichte, möchte ich in Kürze meine eigene Stellung zu dem Fall Konnersreuth erklären und ferner die Quellen meines Wissens über Therese Neumann angeben – beides grundlegend wichtige Fragen für eine derartige Arbeit.
Es ist unmöglich, ohne jedes Vorurteil über Konnersreuth zu schreiben. Eine absolute Objektivität in Fragen, die letzten Endes und wesentlich dem Bereich des Religiösen angehören, gibt es nicht. Das Urteil grundsätzlicher Art ist im Wesen und Weltbild jedes Menschen vorgebildet. Es gibt drei mögliche Haltungen einem Fall wie Konnersreuth gegenüber: Entweder man tut, als existiere nichts dergleichen – ignorabimus –, dann hat man es leicht und braucht kein Urteil zu fällen. Oder man leugnet die Existenz des »Wunders«, des Übernatürlichen schlechthin, weil man an die Souveränität der Natur und an die absolute Gültigkeit von Naturgesetzen glaubt und eine Einmischung übernatürlicher Mächte in das Gefüge der Natur für unmöglich hält. Oder aber: man glaubt, daß die »Wirklichkeit« mehr ist als das, was wir als »Natur« bezeichnen, und daß außerhalb der Natur eine Kraft steht, von der die Natur geschaffen wurde und die auch aus eigener Vollmacht Naturgesetze verändern und durchbrechen kann.
Ich glaube an die Existenz des Übernatürlichen, daher auch an die Möglichkeit des Wunders.
Wer an Wunder glaubt, braucht jedoch noch keineswegs »an Konnersreuth zu glauben« – im Gegenteil: gerade er wird dem anscheinenden Wunder größte Skepsis entgegenbringen, weil es für ihn ungeheuer wichtig ist, das echte vom vorgeblichen Wunder zu scheiden. Meine eigene Haltung zu Konnersreuth war und ist folgende: ich glaube, daß sich dort etwas großartig Außergewöhnliches begibt, das dem Wunder gleicht, aber ich vermag selbstverständlich nicht zu behaupten, daß es sich wirklich um ein Wunder handelt. So bleibt mir wie allen andern nichts übrig, als zu versuchen, das Erforschliche zu erforschen bis zu jener Grenze, hinter der das Unerforschliche liegt, das ruhig verehrt werden muß.
Den Fall Konnersreuth zu »erforschen«, ist äußerst schwierig. Man müßte dazu in einer einzigen Person Mediziner und Theologe sein, Parapsychologe, Religionspsychologe, Philologe und Historiker. Man müßte monatelang in nächster Nähe Therese Neumanns leben. Man müßte Einblick haben in alle Aufzeichnungen, die über sie gemacht wurden (ein großer Teil davon ist bei den Kämpfen 1945 zerstört worden).
Ich bin nur auf dem Gebiet der Psychologie zu Hause und ein wenig auf dem der Theologie. Bei allen andern Fragen bin ich auf die Urteile von Fachwissenschaftlern angewiesen.
Meine Berichterstattung über die Vorgänge im Leben Thereses vom Jahr 1918 bis 1927 stützt sich hauptsächlich auf die beiden Bände Dr. Fritz Gerlichs »Die Stigmatisierte von Konnersreuth« – ein in allen wichtigen Angaben absolut zuverlässiger Bericht.
Gerlich war von Beruf Historiker. Seit 1921 leitete er als Hauptschriftleiter die »Münchner Neuesten Nachrichten«, ein liberal-demokratisches Blatt.
Zu jener Zeit beschäftigte er sich ausschließlich mit Problemen der Tagespolitik. Er war Protestant, genau gesagt Calvinist. In vielfacher Hinsicht war er also frei von positiven Vorurteilen gegenüber einem so »typisch katholischen« Fall wie Konnersreuth.
Was ihn trieb, sich mit Konnersreuth zu beschäftigen, war durchaus kein religiöses Interesse, sondern ein politisches: Im Jahre 1927 hatte die öffentliche Diskussion um Therese Neumann heftige Formen angenommen. Verschiedene politische, vor allem linksradikale Parteien forderten von der bayrischen Staatsregierung ein entschlossenes Auftreten gegen den »Unfug von Konnersreuth«. Man forderte eine völlige Abschließung Thereses in einer Klinik oder in einem Kloster.