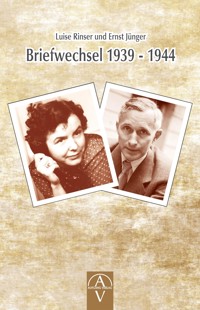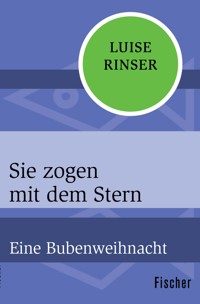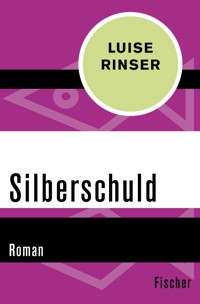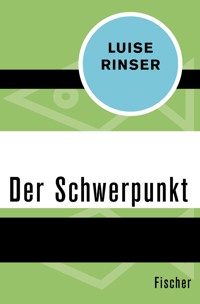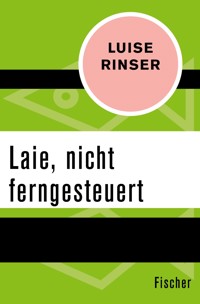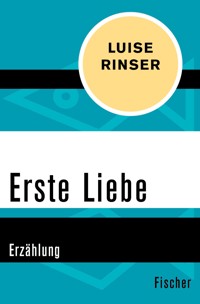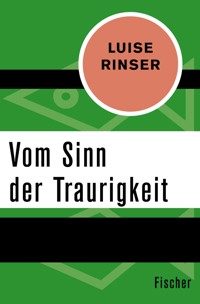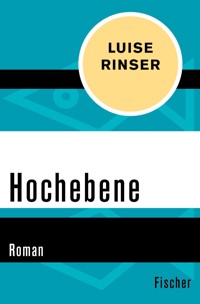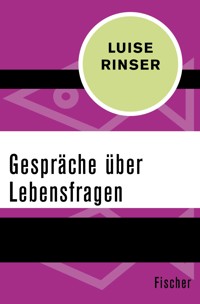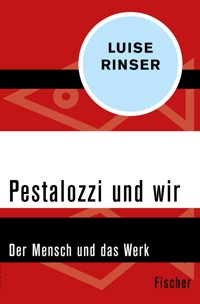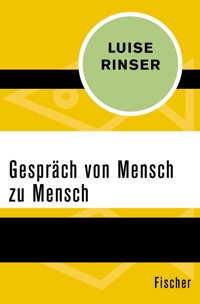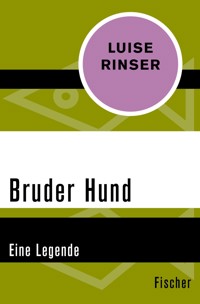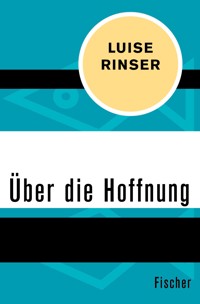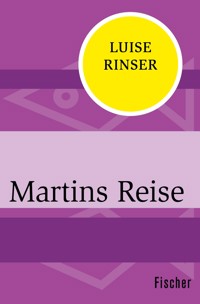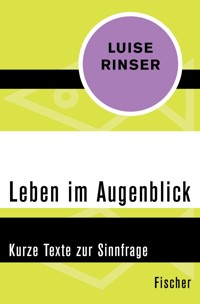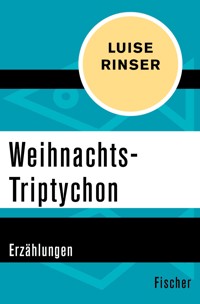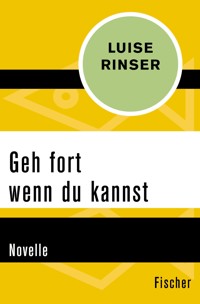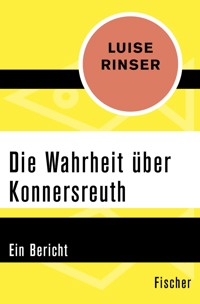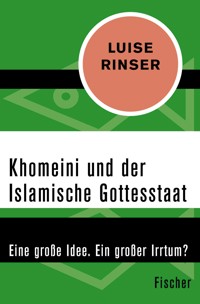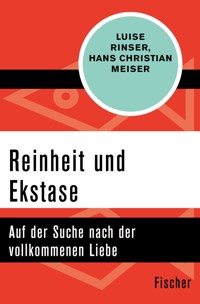
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Luise Rinser und der um viele Jahre jüngere Hans Christian Meiser berühren in ihrem sehr persönlichen Dialog über die Generationen hinweg alle Fragen der Liebe. Ein Gespräch von atemberaubender Intensität sowie ein schonungsloses Plädoyer für das erotische Glück und die spirituellen Dimensionen der Liebe – gegen den Kältehauch der modernen Zeit. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Luise Rinser | Hans Christian Meiser
Reinheit und Ekstase
Auf der Suche nach der vollkommenen Liebe
Über dieses Buch
Luise Rinser und der um viele Jahre jüngere Hans Christian Meiser berühren in ihrem sehr persönlichen Dialog über die Generationen hinweg alle Fragen der Liebe.
Ein Gespräch von atemberaubender Intensität sowie ein schonungsloses Plädoyer für das erotische Glück und die spirituellen Dimensionen der Liebe – gegen den Kältehauch der modernen Zeit.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Luise Rinser, 1911 in Pitzling in Oberbayern geboren, war eine der meistgelesenen und bedeutendsten deutschen Autorinnen nicht nur der Nachkriegszeit. Ihr erstes Buch, ›Die gläsernen Ringe‹, erschien 1941 bei S. Fischer. 1946 folgte ›Gefängnistagebuch‹, 1948 die Erzählung ›Jan Lobel aus Warschau‹. Danach die beiden Nina-Romane ›Mitte des Lebens‹ und ›Abenteuer der Tugend‹. Waches und aktives Interesse an menschlichen Schicksalen wie an politischen Ereignissen prägen vor allem ihre Tagebuchaufzeichnungen. 1981 erschien der erste Band der Autobiographie, ›Den Wolf umarmen‹. Spätere Romane: ›Der schwarze Esel‹ (1974), ›Mirjam‹ (1983), ›Silberschuld‹ (1987) und ›Abaelards Liebe‹ (1991). Der zweite Band der Autobiographie, ›Saturn auf der Sonne‹, erschien 1994. Luise Rinser erhielt zahlreiche Preise. Sie ist 2002 in München gestorben.
Hans Christian Meiser ist promovierter Philosoph, Psychologe und Publizist. Als Herausgeber, Übersetzer und Autor veröffentlichte er zahlreiche Werke. Zudem ist er als TV-Moderator und Filmemacher bekannt. Er lebt und arbeitet in München.
Inhalt
Eines Tages, wenn wir [...]
Vorwort
Der Mythos vom vollkommenen Paar
Abaelards Liebe
Liebe und Freiheit
Der Teil und das Ganze
Von der Geburt des Eros
Liebe meint Dauer
Erotische Initiation
Liebeswerben
Vorgeschmack
Kleine Bekenntnisse
In den Sternen geschrieben
Zwillingsseelen
Fatale Treue
Ego-Problematik
Liebesmystik
Die besitzlose Liebe
Fatale Liebe
Die Falle
Heilige Hochzeit
Göttliche Lust
Das ist mein Freund
Liebe im Paradies
Sappho
Anspruch auf Ewigkeit
Kristalle
Um seiner selbst willen
André und Madeleine
Freundschaft ist Wille
Der Kula-Ring
Ungeteilte Liebe zur Liebe
Außer-sich-Sein
Objekte der Eifersucht
Unglücksmythen
Freiwillige Unfreiheit
Lösung vom Leid
Schöpferische Spannung
Ohne Bedingung
Reine Liebe
Sehn-Sucht
Liebes-Opfer
Eurydike und Orpheus
Verweigerung
Eros und Thanatos
Leben ist Liebe(n)
Im unsterblichen Licht
Alpha und Omega
Nachwort
Eines Tages, wenn wir die Winde, die wehen,
die Gezeiten und die Schwerkraft gemeistert
haben, werden wir in Gottes Auftrag die
Energie der Liebe nutzbar machen. Dann wird
die Menschheit zum zweitenmal in der
Geschichte das Feuer entdeckt haben.
PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
Vorwort
Dieses Buch hat nicht den Ehrgeiz, »Literatur« zu sein und großartig Neues, Philosophisches zu sagen. Es will nur das sein, als was es entstanden ist: ein Gespräch zwischen Menschen, die nach dem »Sinn« suchen und wissen, daß dieser Sinn »Liebe« heißt. Das Buch entstand wie von selbst, so wie sich aus Rede und Gegenrede eben ein Gespräch ergibt. Es hat den Vorteil, spontan zu sein, und den Nachteil, daß es sich mit den angesprochenen Themen nicht mit systematischer Gründlichkeit befaßt. Es ist, was es ist: ein Gespräch in Briefen.
Den Anstoß bildete ein Brief von HCM an mich, die doppelt so alte Frau. Der Autor, mir durch einige seiner Bücher bekannt, stellte mir Fragen, da er mich seinerseits aus meinen Büchern kannte. Wir hatten und haben eine gemeinsame Bildungsbasis, er Philosophie, ich Theologie, er hatte (als Protestant) bei den Jesuiten studiert, mein Lehrer war der Jesuit Karl Rahner – eine solide Basis also, die wir freilich beide durch unsere Beschäftigung einerseits mit östlichen, andererseits mit modernsten westlichen Philosophien überstiegen und durchbrochen hatten. Wir sprechen dieselbe Sprache, ja denselben Dialekt (den Münchnerischen), was unseren Gesprächen eine große Unbefangenheit gab, die, als wir uns Briefe schrieben, ein wenig verlorenging, wodurch die Texte manchmal ein wenig zu literarisch wurden, wie es bei Schriftstellern eben nicht anders läuft. Immer aber sprachen wir nicht nur zueinander, sondern zu unseren Zeitgenossen. Wir hatten immer »den Menschen« im Sinn, oft sogar ganz konkrete Menschen, die uns Beispiel waren oder sind für das von uns Gemeinte – und dieses Gemeinte war und ist immer die Liebe. Die Liebe in all ihren Formen und Miß-Formen. Die Liebe als die große Mangelerscheinung in unserer Zeit-Welt. Eigentlich, das stellten wir nach und nach fest, spielten wir die Rolle der Analytiker und Therapeuten für unsere Mitmenschen, die nicht lieben können. Und vor uns stand ein Bild: das vollkommene Paar. Also nicht etwa die vollkommene Frau (wie Männer sie sehen oder wie die Frauen selbst sein möchten) und nicht der vollkommene Mann, nein: das Paar. Wir schrieben und sprachen immer vom Paar, denn nur das Paar ist der ganze Mensch. Wir reden also weder dem Patriarchat das Wort (wer täte das heute, wollte er ernstgenommen werden!), noch dem Matriarchat, und auch nicht dem Feminismus von heute. Wir reden bewußt vom Paar, von einer uralt-neuen Form des Menschseins, in dem das Männliche und das Weibliche, Yang und Yin, ausgewogen, einen ganzen Menschen darstellen.
Genauer noch gesagt: wir reden nicht von dem Manne und nicht von der Frau, sondern von Phänomenen des Menschlichen, von seinen Erscheinungsformen als Weiblichem und Männlichem, von Phänomenen also, die nicht nur dem Menschen zugehören, sondern den ganzen Kosmos durchziehen und formen. Es ist also nicht so, daß das Männliche identisch ist mit dem Manne und das Weibliche mit dem Weib (der Frau). Wir wissen, daß jeder von uns weibliche und männliche Hormone hat, weibliche und männliche (rudimentäre) Geschlechtsorgane, entsprechend weibliche und männliche Wesenszüge, und entsprechend Lebensaufgaben spezifischer Art über Zeugen und Gebären hinaus. Das Männliche im Mann ist der Krieger, der Seefahrer, der Bergdurchschürfer, der Tempelbauer, der Städtegründer, der Staatenführer, der Zerstörer, der Religionsschöpfer, der Angreifer selbstgeschaffener Feinde … Der Mann, der Herr. Die Frau, die Hüterin des Hauses, die (bisher) physisch Schwächere, darum dem Mann Gehörende, die Hörige.
Die Anthropologen, von ihrer eigenen Wissenschaft dazu gezwungen, wissen heute, daß die uralten Mythen der verschiedenen Kulturen stimmen: Im Anfang war das Wort, und das Wort schuf den Menschen, aber zuerst die Frau, die Muttergöttin, die Fruchtbarkeitsgöttin, das weibliche Fruchtwasser, die Meere, aus denen alles Leben kam.
Man kann sich auch an die griechische Mythe des Platon erinnern: Am Anfang war der ganze Mensch (so sieht es auch die hebräisch-mythische Genesis), der Adam, und er wurde gespalten in zwei Hälften, die männliche und die weibliche. Und seither suchen die beiden Hälften, sich wieder zu vereinigen. Der erotisch-sexuelle Akt als Versuch der Vereinigung. Ein Versuch mit Lust und Sehnsuchts-Schmerzen: er gelingt nur für jeweils kurze Zeit. Was bleibt, ist die währende Sehnsucht, die nie gestillte. (Don Juan nicht als Weiberheld, sondern als tragisch Suchender, nach seiner »legalen« Hälfte suchend; sein Fluch: er findet sie nie und wird dadurch böse und zum Mörder.) Einen positiven Anklang finden wir im Text zu Mozarts (freimaurerischer) »Zauberflöte«: »Und Mann und Weib, und Weib und Mann reichen an die Gottheit an …« Animus und anima, Yang und Yin, Weibliches und Männliches auf der Suche nacheinander, nach der Einheit, nach dem »vollkommenen Paar«, entsprechend dem Ur-Paar: Gott und Göttin in einer Gott-Person. Dies vorläufig gedacht als Ziel der Evolution des Menschen: der geistig-seelische androgyne Mensch.
Darum soll der Mann seine weibliche Seelenhälfte zum Blühen bringen: die Liebe, die Sanftmut, die Barmherzigkeit, das Mitgefühl, den Friedenswillen. Und die Frau, die immer ein wenig voraus ist (man sieht’s an den kleinen Mädchen, die früher laufen und früher sprechen als die gleichaltrigen Buben) soll immer mehr ihren weiblichen Einfluß geltend machen, aber nicht, indem sie patriarchale Muster übernimmt, sondern neue Formen des »demokratischen« Lebens erfinden und durchsetzen soll: Nachbarschaftshilfe aufbauen, Friedensbewegungen unterstützen, den Fremdenhaß ad absurdum führen durch Integration von Ausländern, Religionsstreitigkeiten beilegen helfen – Irland, Iran, Israel-Palästina –, inner-christliche Dissonanzen in ökumenischen Treffen mindern – es gibt viele Aufgaben, die der »weiblichen« Seele entsprechen, viele Impulse, die auf die »männliche« Seele überspringen als Funken, die zum schönen Feuer werden.
Was wir in unseren Briefen aufschrieben, ist nur ein Teil dessen, was wir bei unseren Treffen und abendlichen Telefonaten durchsprachen. Vieles mag in den Ohren konservativer, fundamentalistischer, moralisierender Leser provokativ, ketzerisch klingen. Aber was erschiene nicht »ketzerisch«, was der Zeit um ein Schrittchen vorauseilte?
Vieles auch blieb ungeschrieben und bleibt ungedruckt: all das, was uns zu persönlich erschien, so auch das Wachsen unserer Freundschaft. Denn diese Freundschaft hat selbst eine Geschichte.
Es ist keine Besonderheit, daß mir junge Menschen, Männer und Frauen, lange Briefe schreiben, über ihre Probleme, meist individueller Art, und doch, insgesamt, die allgemeinen Probleme der verunsicherten, skeptischen, heillos pessimistischen Jugend überhaupt. Briefe der Klage, der Anklage gegen Eltern, Vorfahren, Lehrer, »das System«. Oft sind es ur-philosophische Fragen: Wozu lebe ich? Warum lebe ich überhaupt? Wohin führt das alles? …
Ich habe darüber vor Jahren, als Antwort, ein Buch geschrieben mit dem Titel: »Mit wem reden«. Das hieß soviel: Ich möchte mit jemand reden, aber mit wem kann ich denn reden über das, was mich so verzweifelt umtreibt? Ich bin also an Briefe jüngerer Menschen gewöhnt.
Dieser Brief nun war anders. Der Autor war nicht an seinen privaten Problemen, sondern an einer Sache interessiert: an der Geschichte eines Paares, das ein außergewöhnliches war und darum ein außergewöhnliches Liebes-Schicksal hatte, keines, das exemplarisch wäre, und das doch alle Elemente aller unglücklichen Liebesgeschichten zeigt, jener des frühen Mittelalters und aller Zeiten. Abaelard und Heloïse. Der Briefschreiber hatte meinen Roman gelesen, dessen Titel übrigens, anders als die übrigen in 800 Jahren entstandenen Romane über dieses historische Paar, lautet: »Abaelards Liebe«, was ironisch heißt: »So liebt Abaelard«, nämlich auf Kosten der Frau. Eine glücklose Liebe, die dennoch groß und erfüllt war, was meinen Briefschreiber auch zu der Frage trieb, ob die »vollkommenen Paare«, nach denen er suchte, auch zugleich glücklich waren. Er kommt zu dem Schluß, daß das Paar, das von der Literatur 800 Jahre lang als »Hohes Paar« verherrlicht wurde, in Wirklichkeit zwar ein großes Liebespaar war, aber eines, das vor seinem Schicksal versagte. Ein höchst interessantes Paar, gewiß. Beide aus französischem Adel (aus rivalisierenden Familien), beide schön, leidenschaftlich, beide akademisch hoch gebildet (auch die Frau, wie denn damals im frühen Mittelalter einige Aristokratinnen mindestens ebenso gebildet waren wie die Männer).
Was nicht stimmig war, das war der Altersunterschied: Abaelard, Professor an der Pariser Sorbonne, war vierzig, seine Schülerin etwa achtzehn. Sie verliebten sich, das heißt, der Professor (der schon einige erotische Erfahrung hatte) »begehrte« das Mädchen, das sich ihm nach nicht allzu großem Widerstand ergab, mit dem er einen Sohn zeugte, den er aus dem Licht der Öffentlichkeit verschwinden ließ bei Verwandten auf dem Land. Aber warum die Vertuschung des Kindes? Wieso wollte die Frau, daß der Mann weiterlebte, als hätte er weder Frau noch Kind? Weil beiden (beiden!) die Karriere des Mannes wichtiger war. (Ich habe aus der obskuren Geschichte des versteckten Sohnes meinen Roman gemacht, die Liebesgeschichte seiner Eltern von ihm aus gesehen. Eine neue Problemstellung.)
Nun: mein Briefschreiber findet, das Paar habe bei aller (bis zum Tod währenden) Liebe eben vor der Liebe versagt. Und zu dieser seiner Meinung wollte er die meine wissen.
Aus dieser Frage entwickelte sich unser Briefwechsel, der immer neue Aspekte der Liebe ins Spiel brachte. Liebe von heute. Klassische Lieben. Große Liebe, kleine Liebe, falsche Liebe, unglückliche Liebe, homosexuelle Liebe, Dreiecks-Liebe, Freiheitsberaubung durch Liebe …
Wir waren nicht immer einer Meinung, aber in einem Punkt waren wir ganz und gar einig: Die Menschheit hat nur dann Zukunft (eine positive Zukunft), wenn sie lernt zu lieben. Unser Buch trägt, ungedruckt, den Titel: Heilung durch Liebe.
Bei der Revolte in China von 1989 brachte das Fernsehen eine Szene vom Tien-Anmen-Platz: Ein großer Panzer fährt auf, ihm stellt sich ein Student mit ausgebreiteten Armen entgegen, einer allein, schutzlos, verzweifelt mutig. »Sinnlos«, könnte man sagen. Ein Opfer, das nichts bewirkt angesichts des riesigen Panzers, Sinnbild der übermächtigen Staatsmaschinerie. Und doch: der Panzer stoppt. Der tollkühne Student, todesbereit, wird, in all seiner Schwäche, zum Hindernis. Wie können junge chinesische Soldaten einen einzelnen jungen Chinesen totwalzen? Sie können es nicht. Man nimmt ihn gefangen. Man sieht, wie ein Soldat dem jungen Rebellen die Handschellen anlegt: langsam, behutsam, fast zärtlich, und sein Gesicht drückt Trauer aus. Trauer über die Notwendigkeit, Gewalt anzuwenden.
Der Student, der sich dem mächtigen Panzer entgegenstellt: das Bild des einzelnen Menschen, der in den Lauf der Welt nicht einzugreifen vermag und dennoch Veränderungen auslösen kann.
Das Bild unserer Utopie. Unsere Worte vermögen nichts. Und doch sprechen wir sie aus – in der leisen Hoffnung, sie möchten von einigen gehört werden, die leiden und das einzige Rettungsmittel nicht kennen: die Liebe zum Mitmenschen und zu allen Mitgeschöpfen. Und wenn es nur ein einziger hörte, so wäre das Buch nicht umsonst in der Welt erschienen.
Der Mythos vom vollkommenen Paar
Es ist nicht eine Stunde her, daß ich Ihren Roman »Abaelards Liebe« zu Ende gelesen habe. »Gelesen« mag der falsche Ausdruck sein; vielmehr habe ich Ihr Werk über die berühmteste Liebesgeschichte des Mittelalters so intensiv und rasch in mich eingesogen, daß ich nunmehr wach liege und darüber grüble, was das vollkommene Paar sei. Wurde es wirklich manifest in Heloïse und Abaelard? Oder in Diotima und Hyperion? Oder in Charlotte und Werther? Vielleicht sogar in Yoko Ono und John Lennon? Oder in …? Die Liste derer, die hier unsere Achtung und Aufmerksamkeit verdienen, mag endlos fortgesetzt werden – wichtiger aber ist mir die Frage, was denn solche Lieben so außergewöhnlich aussehen läßt. Denn mir scheint darin ein großer Widerspruch verborgen: Einerseits lassen sich nicht nur romantisch veranlagte Seelen vom Mythos des vollkommenen Paares leiten, das allen Unbilden des Lebens trotzt, andererseits aber sind selten zwei Menschen zugleich fähig, dieses hohe Ideal zu verkörpern, weshalb es bei den Ausnahmen bleibt, die ihre Verewigung in der Literatur finden. Aber was geschieht im Leben, im wirklichen Sein?
Sie kennen sicher Otto Mainzer, den unermüdlichen Vorkämpfer einer liebevollen Gesellschaftsordnung, die er auf der Basis eines unkorrumpierten Eros erbauen wollte. »Die sexuelle Zwangswirtschaft« lautet sein erotisches Manifest, in dem er die unheilvolle Verquickung geschlechtlicher Bedürfnisse mit wirtschaftlichen Interessen anprangert, bei denen weder die Aufgaben des Geschlechts noch die der Wirtschaft befriedigend gelöst werden können. Ich frage mich, ob es nicht die falsche Liebes- (und somit Lebens-)art sei, welche für die andauernde Misere der conditio humana verantwortlich ist. Um es ganz simpel auszudrücken: Ein Mensch, der wirklich liebt, führt keinen Krieg. Oder etwa doch? Ist beides zugleich möglich? Wie konnten und können Familienväter, die ihre Frauen und Kinder mit großer Wahrscheinlichkeit ja lieben, in den Krieg ziehen und andere derselben Art abschlachten? Wirkt hier vielleicht ein ganz anderes Prinzip, eines, das mit christlichen Moralvorstellungen nicht erklärt werden kann? Liegen die Wurzeln dieses Phänomens so tief im Verborgenen, daß wir sie weder zu erkennen noch zu finden vermögen? Verzeihen Sie bitte, daß ich Ihnen solche Fragen stelle (und dies auch noch auf so verworrene Weise), doch es ist jetzt 2.15 Uhr morgens, und jenes scheinbar so vollkommene Paar läßt mir keine Ruhe und treibt mich, tiefer und tiefer in das Geheimnis von Sehnsucht und Erfüllung einzudringen. Doch komme ich gleichzeitig nicht umhin anzunehmen, daß Heloïse und Abaelard als Sinnbild für die wahre Liebe ganz und gar nicht taugen. Haben sie nicht letztlich beide versagt? An sich selbst und am andern? Flohen sie nicht vor sich selbst und dem andern? Verkörpert der »liebende« Abaelard nicht jene patriarchale Gewalt, welche als männliches Prinzip alles Weibliche unterwirft und somit für den erschreckenden Zustand der Welt verantwortlich ist? Und stellt die »liebende« Heloïse nicht das Prinzip des sich unterwerfenden Weiblichen dar, das sein Recht auf erotische Erfüllung gegen häusliches Eingesperrtsein (Sicherheitswunsch, das gilt auch für das Kloster!) eintauscht? Einem erotischen Idealisten graust es bei der Vorstellung der Versorgungsehe, welche den bürgerlichen Staat bis dato aufrechterhält. Das System – von Männern errichtet – ist nahezu perfekt.
Halten Sie mich nun bitte nicht für einen Post-Feministen, ich nehme mir lediglich die Freiheit, die Liebes- und Lebensgewohnheiten der Menschen zu hinterfragen. Auf meinen Reisen durch die ganze Welt muß ich – vor allem bei Naturvölkern – immer wieder feststellen, wie grausam das Christentum die natürlichsten Triebe des Menschen verstümmelt hat, doch gilt mein Vorwurf nicht allein der Theologie derer, die sich auf den Mann aus Nazareth berufen, sondern jeder monotheistischen Religion. Und da alle theologischen und politischen Systeme erkannt haben, daß nur ein in seinem Sexualverhalten gemaßregelter Mensch keine Gefahr darstellt, ist es nur logisch, daß aus Gründen des Machterhalts immer wieder von neuem versucht wird, dem erotischen Streben, in welcher Form auch immer es auftreten mag, Einhalt zu gebieten. Hinzu kommt, daß niemals in der Geschichte beide Geschlechter gleichzeitig befreit wurden; stets geschah der Versuch, das eine zu befreien, auf Kosten des anderen.
Ein freier Geschlechtsakt in vollendeter Schönheit zwischen Menschen, die einander in Freundschaft und ohne anderweitige Absichten zugetan sind, ist eine der schönsten Gaben des Lebens. Weshalb sind diese Gaben so selten? Weshalb kümmern sich Menschen mehr z.B. um die rechte Form der Geldanlage als um die perfekte orgiastische Erfüllung? Wir kennen aus anderen Kulturen und Religionen Schilderungen und Berichte über die heilige Erotik, die absichtslose Hingabe, die Vermengung von Fruchtbarkeitsriten und spiritueller Sexualität. Im Christentum sind diese Geheimnisse lediglich in der Architektur der Gotteshäuser geborgen: Der Kirchturm verkörpert das Männliche und die Fensterrosette das Weibliche. (Die Apsis versinnbildlicht dabei stets den Mutterschoß.) Woran liegt es, daß diese natürlichen Bezüge zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen verdrängt wurden? Weshalb hat die Naturwissenschaft den Ur-Orgasmus, aus dem die Welt entstand und von dem sämtliche Schöpfungsmythen zu erzählen wissen, in einen unlustvollen Ur-Knall (»Big Bang«) verwandelt?
Sie sehen, zu welchen Gedanken mich Ihr Buch treibt. Ihre Worte lösen in mir etwas aus, das scheinbar friedlich vor sich hin schlummerte und jetzt mit aller Kraft hervorbricht: die Suche nach Antwort. Antwort auf viele Fragen, etwa auf diese: Weshalb sind der Friede und die Liebe stets nur von kurzer Dauer? Oder sind meine Betrachtungen zu äußerlich? Ist das Geheimnis nur im Inneren transparent? Mainzer schreibt, die Korrumpierung des Geschlechts sei die eigentliche und einzige Erbsünde der Menschheit. Was halten Sie von dieser gewagten These?
Ich wende mich an Sie, da ich weiß, daß Sie einer der wenigen Menschen sind, die nicht an Konventionen festhalten. Dies veranlaßt mich, Ihnen diese Zeilen zu senden in der Hoffnung, in Ihnen einen gleichgesinnten Menschen zu finden, der es wagt, mit mir gemeinsam die Tiefen auszuloten. »Ich wäre zu Grunde gegangen, wäre ich nicht zum Grund gegangen«, sagt Hölderlin. Ich würde mich freuen, mit Ihnen gemeinsam einen Schritt weiterzugehen. HCM.
Abaelards Liebe
Eigentlich erwarten Sie keine schlüssigen Antworten auf Fragen, die, wie alle großen »letzten Fragen«, keine Antwort erhalten. Ihre große Kernfrage heißt, auch wenn Sie sie so nicht formulieren: Was ist denn Liebe?
Darauf kann ich nur eines sagen: Lieben Sie, dann wissen Sie, was Liebe ist. In Worten sagen kann man’s sowenig, wie man einem nach Gott Fragenden sagen kann, wer oder was Gott ist.
Aber in den Grenzen des Sagbaren will ich versuchen, auf Ihre Fragen zu antworten – auch wenn ich meine, Sie können recht gut selbst antworten. Ich kenne ja einige Ihrer Bücher, genau gesagt Ihre Vorworte zu Büchern, die Sie herausgeben, zum Beispiel das über und von Khalil Gibran, der so schön über Liebe schreibt. Aber da Sie mich auf meinen Abaelard-Roman ansprechen, konzentriere ich mich zunächst darauf.
Ist Ihnen aufgefallen, daß es über das Paar Abaelard und Heloïse eine Reihe von Romanen aus verschiedenen Zeiten gibt, auch aus dem frühen Mittelalter, und daß der Titel immer heißt: »Abaelard und Heloïse«? Immer Abaelard, der Mann, zuerst. Es ist also die Geschichte eines Mannes; jene der Frau ist von zweitrangigem Interesse. Erst im 20. Jahrhundert gibt es einen Roman (oder Essay, oder beides, ich vergaß), der heißt: Heloïse und Abaelard. Mein Titel nun heißt: »Abaelards Liebe«. Mit großem Bedacht gewählt und mit einem nicht überhörbaren Ton von Bitterkeit, der sagen will: So also liebt Abaelard, der Mann. Nämlich: er glaubt zu lieben, aber er liebt nicht. Noch schärfer: So liebt der Mann, so lieben Männer, so unzulänglich, so falsch. Das klingt feministisch, also aggressivironisch, nicht wahr? Und es klingt anklägerisch. Sie könnten daraus schließen, daß ich bittere Enttäuschungen mit Männern, mit dem Mann als Geschlechtswesen gemacht habe. Aber nein! Ich habe Männer, den Mann, das Männliche im Mann immer zu gut verstanden, um es zu verurteilen.
Nun – dieser Abaelard: was für ein Mann war er denn? Wir wissen viel von ihm: Er lebte im 12. Jahrhundert, war ein philosophisch-theologischer Revolutionär, Professor an der Sorbonne in Paris, umstritten, bewundert, verurteilt, rehabilitiert, wieder verurteilt. Ein höchst interessanter Mann, der sich mit 40 Jahren in seine gescheite hübsche Schülerin Heloïse verliebte, mit ihr ein Kind zeugte und sie dann (nachdem er sie ehrenhalber – aber heimlich! – geheiratet hatte) verließ. Rund heraus gesagt: um seiner Karriere willen. Ein Professor der Sorbonne und Domherr dazu (er war aber kein Zölibatär!) durfte (das war die – unkirchliche – Regel) keine Ehefrau haben. So opferte der Mann seine Frau, seinen Sohn, seine Liebe, verzichtete aber nicht völlig auf seine ehelichen Rechte: Er traf Heloïse, die auf sein Verlangen »freiwillig« Nonne und Äbtissin wurde, bisweilen heimlich, er liebte sie auf seine Weise weiter, aber in Heuchelei. Heloïse liebte ihn bis zum Tod in reiner starker verzichtender Liebe. Sie litt. Er nicht. Nicht um der Liebe willen. Er hatte seine Kompensation in seiner Karriere und seiner Wissenschaft.
Ist dieser Mann nicht unsympathisch? Typisch männlich … Und was habe ich mit ihm zu tun? Ich habe ihn nicht als Romanfigur geschaffen. Ich habe ihn »vorgefunden«, ich habe ihn nicht besser und nicht schlechter gemacht, aber – nun komme ich zu einem geheimnisvollen Aspekt der Liebe und der Literatur zugleich – mir ging es wie einst Heloïse: Ich liebte ihn. Warum, zum Teufel? Mußte ich ihn nicht eher hassen? Als Frau den Mann verurteilen? Dieser Abaelard behielt über 800 Jahre seine männliche Faszination auch für eine feministische Frau. Wer kann’s erklären? Niemand. Denn Liebe gehört zu den Phänomenen, die ein Geheimnis sind.
Heloïse und Abaelard: eine unglückliche Liebe, ein leidenschaftliches glückloses Paar.
Frage: Hätte ich als Roman-Autorin nicht besser ein anderes Liebespaar gewählt, ein Paar mit einer erfüllten schönen Liebe? Nur: wo ist so eines?
Sie nennen berühmte Liebespaare. Ist da eines glücklich? Ich könnte Ihrer Liste noch einige Namen hinzufügen: Kleist und sein Jettchen, Goethe und Marianne Willemer, Romeo und Julia … Lassen wir sie einmal glücklich sein. Aber wie denn? Heiraten sie und führen eine glückliche Ehe? Goethe und die Vulpius – sie hatten eine gute Ehe, lebenslang. Aber wo bleibt der Raum für Größe, für große Liebe? Die Liebespaare, die Sie nennen, sind alle unglücklich, das heißt unerfüllt, wenigstens für Dauer. Sind sie »glücklich«, dann in der Tragik ihrer Leidenschaft.
Es scheint so zu sein, daß die Liebe ihre Größe aus eben ihrer Tragik erhält. Würden die genannten Paare befragt, ob sie sich ihre Liebe anders hätten wünschen wollen, würden sie sagen müssen, daß ihre Liebe ihre Erfüllung in der Nicht-Erfüllung fand.
In der katholischen Kirche feiert man dieser Tage das Fest des Johannes vom Kreuz. Er war einer der ganz großen Dichter Spaniens. Sie kennen natürlich seine Dichtungen, vor allem »Die dunkle Nacht«. Seine Lieder sind Hymnen auf die Liebe. Sehr große Dichtung, ähnlich dem »Hohen Lied«. Liebesdichtung höchst erotisch, auch sexuelle Bilder nicht auslassend. Wer ist die besungene Geliebte? Keine Frau, vielmehr jede konkrete Frau übersteigend – das weibliche Du, die Seele, oder das Weiblich-Seelenhafte Gottes. Diese Liebe ist mystisch – wie jede große Liebe. Hätte jener Spanier eine normal erfüllte Liebe erfahren, hätte er seine große Dichtung nicht geschrieben. Ist es denn immer der Mangel (wenn es denn einer ist), der einem Dichter große Liebeslieder entreißt? Sehen wir Hölderlin: Wäre seine Liebe zu Diotima eine erfüllbare gewesen – was wäre aus seinem Hyperion geworden? Und »Tristan und Isôt«, der frühe französische Roman, der Richard Wagner zu seinem Tristan inspirierte – war er etwa der Roman einer glücklichen Liebe? Hölderlin schreibt:
»Des Lebens Woge
schäumte nicht so schön,
wenn nicht der alte Fels,
das Schicksal, ihr entgegenstünde.«
Setzen wir statt Leben Liebe. Je stärker eine Liebe unter einem Druck zu leiden hat, um so mehr erhitzt sie sich.
Ist es nicht überhaupt so, daß große Dichtung nur aus Leiden entsteht? Aus der leidenden Sehnsucht nach dem »Ganzen«, nach dem Fehlenden?
Aber damit bringen Sie mich (bringe ich mich) zu weit in die Metaphysik hinein, finden Sie nicht? Ihr Brief enthält noch andere, recht konkrete Fragen, zum Beispiel jene, warum es Kriege gibt, wenn Männer ihre Frauen und die Liebe lieben und dennoch andere »hassen« (sich Feinde erschaffen) und töten. Da stoßen wir auf einen anderen Aspekt der Liebe. Vielleicht können wir einmal darüber reden statt zu schreiben. Liebe in hundert Gestalten – ein endloses Thema. L.R.
Liebe und Freiheit
Welch freudige Überraschung: So schnell hatte ich Ihre Antwort nicht erwartet. Noch freudiger stimmt mich freilich Ihr Vorschlag, mit mir in einen Dialog über ein »endloses Thema« einzutreten – und dies nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich. Wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich Sie in einigen Wochen in Rocca di Papa aufsuchen.
Ist es nicht eigenartig, daß gerade Sie sich in unmittelbarer Nähe zur Sommerresidenz des Papstes niedergelassen haben? Und ist es nicht noch merkwürdiger, daß gerade das katholisch dominierte Italien in aller Welt als besonders liebesträchtiges Land gilt? Eigentlich sollte man den Eindruck haben, daß die kirchliche Moral dem Liebesglück des einzelnen und der Gesellschaft eher entgegensteht! Doch die Kombination »Italien und Liebe« scheint bei vielen Paaren beinah mythisch zu sein. Denken Sie nur an die berühmte Hochzeitsreise nach Venedig oder an verliebte Tramper, die in die Toskana reisen wollen, oder an den nie enden wollenden Hunger nach italienischen Liebesschnulzen! Und die Italiener selbst stehen ja in dem Ruf, ganz besondere Meister auf dem Gebiet der Liebe zu sein. Über all dem thront nun eine Kirche, die sich auf Jesus Christus beruft, jenen Mann aus Nazareth, der den Menschen eine Botschaft brachte, die inmitten des römischen Imperialismus nichts anderes sagte als dies: »Liebet einander.« Jesus führte ein Leben im Leid, seine Botschaft wurde groß, weil sie im Leid und aus ihm heraus entstand – hier sind wir bei den Liebenden angelangt, bei der (wie Sie es nennen) leidenden Sehnsucht nach dem Ganzen. Wir kennen Platons Erzählung von der ursprünglichen Kugelgestalt der Menschen. Sie hatten um ihren runden Leib vier Arme und vier Beine und waren so »gewaltig an Kraft und Stärke«, daß die Götter im (griechischen) Himmel fürchteten, sie könnten eines Tages von diesen Erdenwesen angegriffen werden. Flugs ersann man einen Plan: Die Menschen wurden in der Mitte geteilt. Seither irren sie umher – stets auf der Suche nach der verlorengegangenen Hälfte. Mir gefällt diese einfache Vorstellung, weil sie vieles erklärt. Einmal die Redewendung von der »besseren Hälfte«, zum andern aber auch – da die Kugelwesen verschiedener Art waren: rein männlich, rein weiblich, gemischt-geschlechtlich – die drei Arten der möglichen Verbindungen zwischen Menschen: Frau / Mann, Frau / Frau, Mann / Mann. Und auch der Aspekt der ewigen Sehnsucht ist hier miterfaßt. Ist der geliebte Mensch nicht bei uns, spüren wir ganz deutlich, daß uns etwas fehlt. Aus der Verarbeitung dieses Mangels entsteht dann das, was einen Großteil der kulturellen Leistungen ausmacht: Geschichten der Liebe in Musik, Literatur und Kunst (mit und ohne »Happy-End«).
Sie sagen, die Liebe erhalte ihre Größe aus ihrer Tragik. Ist das nicht eine rein abendländische Idee? Dem Buddhismus ist ja ein solcher Gedanke eher fremd. Denn hier wurde erkannt, daß es die Gier nach Leben (und somit auch nach Liebe) ist, die uns daran hindert, unser Mensch-Sein zu vervollkommnen. Was der Buddhismus anstrebt, ist Freiheit, Freiheit von allem, nicht wie das Abendland, das Freiheit für etwas wünscht. Vor einiger Zeit stieß ich auf einen merkwürdigen Zusammenhang: Die indogermanische Wortwurzel von Freiheit lautet »fri«, und daraus leitet sich auch der »Friede« ab sowie das Wort »Freier« bzw. »freien«. »Freien« aber bedeutet »lieben«. Hängen also Freiheit, Friede und Liebe irgendwie zusammen? Ich möchte sagen, ja. Denn nur ein freier Mensch kann wirklich lieben, und ein liebender Mensch empfindet tiefen Frieden. In einer Formel ausgedrückt würde dies so lauten: FREIHEIT IST FRIEDE ALS LIEBE. Das »also« meint »in Gestalt von«. Philosophisch könnte man auch sagen: »Sein ist Bewegung als Leben«, und da Weihnachten vor der Türe steht, hier noch die theologische Variante: Gott ist Heiliger Geist als Jesus. HCM.
PS: Eben schießt ein ganz merkwürdiger Gedanke durch meinen Kopf: Wird jemand, der etwa am 24. Dezember geboren wird, nicht um den 24. März herum gezeugt? Zu dieser Zeit (21. bis 23.3.) aber findet die Frühjahrs-Tagundnachtgleiche statt, d.h. das Leben kehrt nach dem Winter auf die Erde zurück. Ist die Geburt Jesu vielleicht sogar naturmythologisch zu verstehen? Soll sie ein Hinweis auf die Zusammengehörigkeit des männlichen und weiblichen Prinzips und des daraus folgenden Ereignisses sein? Ein Symbol für Fruchtbarkeit, für das sich stets aus sich selbst hervorbringende neue Leben?
Der Teil und das Ganze
Als ich den Anfang Ihres Briefes las, mußte ich lachen. Dann dachte ich: Da hat sich der HCM einen Scherz erlaubt oder aber einen ironischen Seitensprung. Wie könnte er sich im Ernst eine Beziehung denken zwischen der Wahl meines Grundstücks und dem Vatikan-Besitz Castel Gandolfo? Freilich liegt mein Haus in der Luftlinie wenige Kilometer entfernt von der päpstlichen Sommerresidenz, aber das ist eben nur eine Luftlinie, nichts weiter. Das Motiv für den Kauf des Grundstücks war sehr profan: Das Stück Land war billig und schön gelegen. Sie werden es ja eines Tages sehen.
Eben fällt mir ein, daß Ihre Anspielung durchaus nicht so absurd ist, wie es scheint – aber das ist keine private, sondern eine historisch-politische Beziehung. Im 14. Jahrhundert ließ sich der bayerisch-deutsche König Ludwig IV. in Rom von einem von ihm eingesetzten (Gegen-)Papst zum Kaiser krönen, nachdem es ganz in der Nähe meines Wohnortes einige Kämpfe gegeben hatte zwischen dem römischen Adel und bayerischen Söldnern Ludwigs IV. Nach erfolgter Krönung entschlossen viele der Söldner sich, nicht mehr in den Norden zu ziehen (was ich gut verstehe). Sie ließen sich in dem Dorf nieder, das nun heißt: Rocca di Papa. Der Papstfelsen. Also doch eine Beziehung zwischen dem Papst und meinen katholisch-bayerischen Vorfahren. Mehr noch: Die bayerischen Söldner heirateten einheimische Mädchen. So spielte denn die Liebe damals ihre völkerverbindende, gesellschaft-bildende Rolle dort, wo der Papst und ich Häuser haben. Wie weit die Liebe der Soldaten und der italienischen Bauernmädchen die Moral bestimmte, gar auf die Dauer von Jahrhunderten, ist nur zu vermuten.
Historisch zu belegen ist auch die Verbindung so widersprüchlicher Phänomene wie Liebe und Krieg: Als die Römer im 3. Jahrhundert in den Norden zogen und die Germanen besiegten, gründeten sie nicht nur »unsere« Städte längs des Limes (Regensburg, Augsburg, Köln), sondern nahmen sich auch blonde Germaninnen zu Geliebten und zeugten Kinder.
Es ist also nicht einfach so, daß Italien liebesträchtig ist, sondern der Kampf, der Krieg, die Nähe des Todes. Überall und immer, wo menschliche Urleidenschaften geweckt werden, begegnen sich Eros und Thanatos. Was nun die Liebesträchtigkeit Italiens anlangt, so ist eine ihrer Wurzeln das Klima. Wärme ist »gliederlösend, wie die griechische Dichterin Sappho von der Liebe sagt. In der Tat bewirkt die italienische, die südliche Sonne eine Lösung nordischer Spannungen. Unser Goethe, ein doch recht steifer junger deutscher Jurist, gebunden an eine auch recht steife deutsche puritanische Bürgerin (Charlotte von Stein), reiste nach Italien und befreite sich dort zu Liebe und sinnlicher Leidenschaft – zum Heil seiner Gesundheit und seiner Dichtung. So wie ihm erging es vielen Nordländern.
Sie erwähnen Platons Erzählung von der Trennung des ursprünglichen Kugelmenschen in Mann und Frau. Das ist ein großer Mythos: Einmal war der Mensch ein Ganzes. Er war männlich und weiblich zugleich. Er war Yang und Yin, wovon die Chinesen sprechen. Dann trennte sich die Schöpfung in die männliche und die weibliche Welt. Seither ist das Gleichgewicht der Schöpfung gestört. Das Männliche riß die Herrschaft an sich, und so blieb es, was immer man dagegen anführen mag. Ich rede nicht simpel von äußeren Machtverhältnissen, sondern von innerseelischen Kräften, oder sagen wir: von zwei entgegengesetzten Polen: von Aggression und Mitgefühl. Der ganze Mensch hat beide Pole. Aber wo gibt es diesen ganzen, den »heilen«, den »heiligen« Menschen? Es gibt die Platonschen Teilmenschen, und es gibt die uralte Sehnsucht des einen Teils nach dem andern. Diese Sehnsucht bleibt meist unbewußt. Man weiß nicht, was man bei einem andern sucht. Man ist sehn-süchtig nach dem andern Pol. Man erfährt die Erfüllung in dem Gefühl der Liebe.
Aber erfährt man in jeder Liebe wirklich Liebe? Man erfährt Verliebtheit. Man ist entzückt von einem Teilaspekt eines andern Wesens: von der Schönheit, von der erotisch-sexuellen Anziehungskraft, von der Stimme, von einem besonderen Talent, und man nimmt kurzschlüssig den Teil fürs Ganze und ist bestürzt, wenn man nach einiger Zeit merkt, daß man das Ganze nicht kennt und daß die Verliebtheit in einen Teil nicht die ganze Person meint. Man ist, wieder einmal, tief enttäuscht.
Hier komme ich zurück auf Ihre Frage nach der »Liebesträchtigkeit« Italiens. Auch hier finden wir die Sehnsucht des Teils nach dem Ganzen. Sagen wir’s in einem Bild: Italien ist ein Yin-Land, ein weibliches, ein Venus-Land. Deutschland ist ein Yang-Land, ein männliches, ein Mars-Land. Daher die gegenseitige Anziehung, wobei die Anziehung des Nordens für den Süden sich als neidvolle Bewunderung äußert, während die Sehnsucht des Nordländers auf das erotische Talent des Südländers zielt, auf die »gliederlösende« Liebe, auf den Mangel an Berührungsscheu, auf die Freiheit von Ängsten und puritanischen Schuldgefühlen.
Damit komme ich auf Umwegen zurück zur Beziehung zwischen »Vatikan« und »Liebe«. Das aber würde heute zu weit führen. Es ist ein weites und leidvolles Feld, vermint von Mißverständnissen auf beiden Seiten. L.R.
Was Sie als Postscriptum anführen, nehme ich als eben solches auf: die korrespondierenden Daten von Zeugung und Geburt des naturmythischen Jesus: Mariä Verkündigung (Frühlingsbeginn) und Weihnacht (als Wintersonnenwende). Wie schön sind doch unsere Mythen – jenseits jeder Dogmatik!
Von der Geburt des Eros
Würden Sie mich brieflich oder mündlich mit meiner geschlechtsspezifischen Anrede ansprechen, hieße es »Lieber Herr Meiser«, nicht etwa »Lieber Mann Meiser«. Frau-Mann, Dame-Herr – so lauten doch die Begriffspaare! Also müßte ich schreiben: »Liebe Dame Rinser«, aber dies ist (leider) ganz unüblich. Unterstreicht diese unterschiedliche Behandlung von Frau und Mann nicht die einst erfolgte männliche Machtübernahme? (Allerdings gibt es in anderen Sprachen eine so deutliche, das Weibliche herabwürdigende, maskuline Dominanz nicht. Die Deutschen müssen eben immer alles besonders gründlich machen!)
Anstatt mich aber mit Sprachproblemen, die das Verhältnis der Geschlechter zueinander betreffen, herumzuschlagen, möchte ich Ihnen lieber für Ihren letzten Brief danken. Wir treten ja offenbar in einen regelrechten Diskurs über das Thema »Liebe« ein – und dies noch in Briefform –, so sei es also.
Die Vorstellung eines einstmals »ganzen«, zweigeschlechtlichen, androgynen Menschen scheint mir nicht so abwegig, wie dies vielleicht manche »aufgeschlossenen« Zeitgenossen glauben möchten. Schließlich würde diese Idee endlich auch die alte Frage, warum Männer Brustwarzen haben, die ja eigentlich bei ihnen überflüssig sind, beantworten. Sie sind eben ein entwicklungsgeschichtliches Relikt des biologischen Urkörpers, ebenso wie (manche Forscher behaupten dies) die Klitoris ein zurückentwickelter Penis ist.
Was sucht nun der Teilmensch? Die Ergänzung? Die Erfüllung? Die Erfüllung durch Ergänzung? Liegt in dieser Sehnsucht, in diesem Wollen, nicht die unbewußte Forderung »Mach mich ganz«? Scheitern Liebe, Beziehung, Ehe aber nicht oft gerade an diesem Anspruch? Denn wie sollte jemand, der ja selbst nicht (mehr) ganz ist, den andern ganz machen können? Daher die beidseitige Enttäuschung.
Ich erinnere mich einer Freundin (sie war Waise), welche mich unablässig mit dieser Forderung konfrontierte. Ihr Heimweh (im tiefen Sinn als Sehnsucht nach dem Ursprung), also ihr Wunsch, zurückzukehren in die verlorene Heimat der Ganzheit, war so groß, daß sie sich und mich ständig überforderte, so daß es schließlich zum Bruch kam. Heute verstehe ich ihr und mein Verhalten natürlich wesentlich besser. Ich denke, daß wir letztlich alle nichts anderes wollen, als das Gefühl wieder zu spüren, das uns die Urheimat, der Mutterleib vermittelt hat. Liebenden, die gerade vor einer möglichen Trennung stehen, möchte ich sagen: Trennt euch, wenn ihr meint, danach glücklicher zu sein; aber macht dem anderen keine Vorwürfe.