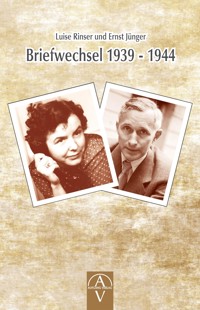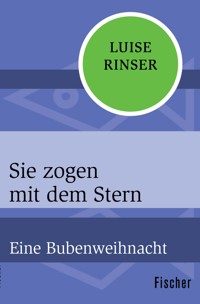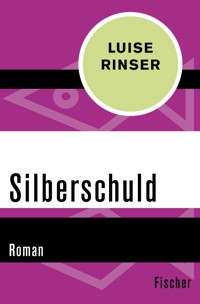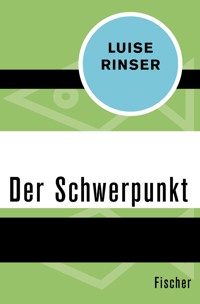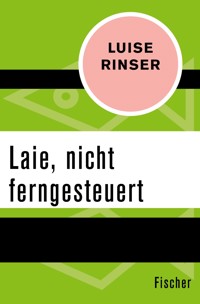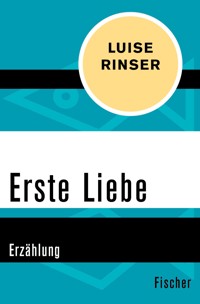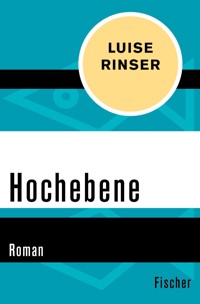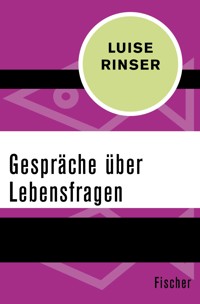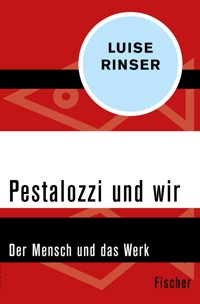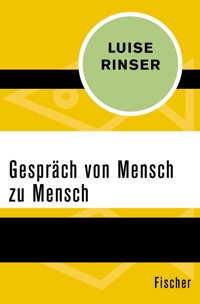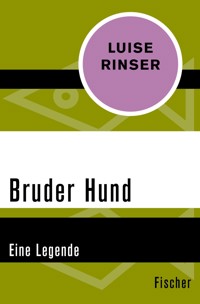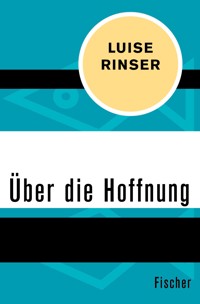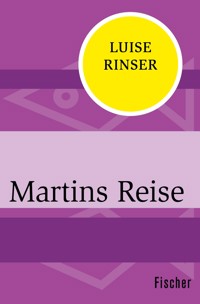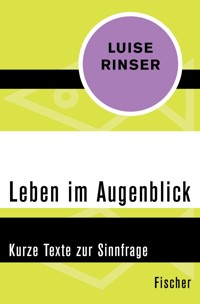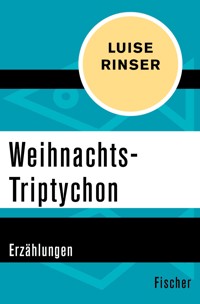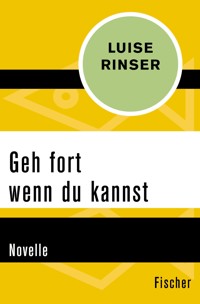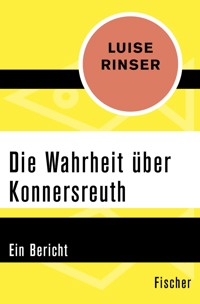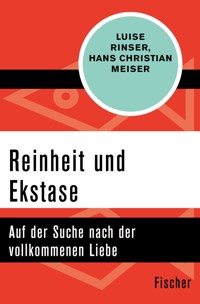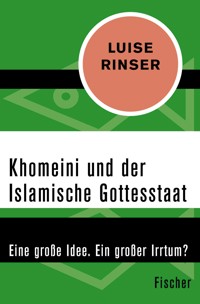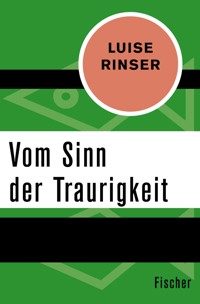
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem erstmals 1962 veröffentlichten Essay nähert sich Luise Rinser dem Begriff der Schwermut, ihrer Motive und Konsequenzen. Mittels einer genauen Analyse wird die Schwermut von verwandt erscheinenden Begriffen abgegrenzt und in ihrem historischen Kontext betrachtet. Rinser schlägt dabei einen Bogen von Thomas von Aquin über Kierkegaard bis hin zu der Frage, ob sich der Schwermütige an Gott schuldig macht. Denn: »ohne Hoffnung ist man kein Christ«. Anders als die Verzweiflung beinhaltet Schwermut für Rinser jedoch immer auch Hoffnung. Der mit dem Leiden vertrauten christlichen Existenz kann sie so zu einer Quelle des Trostes werden, zur »felix tristitia« eben. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 33
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Luise Rinser
Vom Sinn der Traurigkeit
Über dieses Buch
In diesem erstmals 1962 veröffentlichten Essay nähert sich Luise Rinser dem Begriff der Schwermut, ihrer Motive und Konsequenzen. Mittels einer genauen Analyse wird die Schwermut von verwandt erscheinenden Begriffen abgegrenzt und in ihrem historischen Kontext betrachtet. Rinser schlägt dabei einen Bogen von Thomas von Aquin über Kierkegaard bis hin zu der Frage, ob sich der Schwermütige an Gott schuldig macht. Denn: »ohne Hoffnung ist man kein Christ«. Anders als die Verzweiflung beinhaltet Schwermut für Rinser jedoch immer auch Hoffnung. Der mit dem Leiden vertrauten christlichen Existenz kann sie so zu einer Quelle des Trostes werden, zur »felix tristitia« eben.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Von Sinn der Traurigkeit
Von Sinn der Traurigkeit
Wer sich daran begibt, in der Literatur, sei es in der psychologischen, philosophischen oder theologischen, eine klare Bestimmung dessen zu finden, was Schwermut sei, der wird feststellen, daß das Wort Schwermut nirgendwo als terminus technicus erscheint. Es gibt viele andere Wörter, die, obenhin betrachtet, als Synonyma vorkommen, so Melancholie, Depression (dies in der Psychopathologie und Psychiatrie), so Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung (vor allem in der Philosophie und Theologie). Um so öfter finden wir das Wort Schwermut in der Dichtung. Es scheint zunächst, als sei es damit einer poetischen Unbestimmtheit ausgeliefert und als müsse es, fortgewiesen selbst aus den nicht-exakten Wissenschaften, allezeit heimatlos geistern in dem dunklen und vagen Bereich zwischen Traurigkeit, Depression und Verzweiflung, um keines von allem ganz zu sein und von allem etwas. Aber ich glaube, daß jedem Ding, das existiert, sein ihm eigenes Wort zugehört, und daß jedes Wort nur ein einziges Ding treffend zu bezeichnen vermag, und darum glaube ich, daß es etwas gibt, das Schwermut heißt und unverwechselbar Schwermut ist. Es hat sich allezeit die Methode bewährt, festzustellen, was etwas nicht ist, um auf solchem Umwege zu finden, was es denn sei. Diese Methode hier anzuwenden, erweist sich als schwierig, denn jene Begriffe, von denen der Begriff der Schwermut scharf abgesetzt werden soll, sind selbst nicht exakt. So müssen wir denn zuerst versuchen, auch jene anderen Begriffe so klar wie möglich herauszuschälen. Eine große Hilfe bietet immer die Sprache.
In dem Worte Schwermut meint «Mut» das Gemüt, und Gemüt bezeichnet die Einheit der geistigen und sinnlichen Gefühle.
Schwer-Mut besagt, daß dieses Gemüt schwer ist. Nun kann etwas schwer sein aus sich selbst, eine Eisenkugel etwa, oder von etwas beschwert, was es nicht selbst ist. Das Gemüt kann schwer sein aus sich selbst, das heißt, es kann anlagemäßig schwer sein. In der Tat gibt es eine schwermütige Konstitution. Unter den vier Temperamenten finden wir den «Melancholiker», dessen Blut durch den Gallenstoff verdunkelt, verdickt, beschwert ist. Wir kennen den Typ des Melancholikers: daß Hamlet, Prinz von Dänemark, dick ist und langsam in seinen Bewegungen und schwer von Entschluß, ist ganz und gar richtig. Körperliche Fülle und Schwere ist die somatische Entsprechung zur Schwere des Gemütes. Diese Schwere macht den Schwermütigen leiden. Er ist weich und nicht böse; die gallenbittere Verdrossenheit, das Nörgeln, die giftige Bosheit, die Rebellion sind seine Sache nicht. Er ist von Natur aus Altruist, und er hat Humor. Aber er lebt im Schatten, und das Leben freut ihn nicht. Er wäre gerne tot. Damit ist noch nichts gesagt darüber, woran er leidet. Vorläufig ist nur sein Erscheinungsbild gezeichnet.
Man kann aber auch, ohne konstitutionelle Schwere, von etwas so beschwert sein, daß man schwermütig erscheint. Eine frühe, nicht bewältigte Leid-Erfahrung, eine tiefe seelische Verwundung, eine nicht gestandene Schuld können einen Menschen schwermütig machen, so daß er es sein Leben lang bleibt, obgleich die Natur ihn heiter gedacht hat. Zuletzt scheint kein Unterschied mehr zu sein zwischen einem solchen und einem konstitutionell Schwermütigen. Vorerst sehen wir soviel, daß der konstitutionell Schwermütige schwermütig ist mit Notwendigkeit und ohne daß er die Ursache kennt. Der durch Erfahrung schwermütig Gewordene hat dagegen die Möglichkeit, zu erkennen, warum er schwermütig ist, auch wenn er das Wissen von der Ursache verleugnet, verdrängt hat.