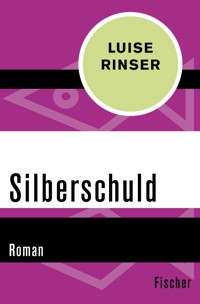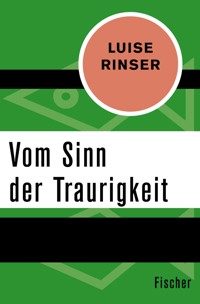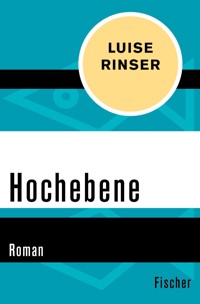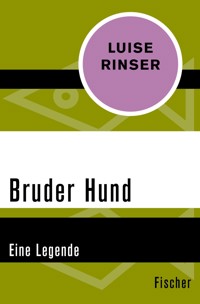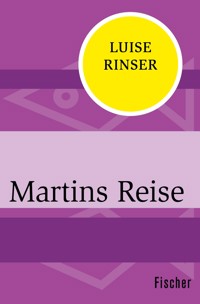
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Martin hat Sommerferien. Doch er weiß mit der Zeit nichts Rechtes anzufangen und verbringt sie damit, die Tiere auf dem elterlichen Bauernhof zu piesacken. Da läuft ihm eines Tages Zottelohr zu, ein Hund, der ihn auf einen Ausflug lockt. Aus einem Spaziergang wird eine mehrtägige Wanderung und schließlich eine lange Reise durch das idyllische Voralpenland, auf der die beiden Reisegenossen wundersame Orte entdecken und rätselhafte Bekanntschaften machen. Zu Beginn jähzornig und selbstsüchtig, wandelt sich Martin mit der Zeit und lernt aus den Folgen seiner bösen Streiche, anderen Lebewesen gegenüber Mitgefühl und Loyalität zu empfinden. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Luise Rinser
Martins Reise
Über dieses Buch
Martin hat Sommerferien. Doch er weiß mit der Zeit nichts Rechtes anzufangen und verbringt sie damit, die Tiere auf dem elterlichen Bauernhof zu piesacken. Da läuft ihm eines Tages Zottelohr zu, ein Hund, der ihn auf einen Ausflug lockt. Aus einem Spaziergang wird eine mehrtägige Wanderung und schließlich eine lange Reise durch das idyllische Voralpenland, auf der die beiden Reisegenossen wundersame Orte entdecken und rätselhafte Bekanntschaften machen. Zu Beginn jähzornig und selbstsüchtig, wandelt sich Martin mit der Zeit und lernt aus den Folgen seiner bösen Streiche, anderen Lebewesen gegenüber Mitgefühl und Loyalität zu empfinden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei FISCHER Digital
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Copyright © by Christoph Rinser
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Montasser Medienagentur, München
Covergestaltung: buxdesign, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-561228-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Der fremde Hund
Der Königsee
Der Salzberg
Das Schloß im See
Der schönste Baum im Wald
Der Rückfall
Die Nacht der Tiere
Gefährliche Fahrt
Die fremde Welt
Die große Stadt am Fluß
Augsburger Pracht
Die Donau
Der Schafdieb
Das Kräutlein Wermut
Schluß
[Bildteil]
Der fremde Hund
Es war einmal ein wunderschöner Tag im Frühling. Die Sonne schien und die Vögel sangen. Der Brunnen vor dem Bauernhof plätscherte. Es war kein großer Bauernhof, aber auch kein ganz kleiner. Er war so, wie alle Bauernhöfe im Berchtesgadnerland sind, wenn sie nicht unten im Tal liegen, sondern hoch an den Berghängen: das Erdgeschoß schneeweiß gekalkt, das Obergeschoß aus Holzbalken gezimmert, die vor Alter grau und braun geworden sind. Das Dach war mit Schindeln gedeckt und auf den Schindeln lagen große Steine, damit der Wind sie nicht fortwehen konnte. Der Wind ging nämlich hier oben oft recht kräftig. Das konnte man an den alten Bäumen sehen, die rings um das Haus standen. Stämme und Äste waren alle nach einer Seite gebogen und zwar nach der Ostseite, denn von Westen her kamen die wilden Winde. Aber an dem Tag, an dem unsere Geschichte beginnt, merkte man nichts davon, wie rauh und kalt es noch ein paar Wochen vorher hier oben gewesen war. Da und dort freilich in den Rinnen und Tälern, in die die Sonne nicht scheinen konnte, lag noch Schnee, und die hohen Berge, die hinter dem Haus aufstiegen, waren noch mit Eis und Schnee bedeckt, und mancher Berg bleibt wohl das ganze Jahr hindurch mit Eis und Schnee bedeckt. Aber auf den Wiesen blühten schon Krokusse, weiß, gelb und lila. Es war so warm, daß die Hühner begannen, sich eine Grube im warmen Sand vor dem Kuhstall zu scharren, um darin zu schlafen.
Die Bäuerin kam aus dem Haus und stand eine Weile auf der Türschwelle, gerade unter dem Türbalken, in dem die Buchstaben eingeschnitzt waren: 1708 M. + A.R. 1708, das war das Jahr, in dem das Haus gebaut worden war. So alt war es schon, mehr als 200 Jahre. Und M. + A.R. das hieß Martin und Anna Ramsauer, und dies waren die Namen der Ur-Ur-Ur-Großeltern des Jungen, nach dem die Bäuerin Ausschau hielt. Der Junge aber war nicht zu sehen.
„Martin“, rief die Frau. „Martin, Martin, Martin“, rief es von allen Seiten. Das war der Widerhall von den Felswänden her. Aber soviel auch die Mutter und der Widerhall riefen, unser Junge kam und kam nicht zum Vorschein. Die Mutter seufzte und blickte sorgenvoll, als sie unverrichteter Dinge wieder ins Haus ging.
Martin war gar nicht so weit weg gewesen, daß er die Rufe der Mutter hätte überhören können. Er hockte im Hühnerstall und wartete, bis das große weiße Huhn, das er eingesperrt hatte, sein Ei gelegt haben würde, denn er trank für sein Leben gerne rohe Eier aus. Aber das Huhn wollte nicht, es lief nur herum und gackerte und wollte wieder hinaus. Martin fing es und drückte es, aber es half nichts, das Ei wollte und wollte nicht kommen. Da packte es Martin und riß ihm seine schönsten Federn aus. „So“, sagte er, „das ist dafür, weil du kein Ei gelegt hast.“ Dann warf er es zum Fenster hinaus und ging aus dem Hühnerstall. Er saß eine Weile rittlings auf dem Zaun und blinzelte mißlaunig in die Sonne. Er hatte Schulferien und wußte nicht, womit er den lieben langen Tag totschlagen sollte. Da kam die schwarze Katze Murr über den Hof, setzte sich in die Sonne, putzte sich und rollte sich zu einem Nachmittagsschläfchen zurecht. „Warte“, dachte der Junge, „du kommst mir gerade recht.“
„Muz, Muz, Muz“, lockte er. Aber die Katze schaute nicht einmal nach ihm hin. „Muz, Muz“, lockte er noch einmal. Die Katze rührte sich nicht. Da sprang der Junge vom Zaun und ging auf sie zu: „Hör mal, Murr, alte Mieze, wollen wir nicht zusammen spielen?“
Die Katze tat, als ob sie schliefe. Sie dachte: „Mit dir spielen? Ich danke schön. Das kenn ich. Es beginnt mit Schöntun und Mieze hin und Murrli her, und es dauert nicht lang, da hast du es satt und beginnst mich zu plagen, und ich soll den Wagen ziehen, oder ich werde in die Holzkiste gesperrt oder in einen Sack gebunden und an den Baum gehängt. Es ist besser, ich lasse mich mit dir nicht ein.“
Freilich wäre es das Klügste gewesen, sich beizeiten fortzumachen. Aber die Sonne schien so warm auf ihren Pelz und sie war viel zu faul, um sich zu rühren, doch sie ließ für alle Fälle das eine Auge einen Spalt weit offen und beobachtete den Jungen. Es schien, als habe er die Katze Murr vergessen, denn er spielte Fußball mit einem leeren alten Blechtopf. Dagegen hatte die Katze nichts einzuwenden, wenngleich das Geklapper sie in ihrer Nachmittagsruhe störte. Bald aber schlief sie wirklich ein. Sie war keine junge Katze mehr und ihre Ohren hatten schon viel von ihrer Schärfe eingebüßt. So kam es, daß sie nicht hörte, wie der Junge auf sie zuschlich. Er trug hinterm Rücken einen leeren Blechtopf, den er an einen Strick gebunden hatte. Die Katze wachte erst auf, als er dicht vor ihr stand, und da war es schon zu spät. Der Junge hatte die Schnur an ihren schönen langen Schwanz gebunden, und als die Katze aufsprang und fortlief, da klapperte der Blechtopf hinter ihr her. Es ist kein Spaß, mit einem Blechtopf am Schwanz herumzulaufen, das dürft ihr glauben. Die Schnur verwickelte sich und blieb da und dort hängen und wenn die Katze dann daran heftig zerrte, schien es ihr jedesmal, als bliebe der ganze Schwanz am Hindernis hängen, und sie miaute kläglich. Außerdem machte der Blechtopf einen entsetzlichen Lärm, und Lärm können Katzen um die Welt nicht ausstehen. Der Junge aber stand da und lachte aus vollem Halse über die verzweifelten Sprünge der armen Katze. Als sie sich endlich in den Stall verkrochen hatte, setzte sich der Junge auf den Brunnentrog. Das war ein ausgehöhlter Baumstamm; in den floß aus einem hölzernen Rohr das klare Wasser, wie es aus den Bergquellen kommt. Der Junge blickte um sich, wen er nun ärgern könnte. Da sah er die braunen, schwarzen und weißen Hühner, die sich in den warmen Sand eingegraben hatten und schliefen. Er hielt die Hand an das Brunnenrohr und lenkte probeweise kleine Wasserstrahlen hierhin und dorthin und endlich einen kräftigen Strahl auf die Hühner. Sie sprangen auf und schüttelten die nassen Federn und zeterten; es war eine fürchterliche Aufregung.
Nun hatte der Junge genug und trollte sich in die Scheune, grub sich ein Nest in das letzte Winterheu und verschlief da den Nachmittag.
Als er erwachte, verspürte er Hunger. Er gähnte so laut, daß die Fledermäuse davon erwachten, die ihren Winterschlaf kopfunter an einem Dachbalken hängend gehalten hatten. Der Junge, der sich vor nichts fürchtete, wollte sie fangen, aber sie flatterten durch die offene Scheunentür hinaus ins Freie. Der Junge lief ihnen nach. Aber als er vor das Haus kam, sah er etwas, worüber er die Fledermäuse und sogar seinen Hunger vergaß. Auf der schmalen steinigen Straße, die den Berg heraufkletterte, kam ein Fuhrwerk daher. Es war von zwei Maultieren gezogen, denn Pferde haben die Bergbauern nicht. Maultiere passen auch viel besser ins Gebirge als Pferde. Sie sind klein und kräftig, sie können klettern und große Lasten tragen und es macht ihnen gar nichts aus, wenn es stürmt und wettert. Sie halten viel mehr aus, als die Pferde, die sich leicht eine Erkältung holen. Überall im Gebirge halten die Bergbauern diese graubraunen geduldigen Tiere. Für unsern Jungen war das nichts Neues. Er kannte die beiden Maultiere recht gut, die da den steilen Weg heraufkamen. Es waren seines Vaters Maultiere und neben dem kleinen Fuhrwerk ging sein Vater. Er kam vom Markt in Berchtesgaden und hatte den Wagen vollgeladen mit Säcken, Körben und Kisten. Die Bergbauern können nicht mal schnell in den nächsten Laden laufen und einkaufen. Sie haben oft ein oder zwei Stunden zu laufen bis ins nächste Dorf, da besorgen sie gleich alles für drei oder vier Wochen auf einmal, was sie brauchen. Auch das war dem Martin nichts Neues. Aber was da hinter dem Wagen dreinlief, das war höchst sonderbar. War das nicht ein Hund? Wem gehörte der wohl? Martin kniff die Augen zusammen und schaute scharf hin. Ja wahrhaftig, es war ein Hund. Er lief hinter dem Vater drein, als wüßte er nichts anderes und als müßte das so sein. Martin wäre gerne dem Vater entgegengerannt, aber da fiel ihm ein, daß er am Morgen dem großen Wollschaf Kopf und Hals kahlgeschoren hatte, wofür er sicher vom Vater Prügel bekommen würde, denn das hatte ihm die Mutter verheißen. Er stand eine Weile und kaute an einem Strohhalm. Aber dann hielt er es nicht mehr aus vor Neugierde. Er lief wie der Wind den Berg hinunter und rief: „Vater, wo bringst du den Hund her? Gehört er uns?“
„Tja“, sagte der Vater, „ich weiß nicht recht. Er ist mir zugelaufen auf dem Weg und wollte nicht mehr fort von mir.“
„Oh, Vater, behalt ihn, schick ihn nicht fort.“
„Er gehört aber sicher jemand. Wir müssen ihn in der Zeitung ausschreiben lassen. Bis der kommt, dem er gehört, mag er hierbleiben.“
„Ja, ja. Und vielleicht kommt der gar nie, dem er gehört, und dann bleibt er für immer hier.“
Martin blickte zu seinem Vater auf. Der aber machte plötzlich ein Gesicht, wie es der Junge gar nicht liebte, und es war zu sehen, daß er etwas Unangenehmes zu hören bekommen würde. Und schon sagte der Vater: „Eigentlich sollte ich den Hund gar nicht mitgebracht haben, denn du wirst ihn nur quälen, wie du es mit allen anderen Tieren machst.“
Martin senkte den Kopf und schielte nach der Stalltür, hinter der das Wollschaf mit dem geschorenen Kopf und Hals war, und die Katze, die noch immer den Blechtopf am Schwanz hatte. Der Vater fuhr fort: „Das sag ich dir: wenn du den Hund quälst, dann sollst du etwas erleben, woran du lange denken wirst.“
Das klang so drohend, daß es unserm Jungen ganz kalt über den Rücken lief.
„Nein, nein“, sagte er kleinlaut, „ich werde ihn nicht quälen.“
„Wir wollen sehen“, antwortete der Vater. Während sie das letzte steile Stück des Wegs hinauffuhren, ging Martin neben dem Hund. Es war ein großer grau und brauner Schäferhund. Man konnte sehen, daß es ein schöner Hund war, wenngleich er ein wenig zerzaust und verwildert war. Sein rechtes Ohr war zerfetzt und hing in Zotteln herab.
„Na du“, sagte der Junge und kraute ihn am Hals, „du hast wohl gerauft, wie? Sieh dir mal dein Ohr an? Ist das ein Ohr, wie es ein ordentlicher Hund hat? Das ist ein Zottelohr. Schämst du dich nicht?“
Der Hund hob den Kopf und schaute den Jungen an, daß es dem ganz unbehaglich zumute wurde. Es schien, als hätte er das Maul ein wenig verzogen, wie wenn er spöttisch lachen wollte; dabei peitschte er mit dem langen buschigen Schwanz die niedrigen Latschensträucher am Weg.
„Ho, ho“, sagte Martin, „du bist ein sonderbarer Hund, du lachst ja. Lachst du mich aus?“ Aber der Hund machte schon wieder ein Gesicht wie alle Hunde, und es war nichts Unheimliches mehr an ihm. Er ließ sich streicheln und zausen und trottete brav neben dem Fuhrwerk her. Als sie alle zusammen über den Berg heraufgekommen waren und in den Hof einfuhren, machte sich unser Junge aus dem Staub. Er dachte nämlich daran, daß die Mutter nun dem Vater die Sache mit dem geschorenen Schaf erzählen würde und daß es Prügel gäbe. Da wollte er vorerst lieber nicht dabei sein. Er drückte sich um die Hausecke und vertrollte sich in den Garten. Es war ihm plötzlich eingefallen, daß er dort in einem Haselbusch eine Vogelschlinge gelegt hatte. „Ich will einmal sehen, ob sich ein Vogel gefangen hat“, dachte Martin. Richtig: ein kleiner Bergfink war ins Garn gegangen. Die Schlinge hatte sich um sein Füßchen gelegt und hielt ihn fest. Der kleine Vogel war schon halbtot vor Angst. Da geschah etwas, was Martin nicht gleich begriff, so schnell ging es vor sich: der große Hund war plötzlich da, lief auf die Vogelschlinge zu und, schnapp, hatte er die Schnur zerbissen, und der kleine Vogel flatterte auf und davon. Der Hund blieb neben der Schlinge stehen, wedelte mit dem Schwanz und schaute, als ob er von nichts wüßte. Das war unserm Jungen zuviel. Er wurde rot vor Zorn im Gesicht, riß eine Gerte vom Haselstrauch und ließ sie auf den Hund niedersausen, daß sie nur so pfiff. Der Hund rührte sich nicht. Es war, als ob er es gar nicht spüren würde. Das brachte unsern Jungen noch mehr in Wut. Er nahm große Steine und warf sie nach dem Hund. Aber es war sonderbar: kein einziger Stein traf, alle flogen sie an ihm vorbei. Als Martin endlich ganz erschöpft war vor Zorn, mußte er sehen, daß der Hund lachte. Es war kein Zweifel, er lachte unsern Jungen aus.
„Du hergelaufenes Vieh, du zottliges! Du Hungerleider, du Streuner, du Bettelhund!“ schrie Martin, „sieh zu, daß du dich fortscherst von hier!“ Das ließ sich der Hund nicht zweimal sagen. Er machte kehrt und lief durch den Garten, lief durch den Hausanger, sprang über den Zaun und verschwand. Als Martin ihn nicht mehr sehen konnte, reute es ihn, daß er den Hund fortgejagt hatte. Schon so lange hatte er sich einen Hund gewünscht und nun war endlich einer auf den Hof gekommen und er hatte ihn gleich wieder vertrieben. Da hörte er ihn bellen. Das Bellen klang laut und deutlich zu unserm Jungen herauf. Er mußte gar nicht weit weg sein. Als er näher zum Zaun ging, sah er gar nicht weit weg den Hund stehen. Er hatte die Vorderpfoten auf einen der Felsblöcke gelegt, wie sie da überall herumlagen, wedelte mit dem langen Schwanz und sah ganz so aus, als wollte er sagen: „Komm her, ich warte auf dich.“ Martin kam langsam näher und wußte nicht recht, was er von der Geschichte halten sollte. Als er endlich so nah herangekommen war, daß er den Hund beinahe am Halsband fassen konnte, machte der einen Satz und rannte davon. Aber er lief nicht weit. Mitten auf der Wiese blieb er stehen, schaute schweifwedelnd um und schien zu warten. Martin ärgerte sich, daß er nicht rasch zugefaßt hatte. „Warte“, dachte er, „wenn ich dich erwische, halte ich dich fest und hänge dich zuhause an die Kette. Dann lauf weg, wenn du kannst.“ Er lief über die Wiese und stand so dicht neben dem Hund, daß er schon sein Halsband berührte. Aber ehe er fest zupacken konnte, tat der Hund einen Sprung rückwärts und rannte weiter. Am Waldrand unter den kahlen Ahornbäumen blieb er stehen, wedelte und wartete. Unser Junge stand sprachlos. Dann versuchte er es im Guten.
„Komm Zottelohr“, rief er, „ich gebe dir eine Schüssel Milch mit Brotbrocken. Komm, komm schön her.“ Aber der Hund kam nicht, soviel er auch lockte. Da blieb dem Martin nichts anderes übrig, als ihm von neuem nachzulaufen. Diesmal kam er dem Hund so nahe, daß er ihn am Halsband fassen konnte. „Na also“, sagte er, „da hab ich dich ja.“ Doch kaum hatte er das gesagt, hatte der Hund sich losgerissen und war schon im Wald verschwunden. Wenn unser Junge klug gewesen wäre, dann hätte er vorher schon merken müssen, daß der Hund ihn zum Narren hielt und daß es das Beste wäre, ihn laufen zu lassen und heimzukehren.
Aber nun war etwas in ihn gefahren, er wußte nicht, was es war; er merkte nur, daß er nicht mehr umkehren konnte. Ob er wollte oder nicht, er mußte und mußte dem Hund nachlaufen. Schon sah er sein Vaterhaus ganz klein oben auf dem Berghang liegen, so weit war er gelaufen. Und nun mußte er noch weiter und immer weiter. Er kam in den Wald aus Ahorn, Fichten und Buchen, der den ganzen Berg bedeckte, bis hinunter ins Tal. Immer klang das Gebell des Hundes zu ihm herauf. Zuweilen sah er ihn zwischen den Bäumen auftauchen und wieder verschwinden. Die Jagd wurde immer wilder und autregender. Die welken braunen Blätter vom vorigen Jahr raschelten und stoben, wo die beiden liefen. Als sie endlich den Wald durchquert hatten, blieb Martin überrascht stehen. Er fand sich am Rand einer steilen, nackten Felswand und als er sich darüber beugte, sah er senkrecht unter sich das dunkelgrüne Wasser eines Sees. Als er aufblickte, sah er, daß dieser See rings von hohen steilen Felsbergen eingefaßt war. Da erkannte er, daß er bis an den Königsee gekommen war. Er war schon oft an diesem See gewesen, aber noch nie war das Wasser so unheimlich dunkel gewesen, die Berge noch nie so furchtbar hoch und die Wälder, die in den Felsenrinnen hinaufkletterten, noch nie so schwarz wie an diesem Tag. Die Sonne war untergegangen und es wurde rasch Abend. Ein kalter Wind wehte von den Schneebergen herunter, und vom Wasser stieg der feuchte Nebel wieder auf. Es sah alles rings umher so drohend aus, daß es unserm Jungen bang ums Herz wurde. Er kam sich ganz verlassen vor in dieser Einöde. „Ich will schnell nach Hause gehen“, sagte er sich, „der fremde Hund mag meinetwegen fortlaufen, wohin er will.“ Er begann rasch fortzugehen in der Richtung, in der sein Elternhaus liegen mußte. Aber es war wie verhext an diesem Abend: wenn er hundert Schritte gegangen war und ganz sicher meinte, den Berg hinaufgestiegen zu sein, so stand er auf einmal wieder am See und jedesmal war das Wasser noch dunkler geworden, bis es zuletzt schwarz wie Tinte war. Inzwischen war es auch schon später Abend geworden. Unser Junge fror und hungerte, und obwohl er schon zehn Jahre alt und sonst recht frech und waghalsig war, so hatte er nun ganz einfach Angst. Am liebsten hätte er sich hingesetzt und losgeheult.
Da stuppste ihn auf einmal etwas Weiches und Warmes an der Hand. Er erschrak, aber es war bloß der Hund, der ihn mit seiner Schnauze gestoßen hatte.
„Was willst du denn?“ fragte unser Junge ärgerlich.
Da begann der Hund ganz langsam gegen den Wald hin zu gehen. Dabei bellte er leise, als wollte er sagen: „Hier bin ich, komm, folge mir.“ Das Bellen klang so ganz anders als am Nachmittag, gar nicht mehr spöttisch und mutwillig, und unser Junge dachte: „Vielleicht weiß er den Weg nach Hause und will mich führen. Im übrigen ist das ganz in Ordnung: er ist schuld, daß ich von daheim fortgelaufen bin, er soll mich auch wieder zurückbringen.“ Unser Junge folgte dem Hund durch den stockfinstern Wald. Er stolperte im Dunkeln über dicke Baumwurzeln, stieß mit der Nase an Bäume und moosige Felsstücke und riß sich Arme und Beine blutig an den Dornen. Der Weg wollte und wollte kein Ende nehmen. Es war so finster, daß unser Junge seine eigene Hand nicht mehr vor den Augen sah. Sein Magen knurrte laut vor Hunger. Als er schon dachte, er käme in alle Ewigkeit nicht mehr aus diesem schwarzen Wald heraus, stand er plötzlich vor einem Haus. Aber es war nicht sein Vaterhaus. Es war ein kleines fremdes Haus. Der Hund bellte und kratzte an der Tür.
„Aha“, dachte unser Junge, „hierhin also gehört der Hund. Da werde ich wohl einen Lohn dafür bekommen, daß ich ihn wieder zurückgebracht habe.“
Da ging die Tür auf und eine alte Frau mit einem Kerzenlicht kam heraus. Sie leuchtete den Platz vor dem Haus ab und entdeckte unsern Jungen und den großen Hund. Es war eine uralte Frau. Martin hatte in seinem Leben keine so alte Frau gesehen. Sie war ganz verrunzelt wie ein Winterapfel und ihre Haare waren grau wie alte Spinnweben. Aber sie sah nicht böse aus, nur streng.
„Was wollt denn ihr mitten in der Nacht?“ fragte sie mit einer ganz dünnen zittrigen Stimme.
„Ich bringe dir deinen Hund zurück. Er ist uns zugelaufen. Wir haben ihn gefüttert und nun bin ich eigens den weiten Weg hergelaufen im Finstern, um ihn dir wieder zu bringen.“ So sagte Martin.
„So, so“, antwortete die alte Frau, „du bist ja recht flink mit deiner Zunge. Das wirst du nicht wissen, daß den Kindern, die lügen, ein Entenschnabel wächst?“
Unser Junge griff sich erschrocken an den Mund, aber da war noch nichts von einem Entenschnabel zu merken. Aber es war doch recht unheimlich, daß die fremde alte Frau wußte, daß er gelogen hatte. Ganz kleinlaut sagte er: „Ich möchte heim.“
„So, so“, antwortete die alte Frau wieder, „du möchtest heim. Du bist der Martin Ramsauer, nicht wahr?“
„Ja“, sagte er und begann vor lauter Aufregung am Daumen zu kauen. Woher konnte die alte Frau ihn kennen? Er hatte sie nie vorher gesehen. „Nun“, dachte er, „es gibt ja viele Weiber, die überall ihre Nase hineinstecken und die einen kennen. Wenn sie mir nur etwas zu essen gäbe!“
Als hätte sie seinen Gedanken erraten, sagte sie: „Kommt herein, du und dein Hund.“
„Er ist nicht mein Hund“, antwortete Martin zornig, „dieser Zottelohr ist mir nur zugelaufen und hat mich durch Nacht und Nebel von daheim fortgelockt.“
Er folgte der alten Frau ins Haus. Gleich hinter sich schlug er die Türe zu. „Der Hund braucht nicht hereinzukommen. Der kann draußen schlafen“, dachte er sich.
In der Kammer, in die er geführt wurde, stand ein Tisch und auf dem Tisch ein Teller und auf dem Boden auch ein Teller. Aber die beiden Teller waren leer. Unser Junge dachte: „Wo ein Teller ist, da wird auch bald das Essen dazu kommen“, und er setzte sich an den Tisch. Sein Magen knurrte so laut, daß er zuerst glaubte, es sei der Hund, der so knurrte. Die alte Frau war aus der Kammer gegangen. Man hörte sie eine Weile mit Kochtöpfen hantieren, dann war es ganz still im Haus. Es verging eine lange Zeit. Unser Junge schaute in der Kammer herum, ob nichts Eßbares zu finden wäre. Aber da war nichts und in seinen Hosentaschen war auch nichts, kein Brotkrümelchen, keine alte Nuß, kein Sonnenblumenkern, rein gar nichts. Als er es vor Hunger nicht mehr aushielt, ging er in die Küche. Da saß die alte Frau am Tisch und vor ihr stand eine große Pfanne Grießmus, auf dem die geschmolzene Butter kleine braune Teiche und Kanäle bildete. Es roch so gut, daß unserm Jungen das Wasser im Mund zusammenlief. Er schaute erwartungsvoll darauf hin, aber die alte Frau tat gar nicht dergleichen, als wollte sie ihm etwas davon abgeben. Sie schob Löffel um Löffel voll in ihren Mund und sah nicht nach ihm hin. Als er es nicht mehr aushielt, sagte er ungeduldig: „Du sitzt da und läßt es dir wohlsein, und ich bin halb verhungert.“ Da schaute ihn die alte Frau an und sagte: „Ihr seid ja noch nicht alle da. Dein Hund ist noch vor der Tür.“
„Ach der“, rief unser Junge zornig, „der soll draußen bleiben, der ist an allem schuld.“ Die alte Frau gab keine Antwort darauf. Sie aß ruhig weiter. Da ging er ganz nahe an den Tisch heran und sah, wie das Grießmus in der Pfanne immer weniger und weniger wurde.
„Gib mir etwas davon“, sagte er.
Da schaute sie ihn wieder wie vorhin an und sagte: „Dein Hund ist noch vor der Türe.“
„Laß mich mit dem Hund in Frieden“, rief er, „was geht mich der fremde Hund an.“
Da sagte sie nichts mehr und aß weiter.
Unser Junge mußte zuschauen, wie das Grießmus allmählich zu Ende ging, bis schon der Pfannenboden zu sehen war.
„Willst du das wirklich allein aufessen und mich verhungern lassen?“ fragte er zornig.
„Dein Hund ist noch vor der Tür“, sagte die alte Frau zum drittenmal. Da begriff unser Junge, daß er keinen Löffel voll bekommen würde, ehe er nicht den Hund hereingeholt hätte. Er lief wütend zur Tür. Kaum hatte er sie geöffnet, kam auch schon der Hund herein. Unser Junge versetzte ihm einen Tritt mit dem Fuß und murmelte: „Wegen dir bin ich jetzt fast verhungert, du hergelaufener Zigeuner. Warte, das wirst du mir noch büßen müssen.“
Der Hund lief gleich in die Kammer und setzte sich vor den leeren Teller, der auf dem Boden stand. In dem Teller auf dem Tisch war nun wirklich Grießmus, aber so wenig, daß unser Junge dachte: „Soviel frißt bei uns daheim die Katze. Voller Heißhunger stürzte er sich darüber und auf eins, zwei, drei war der Teller leer. Da bemerkte er, daß der Hund neben ihm saß und ihn ansah.
„Was“, rief unser Junge, „du willst auch etwas? Von dem bißchen hätte ich dir auch noch was abgeben sollen? Hier hast du was, hier und hier.“ Und er schlug ihm mit dem Löffel auf die Schnauze. Der Hund klopfte dreimal mit dem Schwanz auf den Boden, dann stand er auf und ging aus der Kammer. Unser Junge dachte: „Nun werde ich wohl die zweite Portion bekommen.“ Er blickte erwartungsvoll nach der Tür. Aber die alte Frau ließ sich nicht sehen. Er stand auf und ging in die Küche. Da saß der Hund vor einer großen Schüssel Milch, in der eine Menge Schwarzbrotbrocken schwammen. Man konnte sehen, wie gut ihm die Milchsuppe schmeckte. Milchsuppe aß unser Junge für sein Leben gern, fast so gern wie Grießmus. Er schaute eine Weile zu der alten Frau hin, die den Rest Grießmus aus der Pfanne kratzte, dann sagte er: „Glaubst du im Ernst, daß ich von dem bißchen Essen schon satt bin?“
„Nein“, antwortete die alte Frau, „das glaube ich nicht.“
„Warum gibst du mir nicht mehr, wenn du selber weißt, daß ich davon nicht satt werden kann?“ fragte er.
Die alte Frau hatte inzwischen die Pfanne so sauber ausgegessen, daß auch nicht ein Bröselchen mehr übriggeblieben war. Sie stellte sie weg und fragte: „Kann man an einem leeren Teller satt werden?“ Er verstand nicht, was sie meinte.
Sie fuhr fort: „Hungrig sein ist nicht angenehm, nicht wahr?“ Er dachte: „Nun sieht sie es selbst ein, daß sie mir noch etwas geben muß.“
„Nein“, rief er, „das ist nicht angenehm.“
Aber sie fuhr fort: „Auch Tiere haben Hunger.“
Da verstand er, was sie sagen wollte, und er dachte daran, daß er dem Hund nichts von seinem Grießmus gegeben hatte. Ärgerlich sagte er: „Das, was du mir gegeben hast, hat nicht einmal mich allein satt gemacht. Wie hätte ich auch noch davon den Hund füttern können?!“
Da nahm ihn die alte Frau bei der Hand und führte ihn vor die Haustür. Da war gerade der Mond über die Berge gestiegen und es war taghell. Eis und Schnee glitzerten wie lauter Silber auf den hohen Bergen und der See im Tal unten glänzte wie Silber, und die Felsen ringsum schimmerten. Unserm Jungen schien es, als habe er nie zuvor eine so schöne helle Nacht gesehen. „Nun werde ich gewiß den Weg nach Hause finden“, dachte er und blickte rings um sich. Aber da war kein Weg zu sehen und nirgends tauchte sein Vaterhaus auf. Es wurde ihm recht elend zumute, als er merkte, daß er nicht nach Hause finden würde. „Wenn ich immer am Seeufer entlang gehe, dann muß ich doch einmal an unsern Ahornwald kommen“, dachte er. Da fing die alte Frau an zu reden. Sie zeigte auf einen hohen Berg am andern Ufer des Sees und sagte: „Weißt du, wie der Berg heißt?“
Das wußte unser Junge freilich: „Das ist der Watzmann!“ sagte er.
„Siehst du den großen Gipfel und den, der etwas kleiner ist, und dazwischen die sieben kleinen Gipfelchen?“ fragte die alte Frau weiter.
„Ja natürlich sehe ich das alles“, sagte unser Junge ungeduldig.
„Weißt du auch, daß der hohe Gipfel einmal ein König war, und der etwas kleinere seine Frau und die sieben kleinen Gipfelchen seine sieben Kinder?“
Unser Junge schaute sie ungläubig an.
„Ja“, sagte sie, „das ist eine seltsame Geschichte. Ich will sie dir erzählen:
„Es war einmal …“
„Ach“, rief unser Junge. „Du fängst mit «Es war einmal» an. So fangen die Märchen an und die sind alle nicht wahr. Also ist deine Geschichte vom König Watzmann auch nicht wahr. Da will ich sie lieber gar nicht hören.“
Die alte Frau ließ ihn ruhig ausreden, dann sagte sie: „Ob du sie glaubst, ist deine Sache. Hör erst einmal zu. Und sie begann von vorne: „Es war einmal ein mächtiger König, der hieß König Watzmann …“
Da begann unser Junge laut zu lachen: „Watzmann!“ rief er, „das ist doch kein Name für einen König. Unsere bayrischen Könige hießen Maximilian und Ludwig und der Prinzregent hieß Luitpold. Aber Watzmann, so hat noch nie ein König geheißen.“
„Mein lieber Junge“, sagte die alte Frau, „das war vor so langer Zeit, daß weder du noch dein Vater noch dein Großvater, noch dein Urgroßvater gelebt haben. Vor so langer Zeit war alles anders als es heute ist, und so darf es dich nicht wundern, wenn auch die Leute andere Namen hatten, als wir es gewohnt sind.“
Und sie fuhr fort, ihm die Geschichte zu erzählen: „König Watzmann herrschte über das ganze Berchtesgadner Land.“
„Da war er gewiß ein mächtiger König, mit dem bißchen Land, in dem es noch dazu nur lauter Wälder und Felsen gibt!“ lachte unser Junge.
Die alte Frau erwiderte: „Weißt du nicht, welcher Reichtum in diesen Wäldern und Felsen steckt?“
„Nein“, antwortete er, „wenn mein Vater mit dem Pflug durch unsere paar Äcker fährt, dann flucht er, weil überall nur Steine in der Erde sind. Die Wälder und Felsen nehmen den Platz weg, den wir für Kornäcker brauchen würden. Und oft fällt es den Steinen ein, von den Bergen herunterzurutschen, dann gibt es Steinschlag. Beim letzten großen Steinschlag sind uns zwei Lämmer erschlagen worden.“
„Du siehst nur das Böse und nicht das Gute“, sagte die alte Frau. „Habt ihr nicht schon Bäume gefällt in den Wäldern? Habt ihr nicht die Stämme für gutes Geld verkauft?“
„Ja, das ist wahr,“ antwortete er, „mit den Wäldern, da magst du recht haben. Und Wälder gibt es hier ja genug. Aber daß auch in den Felsen Reichtum steckt, das wirst du mir doch nicht weismachen wollen.“
„Ich will dir draufhelfen“, sagte die alte Frau; „warst du schon einmal in Berchtesgaden?“
„Ja“, antwortete er.
„Warst du dort auch schon im Salzbergwerk?“
„Nein, da war ich noch nicht. Aber der Vater hat mir schon davon erzählt. Da muß man auf kleinen Wägelchen, die «Hunde» heißen, hineinfahren in den Berg, da brennen überall Grubenlampen, weil es sonst ganz finster wäre im Berginnern und dann rutscht man auf einer langen, langen Rutsche aus Balken von Holz tief hinunter und plötzlich steht man vor einem kleinen See, mitten im Berg. Das ist der Salzsee und sein Wasser schmeckt ganz salzig.“
„Ja“, sagte die alte Frau, „das weißt du also. Und weißt du auch, woher es kommt, daß der See salzig ist?“
„Ja“, antwortete er, „das weiß ich. Das kommt daher, daß Salz in dem Wasser ist.“
„Und woher kommt das Salz, und wie kommt es ins Wasser?“ fragte die alte Frau weiter.
Das wußte unser Junge nicht. Da erzählte sie ihm, daß der ganze Berg aus Salz bestehe. Er dürfe sich freilich nicht vorstellen, das sei reines weißes Salz, wie es die Mutter zum Kochen nähme. Es ist noch mit Sand und Steinen vermischt. Aber man kann es herauslösen und dann hat man das Salz so, wie man es braucht. Ob er nicht glaube, daß in einem solchen Salzberg Reichtum stecke?“
„Ja“, sagte unser Junge, „das mag schon sein, aber nicht alle Berge sind Salzberge.“
„Nein“, erwiderte die Frau, „da hast du recht. Aber dafür gibt es in anderen Bergen wieder andere Schätze. Hast du schon einmal vom Untersberg gehört?“
„Ja“, das hatte er.
„Im Untersberg“, fuhr die alte Frau fort, „gibt es ganz besondere Steine. Sie sind rötlich und weiß, und wenn man sie zu großen Platten haut und dann abschleift, so glänzen sie, und man nennt sie Marmorsteine. Sie sind so schön, daß man sie in ganz Deutschland kauft. Man macht auch Treppen und Säulen für Schlösser daraus, steinerne Figuren und Blumenschalen. Begreifst du nun, daß in den Bergen Reichtum steckt? Und früher zur Zeit König Watzmanns, da gab es noch viel mehr Schätze in den Bergen. Da fand man Goldsand und Silberadern und manchmal auch Edelsteine. Wirst du nun glauben, wenn ich dir sage, daß König Watzmann ein reicher König war, wenngleich sein Land klein war und nur aus Wäldern und Steinen bestand?“
„Ja“, antwortete unser Junge, „ich will es dir glauben. Aber was war denn nun mit diesem reichen König Watzmann?“
„Wenn du mich nicht immer unterbrochen hättest, wüßtest du es längst“, sagte die alte Frau, ehe sie fortfuhr, ihre Geschichte zu erzählen:
„Er war nicht nur ein reicher König, er war leider ein sehr grausamer, hartherziger König. Ich muß dir aber zuerst sagen, daß in den Bergwäldern noch ein weiterer Reichtum steckt. Ich meine die vielen Hirsche, Rehe und Gemsen, die es hier gibt. Und früher zur Zeit König Watzmanns gab es deren noch unvergleichlich viel mehr. König Watzmann war ein großer Jäger. Jeden Morgen, wenn es begann, Tag zu werden, versammelte er in seinem Schloßhof alle seine Jäger, seine Pferde und seine Hunde. Diese Hunde waren im ganzen Land bekannt. Sie wurden den ganzen Tag und die ganze Nacht eingesperrt. Wenn sie dann am frühen Morgen ausgelassen wurden, waren sie so wild, daß sie sich auf die Knechte stürzten. Die Knechte mußten Handschuhe tragen, die aus dickem Leder waren und bis zum Ellbogen reichten. Aber manchmal geschah es trotzdem, daß einer der Hunde einen Knecht blutig biß. Das machte dem König Watzmann nur Freude. „Seht, wie scharf die Zähne meiner Hunde sind“, rief er und schlug sich vor Vergnügen und Zufriedenheit auf die Schenkel. Du darfst nicht denken, daß die Königin und die sieben Kinder besser waren. Sie standen dabei und klatschten in die Hände und hatten ihren Spaß daran. Und dann ritten sie alle zusammen hinaus aus dem Schloßhof. Ich kann dir sagen, das war eine wilde Herde. Das Gebell und Geheul und Geschrei hörte man rings um den ganzen See. Wenn die Leute, die am See wohnten und auf den Almen, den Jagdlärm hörten, riefen sie die Kinder ins Haus und trieben die Kühe in den Stall und riegelten die Türen zu. Und die, die in den Wäldern waren und auf den Äckern, die versteckten sich in Felshöhlen und Erdlöchern und die, die weder ein Haus fanden noch eine Höhle sich zu verbergen, die bekreuzten sich und wußten, daß ihre letzte Stunde gekommen war, denn König Watzmann und sein Gefolge jagten über die Äcker und zerstampften das Getreide und sie nahmen ihren Weg mitten durch die Viehherden, die auf den Weiden waren und ritten die Kälber und Schafe nieder, und wenn irgendwo Kinder auf der Wiese spielten oder Bauern auf dem Feldern arbeiteten, da ritten sie auch diese nieder.“
Als die alte Frau so weit erzählt hatte, da konnte unser Junge nicht mehr an sich halten und rief: „Aber warum haben die Leute sich das denn gefallen lassen? Warum haben sie ihn denn nicht angezeigt?“
„Wo hätten sie ihn denn anzeigen sollen?“ fragte die alte Frau.
„Nun, bei der Polizei doch“, sagte er.
„Es gab damals keine Polizei“, antwortete sie. „Mein lieber Junge, ich habe dir doch erzählt, daß die Geschichte in uralten Zeiten spielt. Damals war der König der Höchste in seinem Land, und er hatte alles Recht, und er konnte tun was er wollte, und einen Höheren als ihn gab es nicht.“
„Auch keinen Kaiser?“ fragte er.
„Nein, auch keinen Kaiser. Und so konnten die Leute nirgendwo hingehen, um sich zu beschweren. Aber hör nur gut zu, wie die Geschichte weiter geht.
„Eines Tages ritt König Watzmann mit seiner Frau, seinen sieben Kindern und dem ganzen Gefolge wieder auf die Jagd. Es war gar nicht Jagdzeit. Es war Mai, und die Rehgeißen hatten Junge, und die Jungen waren noch so klein, daß sie jämmerlich verhungern mußten, wenn ihnen die Mutter weggeschossen wurde. Aber das war dem wilden Jäger gleichgültig. So ritt er mit den Seinen durch die Wälder und über die junge Kornsaat und kam endlich zu einer Alm. Da saß auf einer Bank in der Nähe vom Haus eine alte Frau, die hielt ein kleines Kind auf dem Schoß. Das Kind war am Einschlafen, und die Frau sang ihm ein Schlaflied. „Weg da, fort, aus dem Weg“, schrien die Jagdknechte. Aber die alte Frau war taub und so hörte sie das Geschrei nicht. Da ritt der König Watzmann allen voran auf die Alte zu und stieß sie und das kleine Kind nieder, und die nach ihm kamen, zerstampften das Kind. Und wie auf den Lärm hin Vater und Mutter herbeieilten, da ritt die wilde Horde auch über sie hinweg, daß sie zertreten am Boden lagen.“
Die alte Frau machte eine kleine Pause im Erzählen, aber unser Junge rief ungeduldig: „Und dann? Was war dann?“