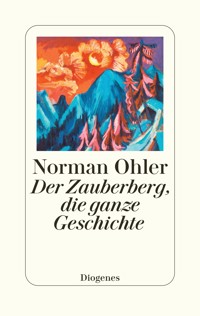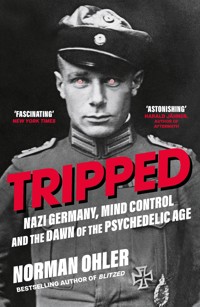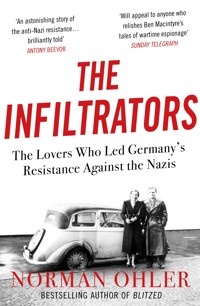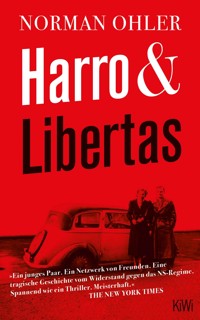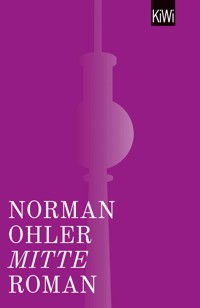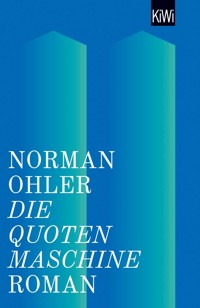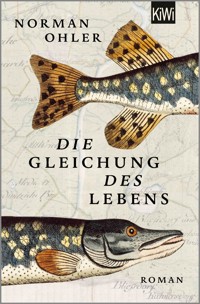19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
LSD: Wie alles begann und was in der Gegenwart daraus wurde Wie Norman Ohler in seinem internationalen Bestseller »Der totale Rausch« am Beispiel der NS-Zeit gezeigt hat, spielen Drogen und Drogenpolitik eine dramatische, immer noch unterschätzte Rolle in der Geschichte der Menschheit. In seinem neuen Buch nimmt der Autor diesen Faden wieder auf und untersucht, wie Entwicklung, Produktion und Verbreitung psychedelischer Substanzen Politik und Gesellschaft von der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart geprägt haben. Bei seinen ebenso abenteuerlichen wie gründlichen Recherchen in Archiven in Europa und den USA differenziert Norman Ohler zwischen drei Dimensionen beim Blick auf Drogen: ihre Funktion als Rauschmittel, als Werkzeug der Bewusstseinskontrolle sowie als Heilmittel. Am Beispiel der Entdeckung des LSDs und dem aus mexikanischen Pilzen gewonnenen Psilocybin bringt Norman Ohler Licht in das Zusammenspiel aus wissenschaftlicher Forschung, staatlichen Behörden und hedonistischer Drogenkultur. Und er zeigt überzeugend, wie eine undifferenzierte Prohibitionspolitik Fortschritte im Kampf gegen Zivilisationskrankheiten wie Depression oder Alzheimer verhindert. Es treten auf: Albert Hofmann und die Basler Firmen Sandoz und Novartis, Harry J. Anslinger und sein Federal Bureau of Narcotics, Richard Nixon und Elvis Presley, Aldous Huxley und John Lennon, sowie die Eltern des Autoren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Norman Ohler
Der stärkste Stoff
Psychedelische Drogen: Waffe, Rauschmittel, Medikament
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Norman Ohler
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Norman Ohler
Norman Ohler, 1970 geboren, ist der Autor von vier von der Presse gefeierten Romanen und zwei Sachbüchern. Sein erster Roman »Die Quotenmaschine« erschien 1995 zunächst als Hypertext im Netz und gilt als weltweit erster Internet-Roman. »Mitte« (2001) und »Stadt des Goldes« (2002) komplettieren seine Metropolentriologie. 2015 erschien »Der totale Rausch« über die kaum aufgearbeitete Rolle von Drogen im Dritten Reich. Es wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt und stand auf der Bestsellerliste der New York Times. Paramount hat eine Option auf die Filmrechte erworben. 2017 erschien Ohlers historischer Kriminalroman »Die Gleichung des Lebens«, der mit lebendigem Zeitkolorit das 18. Jahrhundert wiederauferstehen lässt.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
LSD: Wie alles begann und was in der Gegenwart daraus wurde
Wie Norman Ohler in seinem internationalen Bestseller »Der totale Rausch« am Beispiel der NS-Zeit gezeigt hat, spielen Drogen und Drogenpolitik eine dramatische, immer noch unterschätzte Rolle in der Geschichte der Menschheit. In seinem neuen Buch nimmt der Autor diesen Faden wieder auf und untersucht, wie Entwicklung, Produktion und Verbreitung psychedelischer Substanzen Politik und Gesellschaft von der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart geprägt haben.
Bei seinen ebenso abenteuerlichen wie gründlichen Recherchen in Archiven in Europa und den USA differenziert Norman Ohler zwischen drei Dimensionen beim Blick auf Drogen: ihre Funktion als Rauschmittel, als Werkzeug der Bewusstseinskontrolle sowie als Heilmittel.
Am Beispiel der Entdeckung des LSDs und dem aus mexikanischen Pilzen gewonnenen Psilocybin bringt Norman Ohler Licht in das Zusammenspiel aus wissenschaftlicher Forschung, staatlichen Behörden und hedonistischer Drogenkultur. Und er zeigt überzeugend, wie eine undifferenzierte Prohibitionspolitik Fortschritte im Kampf gegen Zivilisationskrankheiten wie Depression oder Alzheimer verhindert. Es treten auf: Albert Hofmann und die Basler Firmen Sandoz und Novartis, Harry J. Anslinger und sein Federal Bureau of Narcotics, Richard Nixon und Elvis Presley, Aldous Huxley und John Lennon, sowie die Eltern des Autoren.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2023, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covermotiv: © Douglas Gordon
ISBN978-3-462-30362-9
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Teil I: Medikament
Von der Farbe zur Medizin
Am Zürcher Hauptbahnhof
Ortstermin: Firmenarchiv Novartis
Die Mäuse merken nichts
Löchriger Käse und Mutterkorn
Agrochemie
LSD im Archiv
Die Kunst des Arthur Stoll
Der doppelte Richard
Gehirne waschen
Teil II: Waffe
Alsos
Die verschwundene Schachtel
Berater Kuhn
Schweinekoteletts
LSD in Amerika
Gehirnkriegsführung
CEO und CIA
Der Fall Frank Olson
Mentizid
Operation Midnight Climax
Teil III: Rauschmittel
Großbestellung
LSDJFK
Die Revolte der Versuchskaninchen
The Bear
Elvis bei Nixon
Eine Kiste Wein
Light Vader Hofmann
Epilog: LSD für Mama
Die Pandemie der Demenz
LSD unterm Weihnachtsbaum
Tropfentage
House of Psychedelics
Dank
Anhang
Bibliografie
Zitierte Literatur
Weitere Literatur
Aufsätze und Artikel
Bildnachweise
Für meine Eltern
Teil I:Medikament
Als der Agent des Federal Bureau of Narcotics Arthur J. Giuliani am 8. April 1946 seinen Posten als Narcotics Control Officer im amerikanischen Sektor Berlins antrat, war er 37 Jahre alt, sprach zwar etwas Französisch und Italienisch, beides aufgeschnappt in den Straßen New Yorks, aber kein Wort Deutsch. Die ehemalige Reichshauptstadt lag danieder, die Wunden, die britische und amerikanische Bomben sowie russisches Artilleriefeuer gerissen hatten, waren noch überall präsent. Schutt formte eine chiffrenhafte Skyline, in der die Geister der Vergangenheit spukten, während sich die künftigen Konflikte der Weltpolitik bereits andeuteten und die gebeutelten Bewohner nach dem kostbaren Gut der Normalität suchten. Berlin war ein außer Kontrolle geratener Ort, der kaum regulierbar schien und in dem es den Trümmerfrauen nur allmählich gelang, die Straßen frei zu räumen, wieder passierbar zu machen. Eine zerstörte Metropole, in der Tausende Menschen in Ruinen hausten, fast alle ohne Arbeit, in einem Zustand zwischen Erschöpfung und dem Nervenkitzel, das Leben ganz neu anzufangen.
Die kaputte Wirtschaft schuf ein Paradies für Abzocker und Dealer. Die Versorgung mit dem Nötigsten lief über die Schwarzmärkte, wo man alles erwerben konnte, was nicht niet- und nagelfest war, von der Prothese bis zum Strumpfband. An über drei Dutzend Stellen in Ost wie West gab es diese illegalen Handelsplätze mit ihrer Mixtur aus Argwohn, Verzweiflung und einem Anflug von Goldgräberstimmung: Manifestationen »der vollständigen Verwirrung und des Zynismus, der heute in Berlin regiert«, wie es die Washington Daily News berichtete.[1]
Hershey Bars, Graham Crackers, Oreos, Butterfinger, Mars, Jack Daniel’s: Kriegsgebeutelte Deutsche waren für solche Konsumgüter bereit, ihre Leica herzugeben, eine Niere einzutauschen. Ein Ritterkreuz für ein Snickers! Eine Taschenuhr für einen Schlag Margarine. Frauen donnerten sich auf, nutzten ihren Körper als Auslage. Schräge Vögel liefen auf und ab, zischelten den Passanten etwas zu, Reihen von Uhren an den Handgelenken und eine Vielzahl von Orden am Innenfutter der langen Mäntel, die Hüte keck im Nacken, nach Möglichkeit immer eine Kippe im Mund. Alliierte Soldaten winkten mit Händen voller Geld, das sie nicht nach Hause schicken durften. Ein zeitgenössischer Kriminologe brachte es auf den Punkt: »Das Phänomen des Verbrechens hatte (…) Umfang und Formen angenommen, die in der Geschichte der westlichen Kulturvölker ohne Vorbild sind.«[2] Eine »Entprofessionalisierung der Kriminalität« sei zu verzeichnen: »Jeder in dieser Stadt hat ein Geheimnis. Jeder schwindelt und betrügt, weil er anders nicht überleben kann.« Krumme Dinger gehörten zum Alltag der breiten Masse, die Unterwelt übte eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf die Restbestände der bürgerlichen Gesellschaft aus. Gesetze wurden nicht mehr respektiert, die strenge Hitler-Diktatur war passé, jetzt schien alles erlaubt: »eine Umgebung, in der Schwarzmarktgeschäfte eine normale Form des Gesetzesbruchs darstellen.«[3]Zapzarap, das russische Lehnwort für »jemandem etwas wegnehmen« mit einer schnellen, meist unauffälligen Bewegung, war allgegenwärtig geworden. Die vier Besatzungsmächte USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich hatten alle Hände voll zu tun in diesem Berlin, das jetzt nicht mehr von den Nazis, sondern von Urinstinkten regiert wurde, vom Überlebenswillen. Zu verschiedenen Themen wurden zwischen den Alliierten »Arbeitsgruppen« gebildet, so auch zu der drängenden Frage der Regulierung des außer Kontrolle geratenen Drogenhandels.
Ein Problem stellten die »riesigen Mengen an Narkotika« dar, die aus Vorräten der untergegangenen Wehrmacht abgezwackt oder »aus den Ruinen bombardierter Gebäude herausgenommen« und in Umlauf gebracht worden waren:[4] das Methamphetamin-haltige Pervitin der Firma Temmler, Heroin von Bayer, Kokain der Firma Merck in Darmstadt, das angeblich beste der Welt, Eukodal, das euphorisch machende Opioid, das die Lieblingsdroge Hitlers gewesen war, ebenfalls von Merck. Aufgrund der schwierigen Lebensumstände griffen immer mehr Menschen zu Stoffen, die ihnen halfen, durch den Tag zu kommen oder durch die Nacht. Während bei anderen Verbrechen im ersten Halbjahr 1946 ein Anstieg von 57 Prozent zu verzeichnen war, stiegen die Rauschmitteldelikte um 103 Prozent an. Auf den Schwarzmärkten wurden »enorme Preise für geschmuggelte Drogen« erzielt: »20 Reichsmark pro Morphinspritze, 2400 Reichsmark für 50 Tabletten Kokain, 0,003gr.«[5] Giuliani machten diese hohen Margen Sorgen, weil die »Profite vom Naziuntergrund genutzt werden könnten«.[6]
»Wenn man sich vorstellen würde, im Jahr 1776 ein effizientes Büro im Wilden Westen zu etablieren, dann bekommt man einen ungefähren Eindruck von der Wildnis, in der wir hier agieren«, hatte sein Vorgänger Samuel Breidenbach in seinem letzten Brief nach Washington berichtet und danach das Handtuch geworfen. Doch der Neue ließ sich nicht so leicht aus der Fassung bringen, sondern nahm sich vor, Ordnung zu schaffen, eine neue Drogengesetzgebung auf den Weg zu bringen – und zwar für das gesamte Deutschland. Diese Herausforderung nahm der Narcotics Control Officer in seiner frischen amerikanischen Militäruniform gerne an, zumal ihm das Kriegsministerium einen Lohn zahlte, der ein Viertel über den Bezügen einer zivilen Anstellung lag. Die sich widersprechenden Interessen der verschiedenen Besatzungsmächte, die versuchten, Berlin in diese oder jene Richtung zu ziehen, beeindruckten Giuliani dabei wenig. Immerhin brachte er als Amerikaner Frieden, Wohlstand und Freiheit, was konnte schon falsch daran sein?[7]
Nicht alle nahmen das Tohuwabohu negativ wahr. Der 17 Jahre junge Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger, der nicht in die Schule musste, weil es diese noch nicht wieder gab, beschrieb die zusammengebrochene Welt als eine Lehranstalt: »Auch ohne Schule lässt sich jetzt viel über Politik und Gesellschaft lernen: Man lernt zum Beispiel, dass ein Land ohne richtige Regierung eine sehr angenehme Sache sein kann. Man lernt, dass Unordnung etwas Gutes sein kann. Man lernt auf dem Schwarzmarkt, dass der Kapitalismus findigen Leuten immer eine Chance gibt. Man lernt, dass eine Gesellschaft etwas ist, das sich selbst zu organisieren vermag, ohne zentralen Befehl und Steuerung. Man lernt unter Bedingungen der Knappheit eine Menge über die wahren Bedürfnisse der Leute. Man lernt, dass Menschen wendig sein können und man sich auf ihre feierlichen Überzeugungen am besten nicht verlässt. Mit einem Satz: Es ist trotz der Not eine herrliche Zeit, wenn man jung ist und neugierig – ein kurzer Sommer der Anarchie.«[8]
Auch Arthur Giuliani, der im amerikanischen Hauptquartier Berlin-Zehlendorf sein Büro unterhielt, konnte seine Faszination für die ungewöhnlichen Zustände nicht leugnen: »Es ist schlichtweg unmöglich, sich die Vollständigkeit der Zerstörung Berlins vorzustellen«, schrieb er nach Washington: »Vielleicht kann nach Jahren eine Menge an Informationen aus den Kellern ausgebuddelt werden, wo derzeit alles unter Tonnen von Schutt liegt, der einst die Gebäude darüber gebildet hatte, aber diese Zeit ist noch nicht in Sicht.«[9] Emsig konfiszierte er hier etwas, nahm dort jemanden fest und schickte als Beweis seiner Tätigkeiten Fotos in die Zentrale des FBN, des Federal Bureau of Narcotics. Ein paar Damenschuhe mit hohlem Absatz waren darauf zu sehen, Ansichten von Autotüren, deren Armstützen voller Drogen steckten, ausgehöhlte Kartoffeln. Eine Kakaodose von Hersheys, gefüllt mit Kokain. Ein in Heroinlösung getränkter Damenslip. Ein präpariertes Buch, das außer Lesestoff noch anderes Hirnfutter bot.
Solche kleinen Fahndungserfolge brachten wenig, das Problem war struktureller Art. Nach dem Wegfall der alten NS-Behörden war ein Vakuum entstanden, das die illegalen Händler nutzten. Wie sollte Giuliani dem Abhilfe schaffen? Doch dann kam Hoffnung auf, wenn auch aus unerwarteter Richtung: Per Brief meldete sich ein früherer Gestapo-Bulle mit Namen Werner Mittelhaus: »Es ist schon lange meine Absicht, Ihnen zu schreiben, da ich Ihnen gerne über die Aktivitäten der Reichszentrale zur Bekämpfung von Rauschgiftvergehen während der letzten Kriegsjahre berichten möchte.«[10] Dort war Mittelhaus angestellt gewesen, und er äußerte einen Wunsch: »Ich selbst würde sehr gerne wieder in der Verfolgung von Drogendelikten arbeiten. Ich nehme an, dass Sie ein Interesse an einer solchen Tätigkeit in Deutschland haben, und ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich bei dem gemeinsamen Kampf gegen den Drogenschmuggel behilflich sein könnte.« Sein Angebot schloss er mit den Worten: »Ich war nie Mitglied der SS, nur ein Mitglied der NSDAP, auf Anweisung aus meiner Abteilung. Die Beweise für meine antinazistischen Positionen sind vorhanden. Ich würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören.«
Giuliani stellte das Angebot vor ein ethisches Problem: Wollte er sich von einem früheren Nazi helfen lassen, von dessen Expertise profitieren, sich anhören, wie die Straßen Berlins zu regulieren seien? Es war ein Dilemma, in dem auch andere westliche Alliierte steckten, während die Russen in dieser Hinsicht keine Kompromisse machten. Sein Boss Harry J. Anslinger, mit dem Giuliani das Ansinnen besprach, hatte keine Skrupel und gab aus Washington grünes Licht: »Sie können diesen Mittelhaus gerne einmal unter die Lupe nehmen, ob er möglicherweise gut ist für unsere Organisation.«[11]
Tatsächlich bewunderte der Leiter des Federal Bureau of Narcotics den untergegangenen NS-Staat für seine strikte Prohibitionspolitik: »Die Situation in Deutschland (…) war absolut zufriedenstellend.«[12] Im Vergleich zur chaotischen Weimarer Republik hätten die Nazis für Ordnung gesorgt: »1939 beispielsweise und verglichen mit 1924 betrug der Rückgang bei Morphium 25 Prozent, bei Kokain 10 Prozent«, hatte Anslinger notiert. Aufgrund der »sorgfältigen Überwachung (sei) Schmuggel praktisch unmöglich gewesen«, denn »die Strafverfolgung von Rauschgift in der Vorkriegszeit in Deutschland war sehr effizient«.[13] Bereits im November 1945 hatte er die alten Nazidrogengesetze als Modell für Amerika gelobt: Diese seien »strenger« und hätten eine »bessere verfassungsrechtliche Grundlage als unsere eigenen«, weshalb er beschloss, die angewandten Kontrollmechanismen in Deutschland während des Krieges und in den von Deutschen besetzten Ländern und Territorien zu studieren.[14] Sein Ziel: »Die alte und erfolgreiche deutsche Gesetzgebung (solle) so schnell als möglich wieder in Kraft treten und mit der gleichen Strenge angewandt werden wie in der Vergangenheit.«[15] Die Nazis hatten mit Drogennutzern kurzen Prozess gemacht und sie in die KZs verfrachtet – für Anslinger eine begrüßenswerte Verfahrensweise. An der ideologischen Stoßrichtung der NS-Rauschgiftbekämpfung gegen Juden mit ihrem angeblich prozentual höheren Drogenkonsum störte sich der hohe amerikanische Staatsbeamte offenbar nicht. Seinen eigenen Rassismus bekannte er offen und bezeichnete in einem Rundbrief an die Station Chiefs des FBN einen afroamerikanischen Informanten als »ginger colored Nigger«.[16] Eine weitere beispielhafte Aussage von Anslinger vor dem US-Kongress lautete: »Marijuana lässt Dunkelhäutige glauben, sie seien ebenso gut wie Weiße.«[17] Keine Überraschung, dass sein unverhohlen kommunizierter Spitzname in Washington Mussolini war – und das nicht nur aufgrund seines unvorteilhaften Aussehens.
Für Giuliani stellte sich die Kontaktaufnahme mit dem Ex-Gestapo-Bullen als diffizil heraus: Mittlerweile war der frühere Beamte aus dem einst gefürchteten Reichssicherheitshauptamt, das SS-Chef Himmler unterstanden hatte, nach Kiel übergesiedelt, um sich vor einem möglichen Zugriff der Russen in Sicherheit zu bringen. Dort oben an der Küste war das britische Militär stationiert, und auch dieses äußerte Interesse an einer Zusammenarbeit. »Ich sprach mit dem Sicherheitsoffizier des Britischen Sektors, der mit seinem Büro in Kiel kommunizierte«, schrieb Giuliani an Anslinger: »Mittelhaus wird wahrscheinlich von der Kriminalpolizei in der Britischen Zone eingestellt.«[18] Die Engländer beschrieben ihren Fang als »zweifellos effizient und zuverlässig«, ausgestattet mit »erstaunlichen Verbindungen«. Giuliani stellte fest: Sie »haben nicht die Absicht, ihn gehen zu lassen, was sowohl verständlich wie auch vernünftig ist, wenn man das Personalproblem überall in Deutschland berücksichtigt«. Dringend glaubten die westlichen Alliierten, die Hilfe früherer Nazifunktionäre zu benötigen, um das gesellschaftliche Leben in Deutschland am Laufen zu halten. Personal zu finden war nicht einfach: »Viele Tote liegen unter den Trümmern und Steinen von Berlin, Frankfurt und anderen deutschen Städten«, wie Giuliani es lakonisch formulierte.
Der Narcotics Control Officer fand Abhilfe und traf sich stattdessen mit einem anderen früheren Gestapo-Mitarbeiter namens Ackermann, einem »fähigen, tatkräftigen und intelligenten« Ex-Nazi, der ihm »alle Informationen geben konnte, die Mittelhaus hätte geben können«, unter anderem Auskünfte über Drogenschmuggler und deren aktuellen Aufenthalt sowie Kopien von Gestapo-Formularen für die Meldung von Rauschmitteldelikten und Anweisungen für NS-Drogenpolizisten im aktiven Dienst.[19] Solche Schriftstücke waren für den Amerikaner als mögliche Blaupausen für eigene Formulare interessant. Bei diesen Treffen beschwerte sich Ackermann, dass die alten Nazigesetze »mittlerweile verzerrt seien und dadurch an Effizienz verlieren«. Giuliani versicherte, »dass die Aktivitäten der Arbeitsgruppe hier in Berlin dies korrigieren werden«.
Dem Amerikaner tat es leid, dass er Ackermann nicht in Lohn und Brot nehmen konnte, doch würde dieser »in unserer Zone durch die Entnazifizierung fallen«.[20] So viel schien Giuliani klar: Der einzige Erfolg versprechende Ansatz, den ausufernden Drogenhandel in Berlin und Deutschland in den Griff zu bekommen, sei »eine zentralisierte Stelle, durch die Informationen zum Drogenverkehr, sowohl legal wie illegal, kanalisiert werden«. Eine solche Behörde, ähnlich dem früheren NS-Reichsgesundheitsamt, solle »national in seiner Reichweite sein«, denn »aufgrund der Natur des illegalen Drogenhandels, seiner völligen Nichtbeachtung nationaler Grenzen und seiner häufig effizienten Organisation auf internationaler Basis ist es meine Meinung, dass kein Unterfangen, das auf eine zentrale nationale Verwaltung verzichtet, effektiv darin sein kann, die Entwicklung eines weitreichenden illegalen Drogenhandels in Deutschland zu verhindern. Jeder Versuch einer unabhängigen Kontrolle in den verschiedenen Zonen, ohne strikte Inspektion und der Kontrolle jeglicher Post, des Handels und der Reisetätigkeit von Zone zu Zone wäre ungenügend.« Die Dringlichkeit eines zentralisierten Vorgehens beschrieb Anslinger so: »Es ist eine international gemachte Erfahrung, dass Gesetzlosigkeit im Bereich des Drogenschmuggels nicht vor Grenzen haltmacht. (…) Sollte sich ein umfassender illegaler Handel entwickeln, wären die Vereinigten Staaten eines seiner Hauptopfer, egal, in welcher Zone der klandestine Handel seinen Ausgang nimmt.«[21]
Giuliani schlug daraufhin vor, die NS-Regulatorien und NS-Drogengesetze schlichtweg zu übernehmen und lediglich deutsche Bezeichnungen durch ihre englischen Pendants zu ersetzen. Folgende Liste stellte er auf:
»Reichsgesundheitsamt« soll heißen »The Central Narcotics Office for each Zone of Occupation«.
»Landesopiumstelle« soll heißen »Opium Office of the Land or Province«.
»Reichsrat« soll heißen »Allied Control Authority«.
»Reichstag« soll heißen »Allied Control Authority«.[22]
Anslinger gefiel dieser Ansatz, zumal unter der Federführung der Vereinigten Staaten. Giulianis Tätigkeiten in Berlin, so lautete sein Plan, sollten nicht nur Auswirkungen auf Deutschland haben. Ziel des obersten Drogenpolizisten der USA war es, über die frisch gegründeten Vereinten Nationen einen globalen »Politikwechsel hin zu einer stärker prohibitiven Politik« durchzusetzen.[23] Es ging ihm um nicht weniger als die Erstellung eines ordnungspolitischen Rahmens für die Bekämpfung des Drogenhandels für die gesamte Welt nach dem Krieg. Da passte eine Fortführung der rassistischen Herangehensweise der Nazis, die die »Rauschgiftbekämpfung« perfektioniert hatten, um Minderheiten zu unterdrücken, perfekt in sein Weltbild.[24] Aufgrund seiner einflussreichen Pharmaindustrie vor dem Krieg und der geopolitischen Lage als Drehscheibe in Europa kam Deutschland eine Schlüsselrolle und Vorbildfunktion zu. Wenn es gelänge, zwischen Rhein und Oder wieder strenge nationale Kontrollen einzuführen, würde eine internationale einheitliche Regelung wahrscheinlicher. Während seines Antrittsbesuchs im Dezember 1946 als amerikanischer Vertreter bei der UN Commission on Narcotic Drugs präsentierte Anslinger, auf Giulianis Erfahrungen aus Berlin aufbauend, einen global skalierbaren, von Washington dominierten Ansatz der Drogenprohibition. Er hatte vor, die Drogenkommission der UNO zu einer Vollzugsbehörde umzugestalten, die repressive Maßnahmen sowie ein für alle Länder verbindliches einheitliches Anti-Drogen-Protokoll exekutiert.[a] In jedem Fall wollte er verhindern, dass die Kommission sich lediglich als pluralistisches Gesprächsforum entwickelte, das unterschiedliche Ansichten hinsichtlich der potenten Stoffe zuließ. Sein Ziel war nicht leicht umzusetzen, denn bei Weitem nicht alle Länder teilten den Ansatz eines internationalen Verbots, vor allem jene nicht, die das lukrative Opium produzierten, wie Iran, die Türkei, Jugoslawien oder Afghanistan.[b] Solche Staaten waren Washington bald ein Dorn im Auge.
Auch in Berlin, das in Anslingers Plan die Vorreiterrolle einnehmen sollte, gestaltete sich die Situation aufgrund der Teilung in vier Sektoren als Herausforderung. Selbst wenn die Alliierten betonten, einen nationalen Rahmen für Deutschland entwickeln zu wollen, kochte jeder sein eigenes Süppchen, gerade was die Drogenpolitik betraf. Den Briten war vor allem daran gelegen, die kriegszerstörte deutsche Pharmaindustrie kleinzuhalten, während die Franzosen das Thema insgesamt lax angingen: »Mein Treffen mit dem Franzosen war sehr unbefriedigend, denn er wusste nichts über den Vorschlag und noch weniger über das Opiumgesetz«, klagte Giuliani nach einer Unterredung mit seinem Kollegen aus Paris: »Ich redete und redete und bekam kein Zeichen von Intelligenz von ihm. Er war außerordentlich herzlich (…), aber es war entmutigend, im Angesicht von Unwissenheit zu sprechen.«[25]
Einen Strich durch die Rechnung machten Giuliani die Russen. Sie spielten bei der geplanten Übernahme des NS-Ansatzes schlichtweg nicht mit. Jeder Versuch des Amerikaners, bei den Zusammenkünften der Narcotic Control Working Party alle paar Wochen in Zimmer 329 der Alliierten Kontrollbehörde am Berliner Kleist-Park die Prohibition für alle Zonen zu vereinbaren, wurde von seinem Gegenüber mit dem Roten Stern auf der Uniformmütze abgeschmettert.
Immer frustrierter wandte sich Giuliani nach Washington und schrieb von »unverhohlener Sabotage von Seiten der Sowjets«.[26] Privat verstand er sich mit Major Karpov und aß häufig mit ihm zu Mittag: »Informell kann ich gut mit dem Sowjet. Er ist allerdings ein schwerfälliger Ideologe (und) folgt der Linie mit verblüffender Monotonie.«[27] Sobald die Sitzungen der »Arbeitsgruppe« liefen, fiel es Giuliani »schwer, mit ihm ins Geschäft zu kommen«.[28] Karpov sowie sein Kollege Generalmajor Sidorov lehnten das Ansinnen, eine sektorenübergreifende Antidrogen-Kommission zu bilden als auch die Gesetzgebung zu verschärfen, regelmäßig ab. Dies führte zu erhitzten Debatten, in denen sogar »Schimpfwörter zwischen den Delegierten von allen Seiten ausgetauscht wurden«. Giuliani sprach von »zermürbender Frustration«, die seine »Nerven schwer belasteten«.[29] Nach Washington schrieb er: »Es war immer klar, dass der sowjetische Delegierte von Anfang an jeden Versuch sabotieren wollte, (…) Gemeinsamkeit herzustellen.«[30] Die letzten beiden Treffen hätten nichts erreicht.
Stinksauer zog Giuliani am 14. November 1946 sein Fazit: »Offensichtlich haben die Sowjets jede Absicht, den generellen Vorschlag zu blockieren. (…) Alle ihre Argumente waren in Begriffen formuliert, die man nur als egoistisch bezeichnen kann. (…) Eine Perversität.«[31] Anslinger verlangte von Giuliani daraufhin »einen Report (…) über die Situation in Deutschland, der zeigt, was in den vier Zonen hinsichtlich der Drogenkontrolle passiert und wie das Anliegen aufgrund des Fehlens einer zentralen Behörde sich verschlechtert. Zeigen Sie auch die Blockierungstaktiken der Russen auf sowie die Tatsache, dass die Arbeitsgruppe wirkungslos ist«.[32]
Giuliani machte sich ans Werk und verfasste den gewünschten Bericht aus Berlin. Mit diesem lief Anslinger zur UN-Commission on Narcotic Drugs, wo er die Sowjetunion beschuldigte, den Westen mit Betäubungsmitteln überschwemmen zu wollen, um die demokratischen Gesellschaften zu destabilisieren – eine Behauptung, die Giulianis Darstellung verzerrte.[33]
So zeichnete sich auch auf dieser Ebene das Scheitern ab, Berlin und Deutschland zusammenzuhalten, westliche und östliche Sektoren vor einem Auseinanderdriften zu bewahren. Den Amerikanern gelang es nicht, eine einheitliche prohibitionistische Drogenpolitik für alle durchzusetzen, da Moskau sich sperrte. Die deutsche Hauptstadt lag noch immer in Trümmern, ebenso wie Giulianis Anstrengungen als Narcotic Control Officer, dessen Fazit seiner Tätigkeiten in Berlin ambivalent blieb: »Egal, was ich hier erreiche, ich werde diese Erfahrung stets als die ungewöhnlichste erinnern, die ich je gemacht habe.«[34] So viel war ihm klar geworden: Sein Boss Anslinger würde zur Durchsetzung eines globalen Krieges gegen die Drogen einen langen Atem benötigen.[c]
Von der Farbe zur Medizin
Die Auseinandersetzung zwischen Ost und West um die Drogen verschärfte sich, als eine neue Art von Substanzen in das Bewusstsein der Menschen trat. Waren es vorher entweder stimulierende oder betäubende Mittel gewesen, deren Nutzung und Regulierung die Gesellschaft vor Probleme stellten und Giuliani durch die Trümmer Berlins hasten ließen, entstand eine dritte Klasse, deren Handhabung noch schwieriger war – und im Laufe der Jahre immer umstrittener. Anders als Amphetamine oder Opiat-haltige Mittel, bei denen das Verhältnis zwischen medizinischer Nutzung versus gesundheitlicher Gefahren wie Abhängigkeit oder körperlichem Verschleiß begriffen scheint, hält diese neue Gattung ungekannte Herausforderungen für Ärzte, Therapeuten, Medikamentenentwickler, den Gesetzgeber – und nicht zuletzt für ihre Konsumenten parat. Es handelt sich um die sogenannten psychedelischen Mittel wie LSD oder Psilocybin, die in unserer Gegenwart eine Renaissance erleben und die Aktienkurse der Firmen, die sich damit beschäftigen, ebenso steigen lassen wie die Hoffnungen jener, die sich Linderung versprechen für bislang kaum heilbare Krankheiten wie Demenz, Depression oder Angststörungen. Auch diese Substanzen, um deren Umgang bis heute in steigendem Maße gerungen wird, fallen unter jene Jurisdiktion, die Giuliani und sein Boss Anslinger vorbereiteten. Anders als der Hanf, dessen weltweite Legalisierung bevorsteht, sind jene stark auf den menschlichen Geist wirkenden Stoffe noch immer von Tabus umrankt, der Diskurs von Furcht und Desinformation bestimmt. Dabei liegen gerade in ihnen die größten Heilpotenziale.
So stieß ich auf ein White Paper des amerikanischen Start-ups Eleusis, das es sich zur Aufgabe macht, »Psychedelika in Medizin zu verwandeln«.[35] Klinische Anfangsstudien des Imperial College in London zeigen, dass LSD jene Rezeptoren im Gehirn aktiviert (die sogenannten 5HT2A-Rezeptoren), die durch die Alzheimer-Krankheit verkümmern. Als ich dies las, wurde ich hellhörig, denn es ging mich auch persönlich an, da meine Mutter an dieser verschärften Form der Demenz leidet. Das Gehirn, das Alzheimer in einen allmählichen Todesschlaf versetzt, so behauptet der 2020 erschienene Bericht, wird möglicherweise durch kontinuierlich verabreichtes LSD in niedrigen Dosierungen wieder wach geküsst. Auch wenn umfangreiche Testreihen noch ausstehen, gebe es Hinweise, dass die Substanz »ein vielversprechendes krankheitsveränderndes Therapeutikum« für Alzheimer darstelle.[36] Nachweislich wird das neuroplastische Wachstum (die Vernetzung des Gehirns) gefördert und die Neuro-Entzündlichkeit reduziert, die für Demenzerkrankungen mitverantwortlich gemacht wird.
Der Ursprung für die potenteste Spielart dieser neuen Stoffklasse, ebenjenes LSD, lag kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs. Damals kam es beim Wiederaufbau Europas zu einem gesteigerten Hunger nach Farben: All das, was in Schutt und Asche lag, sollte wieder hergerichtet und frisch angepinselt werden. Neu erstrahlen sollte die Welt, bunt sein, und die Uhren standen günstig für die chemische Industrie in Basel, einer zentral positionierten Stadt, die vom Krieg verschont geblieben war, da sich die Schweiz neutral verhalten hatte. Sandoz, ein Farbenhersteller in französisch-schweizerischem Familienbesitz, verdiente an der verstärkten Nachfrage gut und investierte in einen pharmazeutischen Strang, da man dort noch größere Wachstumschancen sah. Tatsächlich war die Entwicklung von der Farben- zur Medikamentenherstellung eine progressive. Um die Jahrhundertwende hatten Firmen in Deutschland chemische Farbstoffe entwickelt, die auch medizinisch Verwendung fanden, sogenannte Thiazine, Verbindungen aus Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefel, die sedierend wirkten. Manche Farben hatten auch antibiotische Effekte, das sogenannte Trypanrot wurde gegen die Schlafkrankheit eingesetzt, Methylenblau gegen Malaria.
Ökonomisch sinnvoll schien der Entschluss in jedem Fall, von Farben zu Arzneimitteln zu expandieren: Krank würden die Menschen immer werden, zumal nach einem Weltkrieg mit seinen mannigfaltigen Spätfolgen. Auch würde es immer mehr Menschen geben, denen Geld für Arzneimittel zur Verfügung stand. Die goldenen Jahre der pharmazeutischen Industrie brachen an, und einer ihrer Pioniere und unfreiwilliger Urvater der bewusstseinsverändernden Substanzen hieß Arthur Stoll, eine schillernde Figur, die manche als »Monster« bezeichneten, andere als Wohltäter und Mann mit »Gemeinschaftssinn«.[37]
Arthur Stoll kam 1887 in einem Schweizer Weindorf namens Schinznach zur Welt. Mit 22 Jahren traf er an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich auf den Wissenschaftler Richard Willstätter, einen Begründer der Biochemie, der für seine Arbeiten über Pflanzenfarbstoffe den Nobelpreis für Chemie erhielt – ein Glücksfall für den talentierten jungen Stoll. 1912 folgte er seinem Mentor an das neu gegründete Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie nach Berlin, wo auch Otto Hahn forschte, dem später dort die erste Kernspaltung gelang. 1916 zogen Willstätter und Stoll an die Ludwig-Maximilians-Universität München weiter, wo der 30-jährige Stoll von König Ludwig III. zum Königlich-Bayrischen Professor auf Lebenszeit berufen wurde. Aber den Überflieger interessierten Lehre und Grundlagenforschung weniger als die praktische Entwicklung von Medikamenten, die akademischen Weihen nicht so sehr wie der Profit in der boomenden Arzneimittelindustrie. Zu Willstätters Überraschung verließ ihn sein bester Schüler im Triumphmoment der frühen Professur und kehrte in die Schweizer Heimat zurück, wo er bei Sandoz die neue Pharmasparte aufbauen sollte – eine einzigartige, herausfordernde Aufgabe.[38] »Das Laboratorium, das ich am 1. Oktober 1917 als leeren Raum ohne irgendwelche Installationen und Möblierung übernahm, war mit Glaswaren und anderen Apparaten aufs denkbar einfachste eingerichtet«, beschrieb Stoll die bescheidenen Anfänge seines Start-ups.[39]
Im Labor von Richard Willstätter in Berlin 1913 – links Assistent Arthur Stoll
Wie würde er die Firma ausrichten, um rasch ein erfolgreiches Medikament auf den Markt zu werfen, die Investoren zufriedenzustellen und das ihm entgegengebrachte Vertrauen zu rechtfertigen? Stoll beschloss, ungewöhnliche Wege zu gehen, alles auf eine Karte zu setzen. Er war der Überzeugung, dass sich der Farbenhersteller Sandoz auf dem »neuen Gebiet auf die Dauer nur werde einführen und durchsetzen können, wenn wir Pionierarbeit leisten und uns nicht einfach damit begnügen, Präparate der Konkurrenz nachzuahmen«.[40] Während andere Firmen in der synthetischen Chemie die Zukunft sahen, baute Stoll auf die Naturstoffforschung, die Entschlüsselung der Pflanzenwelt, um aus natürlichen Verbindungen innovative Medikamente zu gewinnen – eine Art Bioansatz, den er bei Willstätter gelernt hatte – und der dem auf Künstlichkeit setzenden Fortschrittsglauben des frühen 20. Jahrhunderts konträr lief. Stoll aber liebte mutige Entscheidungen.
Welche noch weitgehend unerforschte Pflanze versprach binnen kürzester Zeit ein Return-on-Investment? Sein Augenmerk galt einer als heikel bekannten Substanz, an der andere Naturchemiker gescheitert waren: »Aus manchen Drogen pflanzlicher Herkunft waren die reinen Wirkstoffe wie Morphin, Strychnin, Chinin, Coffein und viele andere bereits bekannt. Noch unklar, ja völlig in Dunkel gehüllt, waren die Kenntnisse über die Natur und die chemische Beschaffenheit der Wirkstoffe des Mutterkorns, das schon durch seine eigenartige Herkunft als Produkt eines Fadenpilzes unter den Arzneidrogen eine Sonderstellung einnimmt«, wie Stoll es beschrieb.[41]
Mutterkorn ist ein merkwürdiges Gewächs, ein purpurner, parasitärer Getreidepilz, auch als Roter Keulenkopf bekannt. Im Mittelalter waren die Sklerotien des claviceps purpurea gefürchtet: harte Geflechte aus Pilzfäden, die bevorzugt Roggen befallen. Wurden jene leicht gekrümmten, keulenförmigen »Wolfszähne« von bis zu sechs Zentimetern Länge, die sich anstelle eines Korns entwickelten, nicht vor dem Getreidemahlen weggesiebt, konnte dies zu Brotvergiftungen führen, die in apokalyptischen Szenarien ausarteten, Massenpsychosen hervorriefen, ganze Landstriche in Schrecken versetzten. Der Konsum von Mutterkorn löste eine Krankheit aus, die als Antoniusfeuer bekannt wurde, zum Zusammenziehen der Blutgefäße führte, mit dem Resultat des Abfallens von Gliedmaßen wie Fingern und Zehen.[d] Mitunter wurde das Leiden sogar mit der Pest verwechselt. »Es wütete eine große Plage mit Anschwellungen und Blasen unter dem Volke und raffte es durch eine entsetzliche Fäulnis hinweg, sodass Körperglieder sich ablösten und vor dem Tode abfielen«, heißt es in einem überlieferten Bericht zu einer Massenvergiftung durch Mutterkorn, die sich im Jahr 857 am Niederrhein zugetragen hatte.[42] Auch fürchterliche Halluzinationen rief das Gewächs hervor. Die Gemälde von Hieronymus Bosch oder Joes van Craesbeecks »Die Versuchung des Heiligen Antonius« zeugen von solchen Ausbrüchen: explodierende Schädel, aus denen Albträume entweichen, kurios mutierte Insekten, die in Münder kriechen, laszive nackte Mischwesen in bizarren Landschaften, abgetrennte Füße und bizarr verrenkte Hände – eine toxische, verrückt gewordene Welt.
Unheimliche Gewächse mit mächtiger Wirkung: Mutterkorn
Diese prekäre Potenz interessierte Stoll, der sich auf die Erkenntnis seines Basler Lokalhelden Paracelsus stützte, wonach in der Dosis das Gift liege und kein Ding per se giftig sei. Denn das Mutterkorn wurde traditionell auch zu Heilzwecken verwendet und war jenen dienlich, die ihm den Namen verliehen hatten: Müttern. Hebammen sammelten den Schmarotzerpilz, kochten einen Sud daraus und verabreichten ihn Gebärenden »zur Verhinderung bzw. Stillung von Blutungen nach der Geburt« oder wenn sich diese zu sehr verzögerte.[43] Stets lauerte jedoch Gefahr: »Der Gehalt an Wirkstoffen des Mutterkorns schwankt innerhalb sehr weiter Grenzen, je nach Herkunft, Alter und Aufbewahrungsweise der Droge (…), so dass immer wieder fatale Versager vorkamen, die die Ärzte zur Verzweiflung bringen konnten.«[44]
Vollkommen unklar blieb, was im Mutterkorn die unheimliche Potenz ausmachte: »In Bezug auf die Wirkstoffe dieser seltsamen Droge«, schrieb Stoll in einer internen Stellungnahme, »fand bisher jeder Forscher etwas anderes als sein Vorgänger.«[45] Etablierte Pharmafirmen wie die amerikanische Wellcome hatten sich am Mutterkorn die Zähne ausgebissen. Immer wieder war es zu Dosierungsschwierigkeiten gekommen, nie blieben die ausgezogenen Stoffe stabil genug. Starke Nebenwirkungen konnten nicht eliminiert werden, es kam zu Todesfällen. Wellcomes führender Chemiker konstatierte nach zahllosen Versuchen entnervt, das aktive Prinzip nicht zu finden.
Im März 1918 gelang Arthur Stoll, was noch keinem gelungen war: Er isolierte ein im Mutterkorn entscheidend wirkendes Alkaloid. Der Name, den er diesem gab: Ergotamin. Sein Laborbericht hierzu liest sich ebenso präzise wie schwärmerisch: »Bei der abgesaugten Lauge sofort, bei der konzentrierten filtrierten nach ca. 1/4 Stunde, begann eine Kristallisation von prachtvollen, äußerst stark lichtbrechenden Prismen und Tafeln, die vielfach von Domen und seitlichen Pyramidenflächen begrenzt waren. Das war die Geburtsstunde des Ergotamins, das sich mit zwei Molekülen Kristallaceton und zwei Molekülen Kristallwasser aus wasserhaltigem Aceton zum ersten Male ganz rein abschied, weil kein anderer Mutterkornwirkstoff in gleicher Weise zu kristallisieren vermag. Dr. Steiner (ein Kollege, Anm. d. Verf.) besuchte mich in jenem Augenblick im Laboratorium und bewunderte mit mir die diamantglänzenden Kristalle. Wir beide hatten den Eindruck, dass etwas Schönes gefunden sei, doch machten wir uns kaum eine Vorstellung über die Tragweite dieser Entdeckung.«[46]
Drei Jahre später kam Ergotamin als gefäßverengendes und bei Nachgeburtsblutungen eingesetztes Arzneimittel Gynergen auf den Markt und war bald ein Erfolg. Stoll bewies sich damit als Visionär, dem es gelungen war, das Niveau seiner akademischen Forschung in die industrielle Arzneimittelproduktion zu überführen. Sein Ansatz, Naturstoffe für neuartige Medikamente zu nutzen, sollte sich als bahnbrechend erweisen. Als Gynergen ab 1926 auch gegen Migräne Verwendung fand, war der Siegeszug von Sandoz nicht mehr aufzuhalten. Allmählich lief der Neuling den alteingesessenen Konkurrenten Bayer, Hoechst, Schering oder Merck, die noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts als »Apotheke der Welt« gegolten hatten, den Rang ab. Bereits 1923 stieg Stoll zum Direktor der Firma auf.[47] Alles schien dem als »Fürchtenichts« bekannt werdenden Pharmapionier zu gelingen. Doch die größte Herausforderung stand noch bevor.
Am Zürcher Hauptbahnhof
Ich beschloss, in die Schweiz zu reisen, um im Archiv der Firma Sandoz, die 1996 mit Ciba-Geigy zu Novartis fusioniert war, zu recherchieren. Mich interessierte, wieso das ebenfalls aus der Mutterkornforschung hervorgegangene, nach heutigem wissenschaftlichem Kenntnisstand so vielversprechende LSD