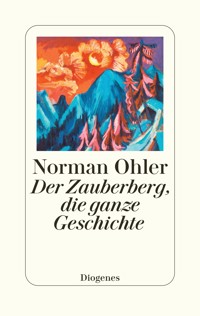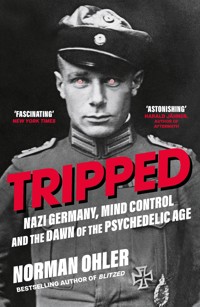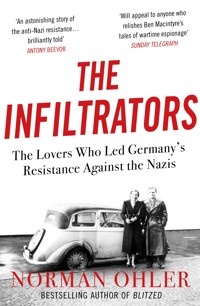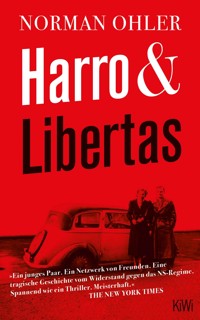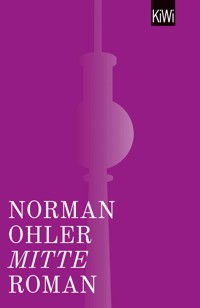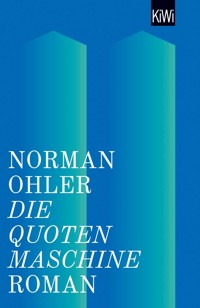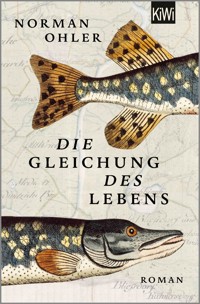12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Leben zwischen Gewalt und Hoffnung. Unmittelbar nach Ende der Apartheid zieht die junge Lucy Tshabalala von Soweto nach Johannesburg. Sie landet in Ponte City, dem inoffiziellen Wahrzeichen der Stadt: einem 54 Stockwerke hohen Wohnturm der Träume und Schrecken – dem angeblich gefährlichsten Hochhaus der Welt. Dort trifft Lucy auf Umshlanga, einen charismatischen Gangster, der sie als Drogenkurierin in die USA schickt – mit fatalen Folgen ... Jahre später kehrt Lucy nach Ponte City zurück. Ihr folgt Roman Kraner, ein Hustler-Reporter aus Berlin, der nur mal schnell ans Ende der Welt reisen wollte, um ein bisschen Spaß zu haben. Doch Lucy hat noch eine Rechnung offen, und plötzlich geht es um Leben und Tod. Ein urbaner Abenteuerroman, zugleich ein spannendes Porträt von Johannesburg: einer Stadt im Umbruch – und am Rande des Abgrunds. »Effektvoll inszeniert: spannend, unheimlich, beängstigend. Eine souveräne Technik, mit der Ohler den Zerfall seines Helden in einer zunehmend albtraumhaften Umgebung in Szene setzt.« Süddeutsche Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Norman Ohler
Stadt des Goldes
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Norman Ohler
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Norman Ohler
Norman Ohler, 1970 geboren, ist der Autor von vier von der Presse gefeierten Romanen und zwei Sachbüchern. Sein erster Roman »Die Quotenmaschine« erschien 1995 zunächst als Hypertext im Netz und gilt als weltweit erster Internet-Roman. »Mitte« (2001) und »Stadt des Goldes« (2002) komplettieren seine Metropolentriologie.
2015 erschien »Der totale Rausch« über die kaum aufgearbeitete Rolle von Drogen im Dritten Reich. Es wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt und stand auf der Bestsellerliste der New York Times. 2017 erschien Ohlers historischer Kriminalroman »Die Gleichung des Lebens«, der mit lebendigem Zeitkolorit das 18. Jahrhundert wiederauferstehen lässt. Mit dem erzählenden Sachbuch »Harro & Libertas« (2019) behandelt Norman Ohler erneut einen bislang nur unzureichend gewürdigten Stoff aus dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte.
www.normanohler.com
instagram: normanohler
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Unmittelbar nach Ende der Apartheid zieht die junge Lucy Tshabalala von Soweto nach Johannesburg. Sie landet in Ponte City, dem inoffiziellen Wahrzeichen der Stadt: einem 54 Stockwerke hohen Wohnturm der Träume und Schrecken – dem angeblich gefährlichsten Hochhaus der Welt. Dort trifft Lucy auf Umshlanga, einen charismatischen Gangster, der sie als Drogenkurierin in die USA schickt – mit fatalen Folgen …
Jahre später kehrt Lucy nach Ponte City zurück. Ihr folgt Roman Kraner, ein Hustler-Reporter aus Berlin, der nur mal schnell ans Ende der Welt reisen wollte, um ein bisschen Spaß zu haben. Doch Lucy hat noch eine Rechnung offen, und plötzlich geht es um Leben und Tod.
Ein urbaner Abenteuerroman, zugleich ein spannendes Porträt von Johannesburg: einer Stadt im Umbruch – und am Rande des Abgrunds.
»Effektvoll inszeniert: spannend, unheimlich, beängstigend. Eine souveräne Technik, mit der Ohler den Zerfall seines Helden in einer zunehmend albtraumhaften Umgebung in Szene setzt.« (Süddeutsche Zeitung)
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© Norman Ohler
© 2019, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Erstmals erschienen 2002 bei Rowohlt Taschenbuch Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Hagen Verleger, Berlin
ISBN978-3-462-31679-7
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motti
Kapitel 54
Kapitel 53
Kapitel 52
Kapitel 51
Kapitel 50
Kapitel 49
Kapitel 48
Kapitel 47
Kapitel 46
Kapitel 45
Kapitel 44
Kapitel 43
Kapitel 42
Kapitel 41
Kapitel 40
Kapitel 39
Kapitel 38
Kapitel 37
Kapitel 36
Kapitel 35
Kapitel 34
Kapitel 33
Kapitel 32
Kapitel 31
Kapitel 30
Kapitel 39.09
Kapitel 28
Kapitel 27
Kapitel 26
Kapitel 25
Kapitel 39.09
Kapitel 23
Kapitel 22
Kapitel 27
Kapitel 20
Kapitel 19
Kapitel 18
Kapitel 17
Kapitel 16
Kapitel 15
Kapitel 14
Kapitel 39.09
Kapitel 13
Kapitel 12
Kapitel 11
Kapitel 10
Kapitel 9
Kapitel 8
Kapitel 7
Kapitel 6
Kapitel 5
Kapitel 4
Kapitel 3
Kapitel 2
Kapitel 1
Kapitel 51.02
Kapitel 0
Lucy Busisiwe Tshabalala
Dank
»Ich lernte Johannesburg zu lieben während all der Jahre, auch wenn es nur eine Grubenstadt war.« Ghandi, 1914
»Es gibt etwas in Johannesburg, das gar nicht gesund ist. Alle leben am Rand eines Vulkans.« Agatha Christie, 1924
»Wir werden mehr Schlösser an den Türen befestigen und uns Hunde anschaffen. Wir werden auf die Schönheit der Bäume bei Nacht und abendliche Wanderungen durch sternerleuchtete Felder verzichten. Wir werden uns mit Sicherheit und Vorsicht einigeln.« Alan Paton, 1956
»Die Innenstadt, in der Kriegsrecht herrscht, war still letzte Nacht, aber Artilleriefeuer wurde gehört und verwirrte Reports empfangen von heftigen Kämpfen in den östlichen und nördlichen Vororten.« Nadine Gordimer, 1984
»Johannesburg: zweitbeste Stadt der Welt, nach Paris.« William Kentridge, 1989
»Der Umbruch spiegelt sich in der Innenstadt wider: weniger sauber und sicher, aber auch menschlicher, sprudelnder. Stets wurde Johannesburg als Frontstadt empfunden.« Robert von Lucius, 1996
54
Der Kondor nimmt vom eigenen Blut, um seine Jungen vor dem Hungertod zu retten. Die Fluggesellschaft scheute keine Mühen und versorgte Roman Kraner immer wieder aufs Neue mit Bordchampagner, verteilt von lustig uniformierten Stewards, die alle schwul zu sein schienen und ständig irgendwelche Witze probierten.
Kraner starrte auf die Rückenlehne seines Vordermannes.
»Rotwein bitte.« Er nickte einem der Operettenstewards zu und bekam sofort eine kleine Flasche aufs Tablett gestellt. Auf dem dunkelgoldenen Etikett des 1997er Cabernet Sauvignon stand »Allesverloren«. Die Maschine ließ gerade den Affenfelsen von Gibraltar hinter sich.
Eine extreme Ausgangssituation, natürlich. Das mit Lucy. Anfang zwanzig und seit fünf Jahren im amerikanischen Knast. Und nun saß sie ebenfalls in irgendeinem Flugzeug, ihre Haftstrafe war beendet, und sie wurde nach Südafrika zurückgeschickt, in ihre alte Heimat. Wenn alles glattlief, würde sie nur zwei Stunden später als Kraner in Johannesburg landen.
Er versuchte sich zu erinnern. Wie sie aussah. Was für ein Mensch sie war. Sie hatten vor Urzeiten, bei seinem ersten und bislang einzigen Besuch am Kap, ein paar Tage miteinander verbracht, mehr nicht.
Er trank das Glas leer, schenkte nach und bestellte einen weiteren »Allesverloren« bei einem leicht angetrunkenen Steward, der grinsend sein Käppi verkehrt herum trug.
Er fiel in einen unbequemen Schlaf. Irgendwann wachte er wieder auf. Jemand hatte Flasche und Glas von seinem Tablett geräumt, und überall schnarchte und schlief es jetzt. Die Atmosphäre in der Maschine hatte ihren Tiefpunkt erreicht, was noch einige zehrende Stunden lang andauern sollte.
Südafrika – er schaute aus dem Fenster, sah aber nichts.
Ein Steward lief vorbei.
»Bekomme ich noch einen Wein?«
Zum ersten Mal hatte er Lucy Busisiwe Tshabalala am 16. Dezember 1992 getroffen, dem burischen Feiertag, der damals noch Nationalfeiertag war und an die siegreiche Schlacht gegen die Zulus am Blutfluss erinnerte.
Roman Kraner, frisch in Johannesburg, um für Geo über die Ablösung der Apartheid zu berichten – eine der größten Umwälzungen in der Geschichte der Menschheit, wie es hieß –, war zur Aussichtsplattform On Top of Africa hinaufgefahren, im obersten Stockwerk des Carlton Centre, des damals höchsten Gebäudes in Afrika. Von dort schaute er über die Stadt und die Abraumhalden der Minen südlich des Zentrums, ganz allein auf der rundum verglasten Aussichtsplattform des Carlton, das wie so viele Gebäude gerade umfunktioniert wurde. Geplant als luxuriöses Hotel –, Kongress- und Einkaufszentrum für Gäste aus aller Welt, wurde es damals bereits mehr und mehr zum Treff- und Mittelpunkt einer afrikanisch werdenden Innenstadt, denn seit 1990, dem Fall der Rassenmauer, strömten Leute aus den Townships zu Hunderttausenden in die Stadt.
Nur On Top of Africa, das zehn Rand Eintritt kostete, war niemand außer Kraner, dem damals 23-Jährigen mit dem verheißungsvollen Auftrag – und den beiden Mädchen, die plötzlich die Muzak-durchspülte Plattform betraten: Lucy und ihre Cousine Gloria.
Beide trugen sie Weiß, zur Feier des Tages, und an ihrer Aufregung war abzulesen, dass auch sie zum ersten Mal auf die Stadt hinunterschauten. Sofort suchten sie den Südwesten, wo die South-Western Township, abgekürzt Soweto, Hügel um Hügel überspannte.
Die beiden Mädchen plapperten ununterbrochen und zeigten auf alle möglichen Orte. Kraner verstand kein einziges Wort, aber er beobachtete, dass eine der beiden ständig in die Ferne schaute, während ihre Freundin immer wieder den Blick nach unten richtete, wo Menschen wie kleine Punkte über den Asphalt hinwegstrichen, den Spielzeugautos ausweichend, die sich ruckend von Ampel zu Ampel bewegten. Er ging auf das Mädchen zu, das sich zum Horizont hin orientierte, und fragte auf Englisch, welche Sprache sie denn sprächen.
»Tswana«, antwortete Lucy scheu, ohne sich ihm zuzuwenden. In der Spiegelung der Scheibe sah er allerdings, dass sie ihn aufmerksam betrachtete. Sie gefiel ihm. Die kurzen Haare, das freche, verstohlene Lächeln.
So kamen sie ins Gespräch. Sie redeten über Johannesburg und betrachteten den Ponte-Turm, den Fernsehsender SABC, die zahllosen Hochhäuser. Wie Kraner später erfahren sollte, war es das erste Mal, dass Lucy sich länger mit einem Weißen unterhielt, der kein Schalterbeamter war, kein Lehrer, kein Polizist.
»Wie ist es denn so in Soweto?«
»Ganz normal. Ich geh in die Schule«, antwortete Lucy und schaute weit über die Stadt hinaus. »Und ich nehm an Schönheitswettbewerben teil. Ich liebe Schönheitswettbewerbe, weißt du?« Sie erzählte ihm, wie sie am Wochenende zuvor bei der Wahl zur »Miss Young Soweto« den zweiten Preis gewonnen hatte.
»Dabei hättest du sicher den ersten verdient, was?!«
»Das nächste Mal gewinn ich!«, sagte sie und drehte sich zu ihm um.
Kraner erzählte, dass er am kommenden Wochenende nach Lost City fahre, zum neu eröffneten Vergnügungskomplex im Homeland Bophutatswana, bei Sun City gelegen, keine anderthalb Autostunden von Johannesburg entfernt. Dort würden die Wahlen zur Miss World abgehalten, zum ersten Mal auf südafrikanischem Boden. Ob sie davon gehört habe?
Lucys Augen wurden riesengroß. Natürlich hatte sie davon gehört. Sie griff nach seinem Handgelenk: »Das ist mein absoluter Traum! Dahin zu fahren!«
Kraner überlegte einen Moment. Geo hatte ihm Eintrittskarten für zwei Personen reserviert, und eine Suite.
»Wenn du willst, komm einfach mit!«
Lucy wurde still. Ihre Cousine schaute sich nervös um.
»Es geht nicht. Mein Vater erlaubt’s nicht. Niemals. Oh, das tut mir so leid!«
»Schade. Hier – ich geb dir meine Telefonnummer, man weiß nie.«
Am nächsten Tag rief sie an.
»Ich hab gelogen! Ich hab von meinem Vater die Erlaubnis bekommen, meine Mutter in Standerton zu besuchen, das ist eine kleine Stadt in der Provinz. Für das ganze Wochenende. Wenn du noch willst, hol mich ab. Kennst du den Sammeltaxistand in der Twist Straat? Dort komm ich am Samstag hin.«
53
Geo-Special Südafrika, 1993
Mit Lost City wurde ein gigantisches Märchen-Afrika aus dem Busch gestampft.
von Roman Kraner
Perfekt und gefühlsecht ist die Rinde um den Stamm aus Edelstahl angebracht, und die frischen Palmwedel in zwanzig Meter Höhe sind keinesfalls aus Plastik, sondern absolut natürlich und nur ein bisschen chemisch nachbehandelt, damit sie noch lange, lange halten.
Denn der Ort, an dem diese falschen echten Bäume stehen, ist als Bollwerk des südafrikanischen Tourismus geplant: Lost City, die »verlorene Stadt«, ein gigantisches, 750 Millionen Rand teures Ferienparadies mit Luxushotel (»The Palace«), das angepriesen wird als »ungewöhnlichstes Areal, das je auf afrikanischem Boden entstanden ist«.
Deshalb kann zum Palace auch kein gewöhnlicher Garten gehören, nein, es muss ein tropischer Regenwald sein (künstlich bewässert, da Dürregebiet) mit 10000 Orchideen, und am Pool (»The Roaring Lagoon«), der mit weißem Sandstrand und türkisfarbenem Wasser wie ein Traum von Südsee angelegt ist, riecht es tatsächlich nach Meer – diese olfaktorische Spielerei gehört zum Perfektionswahn der Lost-City-Planer. Akkurat und immer gleich sind auch die 1,80 Meter hohen Wellen, auf denen im hinteren Teil des riesigen, muschelförmigen Bassins gesurft werden kann. Und für alle, die gerne tauchen, erklingt klassische Musik – unter Wasser.
Langeweile, Probleme, Alltagssorgen: Solche Begriffe haben in Lost City nichts zu suchen. Von Wasserrutschen durch angemalte Zementfelsen über exquisite Restaurants mit toskanischer Küche bis zu einem Golfplatz im Wüstenstil mit lebenden Krokodilen an Loch 13 – es ist alles da, und zwar in Luxusausführung.
Und es gibt sogar einen Überbau: Unzählige Plaketten und Schautafeln erzählen den staunenden Besuchern die »Legende des verlorenen Stammes«, dessen weit entwickelte Kultur hier bewahrt werde; eine Kultur, die schon vor Jahrhunderten Paläste wie das Palace erbaut habe.
Natürlich hat es diese Kultur nie gegeben, aber sie ist, wie sich der Gast aus Übersee ein exotisches Afrika vorstellt: Brunnen, die aus den Hörnern bronzener Antilopen gespeist werden, frisch gemalte Deckenfresken, die aussehen, als würden sie abblättern, eine tropische Bar mit blitzsauberen schwarzen Barkeepern unter gleichmäßig summenden Ventilatoren, hinter Glas ausgestellte Phantasiekronen erfundener afrikanischer Monarchen – Märchen ohne Ende. Lost City, dieses Indiana-Jones-Afrika für jedermann, ist die in Beton gegossene Bequemlichkeit – natürlich so verputzt, dass das riesige, ein ganzes Tal ausfüllende Gelände wie aus Stein gehauen aussieht. Alle Vorstellungen von einem aufregenden, aber keimfreien dunklen Kontinent werden hier bedient.
52
Völlig erschöpft saß Lucy im Flugzeug, von zwei amerikanischen Polizistinnen flankiert, die sicherstellen mussten, dass sie ordnungsgemäß aus den USA deportiert wurde und am nächsten Morgen, wenn diese viel zu lange Nacht endlich zu Ende gegangen war, südafrikanischen Boden betrat.
So viele Dinge gingen ihr durch den Kopf. So erleichtert sie war, der Hölle – ihr letzter Aufenthalt hatte im Dallas County Jail stattgefunden – zu entkommen, hatte sie auch große Angst vor dem, was sie in ihrer alten Heimat erwartete. Wie stark musste sich diese in den letzten Jahren verändert haben!
Vor allem aber wusste Lucy nicht, ob sie überhaupt jemand am Flughafen abholen würde, das war das Schlimmste. Mit ihren Eltern war nicht zu rechnen, ihre Mutter war zu arm, um von Standerton aus nach Johannesburg zu reisen, und ihr Vater schien sie aufgrund des Delikts verstoßen zu haben, jedenfalls hatte sie in den fünf Jahren keinen einzigen Brief von ihm erhalten.
Sie dachte an ihren deutschen Bekannten. Roman Kraner. Ihr einziger Kontakt zur Außenwelt, während sie gesessen hatte – ein Brief etwa alle drei, vier Monate. Sie hatte ihm den Zeitpunkt ihrer Freilassung sofort mitgeteilt, so kurzfristig allerdings, dass er sich nicht mehr hatte melden können. Und so machte sie sich kaum Hoffnungen, dass er sein vages Versprechen einlösen würde und sie am Jo’burger Flughafen empfing. Sie trank eine Cola und starrte stur geradeaus, um die uniformierten Schnepfen nicht sehen zu müssen. Ihre Gedanken rasten und kamen schließlich auch an Lost City vorbei.
Mann – wie er sie abgeholt hatte in der Twist Straat. Der schicke Leihwagen: Toyota Conquest, ihr Lieblingsmodell. Das zitronengelbe Kleid, das sie damals angehabt hatte. Sein Kommentar, sie wäre darin schöner als die kommende Miss World, egal, wer gewinnt.
Die lockere Fahrt raus aus der Stadt und dann, irgendwann hinter einem Hügel wie eine Fata Morgana: der Palast von Lost City.
Die Begrüßungscocktails in der Empfangshalle des Hotels. Wie schnell sie beschwipst gewesen war! Die Angestellten überall, in diesen Phantasietrachten. Die schwarzen Pagen, die auch sie bedienten, und die Papageien, die durch die Gegend flatterten, um sich in der Krone dieser riesigen Palme niederzulassen, die in der Lobby wuchs. Elegant gekleidete, hochgewachsene Frauen. Königinnen! Männer in teuren Anzügen, Manager, noch mehr Models, alle angereist für die Wahl zur Miss World. Und mittendrin sie, Lucy!
Der Portier, der ihnen die Suite öffnete und zunächst allein hineinging – ein Klatschen, dann das Sprayen einer Dose. Danach kam der Mann zurück, zeigte seine blutverschmierten Handinnenflächen, grinste und verschwand.
Das Blumenbouquet im Salon der Suite – und die Minibar! Das Flusspferd draußen im Teich vor der Veranda – die kleinen Ohren über dem braungrünen Wasser wie Mündungen von Pistolen.
Abends dann die Wahl zur Miss World. Und wie Roman ihr vorher noch in einer Palastboutique das jadegrüne Kleid gekauft hatte, weil seine Zeitung ja alles bezahlte.
Der Gang zum großen Galasaal, wo die schönste Frau der Welt gekürt werden sollte. Wie sie Arm in Arm über die Freitreppe des Palastes spaziert waren, wo andere Pärchen schon an der Brüstung standen und in die Landschaft schauten, über den tropischen Regenwald hinweg, der künstlich bewässert wurde, weil das ja Wüstengegend war, und die Geräuschkulisse – Zikadenkonzert, ab und zu Löwengebrüll – durch versteckte Lautsprecher erzeugt.
Dann eine Lichtung, die in einer steinernen Aussichtsplattform endete. Das Land fiel terrassenartig ab, bis hinunter zu einem künstlichen Meer, das in den letzten Strahlen der Abendsonne funkelte: das »Tal der Wellen«, dessen Brandung gerade ausgeschaltet wurde.
Der Galasaal von Lost City lag im Innern eines künstlichen Berges. Um zu ihm zu gelangen, musste man das Casino durchqueren, einarmige Banditen und Spieltische auf mehreren Etagen. Hunderte von Leuten, die mit Geld spielten! Dann ihr unheimliches Spielglück. Zum erstbesten Automaten war sie marschiert, hatte die erste Münze, die Roman ihr umgetauscht hatte, in den Schlitz gesteckt, den silbernen Hebel gezogen und drei Kirschen auf der Mittellinie gestoppt. Das Prasseln der Taler! Ihr Aufschrei, dann der verzweifelte Versuch, den Gewinn im Saum des Kleides zu verstauen.
Schließlich die Wahlzeremonie. Die siegreiche Russin. Und wie Roman, anscheinend betrunken, plötzlich nach draußen gestürzt war, noch während der Punkteauszählung, und sich in einen gigantischen Blumenkübel übergeben hatte.
Das mediterrane Buffet hinterher. Berge von Austern, Hummer, Langusten, schwarze Spaghetti in Champagnersoße, Kanapees, Trüffeltorten.
Dann erschöpft eingeschlafen, noch immer ohne sich zu berühren, im großen, weichen Bett der Suite. Aufgewacht bei Sonnenaufgang, ein Gähnen des Flusspferdes, dann, wortlos, vorsichtige Berührungen wie im Traum – und wieder einschlafen, dann am Vormittag aufstehen, die klare warme Luft, zusammen duschen, das Frühstück auf der Terrasse, die Fahrt zurück in die Stadt.
Lucy zitterte, während sie daran dachte.
51
Einige Monate nach ihrem Aufenthalt in Lost City – Roman war mittlerweile nach Europa zurückgekehrt und bis auf sporadische Briefe gab es keinen Kontakt – fiel ein starker Gewitterregen. Wind pfiff, und die Lichter, die von den Matchbox-Häusern der gegenüberliegenden Hügel herüberleuchteten, flackerten heftig, Morsezeichen gleich.
Lucy hatte bereits vor einigen Tagen beschlossen, die Township zu verlassen. Jetzt, da ihre Schulausbildung abgeschlossen war und die Gesetze, die es verboten, sich den Wohnort frei auszusuchen, nicht mehr galten, wollte sie nicht länger auf ein eigenes Zimmer verzichten, nicht länger auf einer dünnen Matte schlafen, die jede Unebenheit des Bodens in ihre Träume übergehen ließ.
Ihrem Vater, Solomon Tshabalala, war es nicht unrecht, als sie ihm ankündigte, sein Haus zu verlassen, um in Johannesburg nach Arbeit zu suchen: eine Esserin weniger am Tisch. Gleichzeitig bedauerte er den Weggang seiner Tochter, denn schließlich verlor er damit die Kontrolle über sie. Er vermutete, sie würde sich prostituieren – ein Gedanke, den er sofort wieder zu verdrängen suchte. Aber wie sonst konnte ein junges Mädchen im Jahre 1992 überleben in der Stadt? Der Kampf zwischen den Rassen war zwar offiziell beendet, doch herrschte in Wirklichkeit noch immer Ausnahmezustand, und es gab keinerlei Sicherheiten, keine funktionierende Polizei, man konnte sich auf niemanden verlassen. Selbst er war nicht mehr in der Lage, seiner Tochter Schutz zu bieten. Zu zerrissen war die Familie mittlerweile, aber das ist immer so, dachte er. Die Familie bleibt vom Krieg nicht verschont.
Gloria brachte ihre Cousine zum Sammeltaxistand, Tränen in den Augen. Im Geldbeutel hatte Lucy einhundert Rand sowie eine Adresse im Stadtteil Hillbrow, wo sie sich für einen erstaunlich niedrigen Preis einmieten konnte, so hatte man ihr erzählt.
Die Fahrt in die Innenstadt, zum Umsteigebahnhof in der Twist Straat: ruhig, ernst und traurig. Das Taxiradio plärrte Nachrichten von neuer Gewalt zwischen Zulus und Xhosas in der Gegend um Durban und in Alexandra. Dreizehn Tote in einer Nacht.
Die Adresse führte sie zu einem mit Matratzen ausgekleideten Zimmer voller Ungeziefer im Hotel Europa. Alle anderen Mädchen und Frauen, die dort abstiegen, arbeiteten als Huren. Lucy, die erst mit zwei Männern geschlafen hatte, ihrem ersten Freund und in Lost City mit Roman Kraner, verstörte das sehr. Zwar hatte sie keine Ahnung, wie sie zu Geld kommen konnte, ohne ihren Körper zu verkaufen, doch gerade das wollte sie auf keinen Fall – auch wenn es in Hillbrow gang und gäbe war, dem einstigen Künstlerviertel für Weiße, das nun als Auffangbecken für Schwarze fungierte, die neu waren in der Stadt. Ihre Mitbewohnerinnen lachten sie aus, als sie meinte, vielleicht in einem »Modegeschäft« Arbeit zu finden, und konnten Lucys Naivität kaum fassen, ihre kindlichen Pläne und Vorstellungen. »Wo hast du denn die ganze Zeit gelebt?«, fragte eine gleichaltrige Moçambiquanerin, die die Matratze links von ihr gemietet hatte. Lucy nannte Soweto, woraufhin die Moçambiquanerin verwundert den Kopf schüttelte. Sie habe gedacht, wer von dort stammt, wisse, was sich abspielt in dieser Welt.
50
Kraner durchwühlte sein Handgepäck. Drei Stunden noch bis zur Landung. Beim besten Willen konnte er nicht schlafen, auch wenn die Rotweinbetäubung ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hatte. Er zog eine graue Kladde heraus. Auf der Vorderseite stand in großen Buchstaben Born to Suffer geschrieben. Die Kladde hatte Lucy ihm vor ein paar Wochen geschickt. Er schlug sie auf und las.
Ich lief durch die Straßen von Hillbrow und suchte nach einem Job, als mich ein sehr dunkler Mann mit einem fremden Akzent ansprach.
»Entschuldigen Sie, Lady, kann ich für einen Moment mit Ihnen sprechen?«
Ich sagte, dass ich es eilig habe, doch er folgte mir. Ich war so hungrig, ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen.
»Sie sehen aus wie eine Lady aus Nigeria. Woher kommen Sie?«
»Ich bin von hier«, antwortete ich. Dann fragte er, was ich hier mache, und ich sagte, ich suche nach Arbeit, kann aber keine finden. Er sagte, er wird mir helfen. Ich betrachtete ihn genau. Er sah nicht so aus, als könnte er irgendjemand einen Job besorgen, aber da ich sehr hungrig war, fragte ich ihn, ob er mir was zu essen beschafft. Also brachte er mich in ein Restaurant – das gleiche, aus dem ich gerade gekommen war, um nach einem Job zu fragen, ein Wimpy’s. Er sagte, ich kann bestellen, was ich will. Ich aß eine ganze Menge, er dagegen überhaupt nichts. Dann redeten wir wieder über Arbeitssuche. Er sagte, wenn ich einen Pass bekomme, gibt es einen Job für mich. Ich fragte ihn, was für ein Job das ist, wofür man einen Pass braucht. Er sagte, ich würde an Orte wie Brasilien und Thailand fliegen, um Gold zu verkaufen. Dann gingen wir spazieren. Plötzlich standen wir vor seiner Wohnung. Ich hatte Angst, mit ihm zu gehen, doch er bat mich darum. Er versicherte mir, es besteht keinerlei Gefahr für mich, er wollte mich nur seinen Freunden vorstellen. Als ich eintrat, sah ich einige Männer auf dem Boden schlafen. Wir setzten uns auf eine Couch und plauderten. Als ich gehen wollte, sagte er, ich soll zurückkommen, wann immer ich will, dann würden wir über den Job reden und über den Pass.
Während der nächsten paar Tage versuchte ich, irgendwie über die Runden zu kommen und etwas für mich zu finden, aber es gelang mir nicht. Ab und zu dachte ich an den Nigerianer. Ich lief immer wieder durch dieselben Straßen von Hillbrow. Plötzlich spazierte er neben mir und fragte, warum ich ihn nicht mehr besuche. Er wirkte sehr nett und lächelte. Ich fragte ihn, ob er eine Wohnung für mich weiß, da ich nicht mehr in dem Zimmer mit den Huren schlafen wollte. Er lud mich ein, in seiner Wohnung zu wohnen. Auch dort war es aber sehr voll. Ich schlief auf dem Boden, mitten unter Fremden. Am nächsten Tag beantragte ich einen Pass.
Es dauerte Wochen, bis der Pass endlich ausgestellt wurde. Irgendwann begriff ich, dass mein Gastgeber auf der Straße Tomaten verkaufte, um sich über Wasser zu halten. Wie sollte er mir da jemals weiterhelfen? Was war das für eine geschwindelte Geschichte mit dem Gold? Ich traf dann einen seiner Freunde, Umshlanga Kingsley. Er war groß und sah gut aus und trug eine glänzende schwarze Sporthose, die neuesten Sneakers von Adidas, dazu eine schwarze Jacke, die sich bauschte, wenn er lief. Sein Haar klebte wie Plastik auf seinem Kopf. Er trug eine golden eingefasste Sonnenbrille, hinter der man seine Augen nicht sah. Er lächelte nicht, als er mich einlud, seine Freundin zu werden und bei ihm zu wohnen. Irgendetwas gefiel mir an seiner Coolness. Er wirkte unverwundbar, als könnte ihm nichts in dieser Welt etwas anhaben.
So kam ich zum ersten Mal nach Ponte, in den großen Apartment-Turm. Umshlanga hatte eine herrliche Wohnung im 50. Stock. Nummer 50.11. Der Blick war genauso gut wie vom Carlton. Und ich hatte ihn Tag und Nacht. Es war schön mit Umshlanga. Er half mir, die Gebühren für die Unisa zu bezahlen, die Fern-Uni, und ein Semester lang belegte ich Kurse. Jetzt brauchte ich mich ja nicht mehr um Arbeit zu bemühen.
Einige Zeit später, in der Nacht, klopfte es an der Tür. Umshlanga öffnete. Vor ihm standen vier Männer. Sie warfen ihn auf den Boden und fingen an, ihn zusammenzuschlagen und zusammenzutreten. Dann kamen sie auf mich zu und sperrten mich in die Küche. Ich hörte, wie sie weiter auf ihn einschlugen und sagten, sie sind von der Drogenpolizei. Sie fragten ihn, wo er her ist, und er sagte: Aus Ghana. Dann kam einer von ihnen zu mir in die Küche und fragte mich nach Coke, aber ich war wie gelähmt und konnte nicht an den Kühlschrank. Ich schwöre es: Ich wusste nicht, was er meint, weil ich keine Ahnung hatte, dass Umshlanga ein Dealer war. Ich hatte ihn ein paar Mal gefragt, mit was er sein Geld verdient, aber er hatte immer ausweichende Antworten gegeben, so als wäre das seine Sache, nicht meine. Ich glaube, er wollte nicht, dass ich damit was zu tun habe. Der Mann schlug mir ins Gesicht und sperrte mich wieder in die Küche. Alle vier trugen Pistolen, aber keine Uniformen. Ich hatte solche Angst. Ich dachte, sie erschießen mich vielleicht durch die Tür durch. Sie machten sich wieder daran, Umshlanga zusammenzuschlagen. Ich blieb in der Küche und hielt mir die Ohren zu, damit ich nicht ihre Schläge hören musste und seine Schreie. Er rief nach seinem Gott, in seiner nigerianischen Sprache. Sie schlugen ihn eine ganze Weile. Irgendwann war er still. Sie waren gegangen. Ich warf mich gegen die Küchentür, und sie ging auf.
Die ganze Wohnung war in Unordnung. Stühle lagen auf dem Boden, ein Tisch war zerschmettert und das Master-Bett total zerstört. All meine Kleider, die ich im Bad aufgehängt hatte, waren nass und beschädigt. Man konnte sehen, dass sie nach etwas gesucht hatten. Ich lief in den Salon, und Umshlanga lag auf dem Boden und wimmerte vor Schmerzen. Als er wieder sprechen konnte, fragte er mich als Allererstes, ob ich böse auf ihn bin, weil er mir nicht gesagt hatte, dass er ein Dealer war. Er sagte, er hätte Angst gehabt, mir die volle Wahrheit zu sagen, weil er dachte, ich verlasse ihn dann oder gehe zur Polizei. Ich fragte ihn, warum er Drogen verkauft und nicht einer normalen, sauberen Arbeit nachgeht. Da erklärte er mir, eine saubere Arbeit gibt es nicht, und erzählte mir, wie viel Geld man mit Kokainhandel machen kann, wenn man es richtig anstellt. Er schwor, so was wie in dieser Nacht würde nie wieder passieren. Er ging dann zu einem der Sessel mit den bunten Stoffüberzügen und holte Kokain unter dem Sitzkissen hervor. Das war das erste Mal, dass ich Drogen sah. Sie waren in Plastik eingepackt. Ich war böse auf ihn. Ich wollte meine Sachen nehmen und gehen, aber ich wusste nicht, wohin. Dann entschied ich mich, bei ihm zu bleiben.
Umshlangas Geschäfte liefen weiterhin gut. Die Männer kamen nicht zurück. Umshlanga versteckte jetzt nichts mehr vor mir. Irgendwann schwappte derart viel Geld in die Wohnung, dass er anfing, es bündelweise unter unsere neue Kingsize-Matratze zu packen. Wir liebten uns auf Dollarnoten, und wenn ich was brauchte, griff ich unter mich und ging einkaufen. Doch ich war nicht glücklich. Umshlanga behandelte mich nicht gut. Er bestand darauf, dass ich ganz trocken war, wenn wir miteinander schliefen. So ist das in Nigeria, hat er gesagt. Staubtrocken sollte ich sein. Dann kann der Leopard besser jagen. Also durfte ich nie an Sex denken, wenn ich ihn sah. Das verbot er mir, damit ich nicht nass wurde. Er spielte alle möglichen Tricks, aber ich durfte nicht nass sein. Er prüfte es nach. Er stopfte mir Dollarnoten in die Muschi, damit sie trocken blieb. Es gefiel ihm, mit mir durch Hillbrow zu spazieren, und in mir drin scheuerten Hunderte von Dollars.
Ich dachte oft an meine Mutter, die in einer kleinen Hütte ohne Klo lebte, während ich auf Geld schlief und kilometerweit in die Ferne blickte. Ich fragte mich, ob ich noch mit diesem fremden Mann zusammenbleiben sollte, der ja jederzeit verschwinden konnte. Ich besprach meine Probleme mit ihm, und er sagte, ich soll mein eigenes Geld verdienen, und es würde da auch eine Möglichkeit geben. Er sagte, ich soll meine besten Kleider anziehen, weil wir seinen Boss besuchen würden.
Ich zog meine schicksten Sachen an. Als wir in der Wohnung ankamen, im selben Haus, nur zwei Stockwerke tiefer, empfing mich sein Boss sehr freundlich. Er war sehr gespannt darauf gewesen, mich zu treffen, sagte er und bat mich dann, im Schlafzimmer zu warten, während Umshlanga und er in der Küche etwas besprachen. Sie redeten eine ganze Weile und kamen dann zu mir. Der Boss stellte sich als Frank Milla vor und fragte mich, ob ich am kommenden Sonntag nach Amerika fliegen will. Ich fragte ihn ganz aufgeregt: Wofür? Er sagte mir, ich würde Drogen nach Amerika bringen. Ich würde eine Antilope sein – so heißen junge Frauen, die als Kuriere arbeiten, sagte er. Ich konnte es nicht glauben, dass sie mich fragten, ob ich nach Amerika wollte! Das war immer mein Traum gewesen. Die Tatsache, dorthin Drogen zu transportieren, schien nebensächlich. Ich konnte nur noch daran denken, in Amerika zu sein. Frank sagte, er würde mir 10000 Dollar zahlen. Ich traute meinen Ohren nicht. Ich war so glücklich. Sie erzählten mir nichts von der Gefahr. Ich war ganz aus dem Häuschen. Sie hatten sogar schon mein Ticket gekauft und alles arrangiert. Frank gab mir 500 Rand, damit ich Sachen kaufen konnte, die ich für die Reise brauchte. Er sagte, eine Reisetasche und Kosmetikzeug. Ich ging mit Umshlanga einkaufen.
Die Tage bis Sonntag vergingen sehr langsam. Samstagabend konnte ich kaum schlafen. Ich warf mich im Bett rum und dachte an die Reise. Ich war so nervös und bekam plötzlich Angst. Umshlanga hatte mir eingebläut, mit niemandem darüber zu reden. Ich vertraute ihm, weil ich trotz allem glaubte, dass er mich liebte. Da ich nicht schlafen konnte, fuhr ich mit dem Fahrstuhl nach unten, alle 50 Stockwerke, und rief Gloria von einem Telefonladen unten in Ponte aus an. Mit ihr teilte ich immer alle Geheimnisse, also beschloss ich, Umshlangas Warnung zu ignorieren, und erzählte ihr, dass ich nach Amerika fliege. Ich verriet ihr aber nichts von den Drogen, sondern sagte, ich würde mit einer Model-Agentur fliegen. Sie sagte, dass sie sich so freut für mich. Dann bat sie mich, meiner Mutter Bescheid zu geben. Als ich meine Mutter dann anrief, war sie auch so glücklich für mich.
Ich fuhr mit dem Lift zurück nach oben und versuchte zu schlafen.
Am nächsten Tag ging ich mit Umshlanga zu seinem Boss. Ich hatte Angst. Ich wusste wenig über Drogen, aber ich kapierte, dass sie gefährlich waren und dass ich im Gefängnis landen konnte, wenn ich damit erwischt wurde. Als wir in Millas Wohnung ankamen, war dort noch eine Frau. Sie stellte sich als Priscilla vor. Sie sagte mir, sie würde mir dabei helfen, die Drogen an meinem Körper anzubringen. Ich fragte sie, ob sie jemals Drogen geschmuggelt hatte, und sie antwortete ja, aber nicht an ihrem Körper, sondern in einer Tasche. Aber es wäre sicherer, sie am Körper zu verstauen.
Ich ging mit Priscilla ins Bad. Sie bat mich, alle meine Kleider auszuziehen. Ich tat es. Sie zeigte mir, was ich zu schmuggeln hatte. Es waren kleine Packen, in braunes Papier gewickelt und mit weißem Klebeband zusammengehalten. Sie waren in Kaffee getränkt, damit die Hunde am Flughafen sie nicht riechen. Priscilla holte einen engen Badeanzug und einen blauen Gürtel aus ihrer Tasche. Sie wickelte die Päckchen um meine Taille, dann schnallte sie den Gürtel darum und bat mich, den Badeanzug anzulegen. Der Gürtel war so eng, dass ich kaum atmen konnte, aber ich sagte nichts. Ich zog meine Kleider über den Badeanzug, und sie gab mir eine braune Männerjacke. Es war zu heiß für die Jacke, aber ich zog sie an. Alles fühlte sich so unbequem an. Dann rief sie Umshlanga und Frank, um sie zu fragen, ob sie gute Arbeit geleistet hatte. Als Frank mich prüfte, entschied er, dass sie keine gute Arbeit geleistet hatte. Er fragte dann Umshlanga, ob es okay ist, wenn ich alles noch einmal ausziehe. Umshlanga sagte, für ihn ist es okay. Für mich war es nicht so okay, mich vor einem Fremden auszuziehen, aber ich sagte nichts und zog mich aus. Frank begann dann, zwei der Bündel vor meinen Bauch zu binden und zwei hinten. Sie waren voll gepackt und fühlten sich schwer an. Dann band er den Gürtel – viel fester, als Priscilla ihn gebunden hatte. Er sagte, ich soll den Badeanzug und meine Kleider anziehen. Es war noch viel unbequemer als zuvor. Ich konnte jetzt wirklich kaum noch atmen. Die Klebrigkeit des Kaffees zusammen mit dem Klebeband taten meiner Haut weh. Ich sagte es, aber Frank meinte, ich würde mich daran gewöhnen. Dann gab er Priscilla Geld. Priscilla sollte mich zum Flughafen bringen und dafür sorgen, dass ich ohne Probleme das Flugzeug bestieg. Als ich Umshlanga ansah, bemerkte ich, dass er sich große Sorgen machte. Er kam auf mich zu und umarmte mich und sagte mir, dass er mich liebt und dass alles in Ordnung geht. Sobald ich zurückkomme, würden wir eine große Party feiern. Er sagte, ich würde es schaffen, weil Gott auf meiner Seite ist. Gott würde verstehen, dass ich das nur tue, um meiner armen Mutter zu helfen. Dann hielt er meine Hände und betete in seiner Sprache.
Frank nahm sein Handy und rief ein Maxi Taxi. Als das Taxi kam, nahm ich das bisschen Gepäck, das ich hatte. Ich hatte große Angst, aber es war zu spät, zu sagen, dass ich es nicht mehr tun wollte. Umshlanga und Frank blieben in der Wohnung, während Priscilla und ich ins Taxi stiegen.
Wir fuhren zum Flughafen. Ich fühlte mich krank, und es war sehr schwer zu atmen, weil alles so dicht um mich gepackt war. Ich begann, mich mit Priscilla zu unterhalten. Aber sie sagte nicht viel. Sie sagte nur, was ich jetzt tun würde, ist besser, als eine Hure zu sein.
Das Erste, was ich am Flughafen sah, waren Polizisten mit Hunden. Ich bekam schreckliche Angst, aber Priscilla sagte mir, sie sind nur auf Patrouille, weil ein paar Tage vorher eine Bombe hochgegangen war. Priscilla, die mein Ticket und meinen Pass hatte, ging zu einem öffentlichen Telefon und rief Frank an und sagte, dass wir sicher am Flughafen angekommen sind. Während sie telefonierte, fühlte ich mich so einsam und leer. Sie kam zurück und gab mir 500 Dollar und meine Reisepapiere. Sie erklärte mir genau, was ich zu tun hatte. Dann verließ sie mich.
Ich stand nun allein im Terminal. Ich wusste nicht genau, wohin. Ich gab meine Tasche auf und lief durch die Gegend. Ich sah, wie Polizisten auf einen Mann zugingen und ihn etwas fragten. Dann liefen sie mit ihm davon und verschwanden hinter einer Tür. Das versetzte mich in Panik. Ich glaubte, dass sie mich durchsuchen würden. Da sah ich eine weiße Frau mit einem ANC