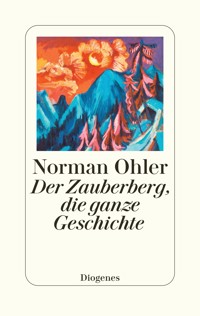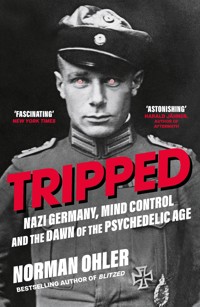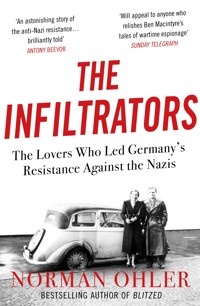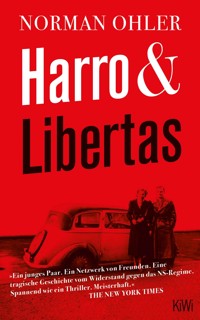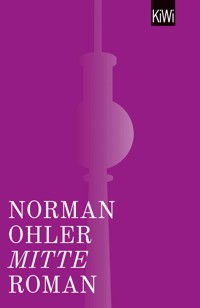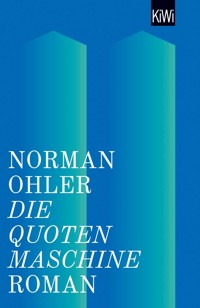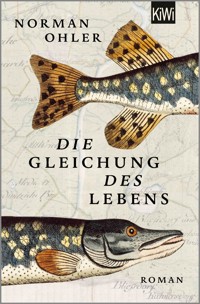14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Sehr gut und äußerst interessant ... eine wichtige wissenschaftliche Studie, ausgezeichnet recherchiert«Ian Kershaw Über Drogen im Dritten Reich ist bislang wenig bekannt. Norman Ohler geht den Tätern von damals buchstäblich unter die Haut und schaut direkt in ihre Blutbahnen hinein. Arisch rein ging es darin nicht zu, sondern chemisch deutsch – und ziemlich toxisch. Wo die Ideologie für Fanatismus und »Endsieg« nicht mehr ausreichte, wurde hemmungslos nachgeholfen, während man offiziell eine strikte Politik der »Rauschgiftbekämpfung« betrieb. Als Deutschland 1940 Frankreich überfiel, standen die Soldaten der Wehrmacht unter 35 Millionen Dosierungen Pervitin. Das Präparat – heute als Crystal Meth bekannt – war damals in jeder Apotheke erhältlich, machte den Blitzkrieg erst möglich und wurde zur Volksdroge im NS-Staat. Auch der vermeintliche Abstinenzler Hitler griff gerne zur pharmakologischen Stimulanz: Als er im Winter 1944 seine letzte Offensive befehligte, kannte er längst keine nüchternen Tage mehr. Schier pausenlos erhielt er von seinem Leibarzt Theo Morell verschiedenste Dopingmittel, dubiose Hormonpräparate und auch harte Drogen gespritzt. Nur so konnte der Diktator seinen Wahn bis zum Schluss aufrechterhalten. Ohler hat bislang gesperrte Materialien ausgewertet, mit Zeitzeugen, Militärhistorikern und Medizinern gesprochen. Entstanden ist ein erschütterndes, faktengenaues Buch. Der totale Rausch wurde von dem bedeutenden Historiker Hans Mommsen begleitet, der das Nachwort beisteuert. Sein Fazit: »Dieses Buch ändert das Gesamtbild.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Norman Ohler
Der totale Rausch
Drogen im Dritten Reich
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Norman Ohler
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Norman Ohler
Norman Ohler, geboren 1970, freier Schriftsteller seit 1993, besuchte die Hamburger Journalistenschule und studierte Kulturwissenschaften und Philosophie. Sein Debüt »Die Quotenmaschine« erschien 1995 als weltweit erster Roman im Netz. Weitere Romane sind die von den Feuilletons gefeierten »Mitte« und »Stadt des Goldes«. Ohler war Stadtschreiber von Ramallah, ist Autor von Filmdrehbüchern (u.a. mit Wim Wenders und Dennis Hopper) und wurde mit zahlreichen Preisen und Stipendien ausgezeichnet. Für »Der totale Rausch«, sein erstes Sachbuch, recherchierte er fünf Jahre lang in Archiven in Deutschland und den USA und wertete zahlreiche Originalmaterialien aus, die der Forschung entgangen waren.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Über Drogen im Dritten Reich ist bislang wenig bekannt. Norman Ohler geht den Tätern von damals buchstäblich unter die Haut und schaut direkt in ihre Blutbahnen hinein. Arisch rein ging es darin nicht zu, sondern chemisch deutsch – und ziemlich toxisch. Wo die Ideologie für Fanatismus und »Endsieg« nicht mehr ausreichte, wurde hemmungslos nachgeholfen, während man offiziell eine strikte Politik der »Rauschgiftbekämpfung« betrieb.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2015, 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Douglas Gordon
ISBN978-3-462-31517-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Packungsbeilage statt Vorwort
Zum Krankheitsbild
Zur Diagnose
Potenz des Inhalts
Gefahren bei der Lektüre
Nebenwirkungen
Wie ist dieses Buch aufzubewahren?
Teil I
Breaking Bad: die Drogenküche der Reichshauptstadt
Vorspiel im 19. Jahrhundert: die Urdroge
Deutschland, Land der Drogen
Die chemischen Zwanziger
Machtwechsel heißt Substanzenwechsel
Antidrogenpolitik als antisemitische Politik
Der Promiarzt vom Kurfürstendamm
Spritzencocktail für Patient A
Der Volkskörper auf Volksdroge
Teil II
Beweisaufnahme: Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg
Das deutsche Heer entdeckt eine deutsche Droge
Vom Graubrot zum Hirnfood
Roboter
Burn-out
Moderne Zeiten
Zeit ist Krieg
»Klotzen, nicht kleckern«
Zeit ist Meth
Der Crystal-Fuchs
Doch Hitler begreift den Blitzkrieg nicht
Der Halt-Befehl von Dünkirchen – pharmakologische Interpretation
Der Dealer der Wehrmacht
Krieg und Vitamine
Flying high
Ein gefundenes Fressen für das Ausland
Teil III
Ortstermin: National Archives, Washington, D.C.
Die Bunkermentalität
Ostrausch
Ein ehemaliger Sanitätsoffizier erzählt
Planet Werwolf
Schlachthof Ukraine
»X« und der totale Realitätsverlust
Eukodal nehmen
Drogenumschlagplatz Geheimdienst
Patient D
Patient B
Das Attentat und seine pharmakologischen Folgen
Endlich Kokain!
Speedball
Der Ärztekrieg
Die Selbstauslöschung
Der Superbunker
Der Reißverschluss
Die Schuldfrage
Teil IV
Ortstermin: Sanitätsakademie der Bundeswehr, München
Die Suche nach der Wunderdroge
Dienstreise nach Sachsenhausen
Die Pillenpatrouille
Der ganz reale Untergang
Gehirnwäsche
Drogendämmerung
Last Exit Führerbunker
Die Entlassung
Das finale Gift
Morells Implosion
Der tausendjährige Rausch
Dank
Nachwort von Hans Mommsen: »Nationalsozialismus und der Verlust der politischen Realität«
Anhang
Bibliografie
Bildnachweis
Personen-, Sach- und Ortsregister
»Ein politisches System, das dem Untergang geweiht ist, tut instinktiv vieles, was diesen Untergang beschleunigt.«
Jean-Paul Sartre
Packungsbeilage statt Vorwort
Gestoßen bin ich auf den Stoff in Koblenz, und zwar in der nüchternen Umgebung des Bundesarchivs, eines Waschbetonbaus aus den Achtzigern. Der Nachlass von Theo Morell, des Leibarztes von Hitler, ließ mich nicht mehr los. Immer wieder durchblätterte ich Morells Tageskalender: kryptische Eintragungen, die sich auf einen »Patienten A« bezogen. Per Lupe versuchte ich, die kaum leserliche Handschrift zu entziffern. Die Seiten waren vollgekritzelt, häufig las ich Einträge wie »Inj. w. i.« oder einfach nur »x«. Ganz allmählich klarte das Bild auf: tägliche Injektionen, merkwürdige Substanzen, steigende Dosierungen.
Zum Krankheitsbild
Sämtliche Aspekte des Nationalsozialismus sind ausgeleuchtet. Unser Geschichtsunterricht lässt keine Lücken, unsere Medienwelt keine weißen Flecken. Bis in den letzten Winkel ist das Thema bearbeitet, von allen Ecken und Enden her. Die deutsche Wehrmacht ist die am besten untersuchte Armee aller Zeiten. Es gibt wirklich nichts, was wir über diese Zeit nicht zu wissen glauben. Das Dritte Reich wirkt hermetisch. Jeder Versuch, etwas Neues darüber zutage zu bringen, hat etwas Bemühtes, beinahe Lächerliches. Und doch begreifen wir nicht alles.
Zur Diagnose
Über Drogen im Dritten Reich ist in der Öffentlichkeit, aber auch bei Historikern erstaunlich wenig bekannt. Es gibt wissenschaftliche und journalistische Teilbearbeitungen, aber bislang keine Gesamtschau.[1] Eine umfassende und faktengenaue Darstellung, wie Rauschmittel die Geschehnisse im NS-Staat und auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkrieges geprägt haben, fehlte. Doch wer die Rolle der Drogen im Dritten Reich nicht versteht, die Bewusstseinszustände nicht auch in dieser Hinsicht untersucht, verpasst etwas.
Dass der Einfluss bewusstseinsverändernder Mittel auf das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte bislang zu wenig beachtet wurde, liegt am nationalsozialistischen Konzept der »Rauschgiftbekämpfung« selbst, das staatliche Kontrolle über die Substanzen etablierte und die Drogen im Allgemeinen tabuisierte. Sie haben sich folglich aus dem nüchternen Gesichtsfeld der Wissenschaften – umfassende Studien werden an Universitäten bis heute nicht durchgeführt –, des Wirtschaftslebens und des öffentlichen Bewusstseins sowie aus der Geschichtsbetrachtung verabschiedet und in eine Schmuddelecke der Schattenwirtschaft, Panscherei, Kriminalität und des laienhaften Halbwissens verdrückt.
Doch wir können Abhilfe schaffen und eine Interpretation der tatsächlichen Vorkommnisse versuchen, die sich mit der Aufhellung struktureller Bezüge befasst, dem Handwerklichen verpflichtet ist und statt steiler Thesen (die der historischen Realität und ihrer ernüchternden Grausamkeit Unrecht täten) einer detaillierten Erforschung der historischen Fakten dient.[2]
Potenz des Inhalts
Der totale Rausch geht den blutsvernarrten Massenmördern und ihrem folgsamen, von jedem Rassen- und sonstigen Gift zu reinigenden Volk unter die Haut und schaut direkt in die Arterien und Venen hinein. Arisch rein ging es darin nicht zu, eher chemisch deutsch – und ziemlich toxisch. Denn wo die Ideologie nicht mehr ausreichte, wurde trotz aller Verbote hemmungslos mit pharmakologischen Mitteln nachgeholfen, an der Basis wie in der Spitze. Hitler führte auch in dieser Hinsicht – und selbst die Armee wurde in großem Stile mit dem Aufputschmittel Methamphetamin (heute als »Crystal Meth« bekannt) für ihre Eroberungsfeldzüge versorgt. In ihrem Umgang mit den Drogen zeigen die Täter von damals eine Scheinheiligkeit, deren Enthüllung entscheidende Aspekte ihres Tuns neu beleuchtet. Eine Maske wird gelüftet, von der wir nicht einmal wussten, dass sie existierte.
Gefahren bei der Lektüre
Die Versuchung liegt immerhin nahe, dem Blick durch die Drogenbrille zu große Bedeutung zuzumessen und eine weitere Geschichtslegende zu konstruieren. Zu beachten gilt deshalb stets: Geschichtsschreibung ist niemals nur Wissenschaft, sondern immer auch Fiktion. Ein »Sachbuch« gibt es in dieser Disziplin streng genommen nicht, denn Fakten sind in ihrer Zuordnung Dichtung – oder zumindest den Deutungsmustern von externen kulturellen Einflüssen unterliegend. Sich bewusst zu machen, dass Historiografie im besten Falle Literatur ist, senkt die Täuschungsgefahr beim Lesen. Was hier präsentiert wird, ist eine unkonventionelle, verzerrte Perspektive, und die Hoffnung liegt darin, in der Verzerrung manches klarer zu erkennen. Die deutsche Geschichte wird nicht um- oder gar neu geschrieben. Aber im besten Fall in Teilen präziser erzählt.
Nebenwirkungen
Dieses Präparat kann Nebenwirkungen verursachen, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Häufig bis sehr häufig: Erschütterungen von Weltbildern, dadurch Irritationen des Großhirns, manchmal verbunden mit Übelkeit oder Bauchschmerzen. Diese Beschwerden sind meist leichter Natur und klingen oft während der Lektüre wieder ab. Gelegentlich: Überempfindlichkeitsreaktionen. Sehr selten: Schwere, anhaltende Störungen der Wahrnehmung. Als Gegenmaßnahme muss die Lektüre in jedem Fall bis zum Ende durchgeführt werden, um das Genesungsziel der angst- und krampflösenden Wirkung zu erreichen.
Wie ist dieses Buch aufzubewahren?
Für Kinder unzugänglich. Das Verfallsdatum bestimmt sich nach dem aktuellen Forschungsstand.
Teil I
Volksdroge Methamphetamin (1933–1938)
Der Nationalsozialismus war toxisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat der Welt ein chemisches Erbe bereitet, das uns heute noch betrifft: ein Gift, das nicht mehr so schnell verschwinden wird. Obwohl sich die Nazis als Saubermänner gaben, mit propagandistischem Pomp und drakonischen Strafen eine ideologisch unterfütterte strikte Antidrogenpolitik umsetzten, wurde unter Hitler eine besonders potente, besonders süchtig machende, besonders perfide Substanz zum populären Produkt. Ganz legal machte dieser Stoff als Pille unter dem Markennamen Pervitin in den Dreißigerjahren überall im Deutschen Reich und später auch in den besetzten Ländern Europas Karriere und wurde zur akzeptierten, in jeder Apotheke erhältlichen »Volksdroge«, die erst 1939 unter Rezeptpflicht gestellt und 1941 schließlich den Bestimmungen des Reichsopiumgesetzes unterworfen wurde.
Sein Inhaltsstoff, das Methamphetamin, ist heute weltweit illegal beziehungsweise streng reglementiert[3], gilt aber mit annähernd einhundert Millionen Konsumenten als eines der beliebtesten Gifte der Gegenwart, Tendenz steigend. Es wird in versteckten Labors vielfach von chemischen Laien meist verunreinigt hergestellt und von den Medien als »Crystal Meth« bezeichnet. Die kristalline Form der sogenannten Horrordroge erfreut sich – in häufig hohen Dosierungen bei meist nasaler Aufnahme – ungeahnter Popularität, gerade auch in Deutschland, wo es immer mehr Erstkonsumenten gibt. Das Aufputschmittel mit dem gefährlich starken Kick findet Verwendung als Partydroge, zur Leistungssteigerung am Arbeitsplatz, in den Büros und Parlamenten, an den Universitäten. Es vertreibt Schlaf und Hunger, verspricht Euphorie, doch ist es, zumal in seiner heutigen Darreichungsform[a], eine gesundheitsschädliche, den Menschen potenziell zerstörende Droge, die rasch süchtig machen kann. Kaum jemand kennt ihren Aufstieg im Dritten Reich.
Breaking Bad: die Drogenküche der Reichshauptstadt
Spurensuche im 21. Jahrhundert. Unter einem wie leer gefegten Sommerhimmel, der sich von Industrieanlagen zu geklont wirkenden Neubauhäuserreihen zieht, fahre ich mit der S-Bahn in Richtung Südosten, an den Rand von Berlin. Um die Überreste der Temmler-Werke aufzusuchen, den einstmaligen Hersteller des Pervitin, muss ich in Adlershof aussteigen, das sich heutzutage »Deutschlands modernster Technologiepark« nennt. Ich halte mich an diesem Campus abseits und schlage mich durch urbanes Niemandsland, an zerfallenen Fabrikgebäuden vorbei, durchquere eine Ödnis aus bröckelndem Backstein und rostigem Stahl.
Die Temmler-Werke siedelten sich 1933 hier an. Ein Jahr später, als Albert Mendel, jüdischer Miteigentümer der Chemischen Fabrik Tempelhof, enteignet wurde, übernahm Temmler dessen Anteil und expandierte rasch. Es waren gute Zeiten für die deutsche chemische Industrie, zumindest, wenn sie rein arisch war, und ganz besonders boomte die pharmazeutische Entwicklung. Unermüdlich wurde nach neuen bahnbrechenden Stoffen geforscht, die dem modernen Menschen Linderung seiner Schmerzen und Ablenkung von seinen Sorgen verschaffen sollten. Viel probierte man aus in den Labors und stellte pharmakologische Weichen, die unsere Wege bis heute prägen.
Mittlerweile ist die ehemalige Arzneimittelfabrik Temmler in Berlin-Johannisthal eine Ruine. Nichts erinnert an die prosperierende Vergangenheit, als hier Millionen von Pervitinpillen pro Woche gepresst wurden. Das Firmengelände ist unbenutzt, eine tote Liegenschaft. Ich überquere einen verödeten Parkplatz, muss durch ein wild gewuchertes Wäldchen hindurch und über eine Mauer hinweg, auf der noch immer Glasscherben zur Abwehr von Eindringlingen kleben. Zwischen Farnen und Schösslingen steht das alte, aus Holz errichtete »Hexenhäuschen« von Gründer Theodor Temmler, die einstige Keimzelle der Firma. Hinter dichtem Erlengesträuch ragt ein Backsteinbau auf, ebenfalls komplett verlassen. Ein Fenster ist so zerbrochen, dass ich hindurchsteigen kann. Im Innern geht es einen langen, dunklen Gang entlang. Muff und Moder dringen aus Wänden und Decken. Am Ende eine Tür, die halb offen steht. Ihr hellgrüner Anstrich platzt überall ab. Dahinter scheint von rechts Tageslicht durch zwei bleigefasste zerborstene Industriefenster herein. Draußen ist alles überwuchert – hier drinnen Leere. Ein altes Vogelnest liegt in der Ecke. Bis zur hohen Decke mit ihren kreisrunden Abzugslöchern sind weiße, teils abgeschlagene Kacheln gezogen.
Die Temmler-Werke in Berlin-Johannisthal, damals …
… und heute
Dies ist das ehemalige Labor von Dr. Fritz Hauschild, von 1937 bis 1941 Chef der Pharmakologie bei Temmler, der auf der Suche nach einer neuen Art von Arznei war, einem »leistungssteigernden Mittel«. Dies ist die frühere Drogenküche des Dritten Reichs. Hier köchelten die Chemiker mit Porzellantiegeln, Kondensatoren mit durchlaufenden Röhren und Glaskühlern ihren lupenreinen Stoff. Hier klapperten die Deckel der bauchigen Siedekolben und entließen mit zischendem Geräusch gelbroten heißen Dampf, während Emulsionen knackten und weiß behandschuhte Finger am Perkolator Einstellungen vornahmen. Methamphetamin entstand – und zwar in einer Qualität, die selbst der fiktionale Drogenkoch Walter White in der US-amerikanischen TV-Serie Breaking Bad, die Crystal Meth zum Symbol unserer Zeit stilisiert hat, in seinen besten Stunden nicht erreicht.
Wörtlich übersetzt bedeutet breaking bad so viel wie plötzlich sein Verhalten ändern und etwas Schlechtes tun. Vielleicht auch keine falsche Überschrift für die Jahre 1933 bis 1945.
Vorspiel im 19. Jahrhundert: die Urdroge
»Freiwillige Abhängigkeit ist der schönste Zustand.«
Johann Wolfgang von Goethe
Um die historische Relevanz dieser und anderer Drogen für die Geschehnisse im NS-Staat verstehen zu können, müssen wir zurückgehen. Die Entwicklungsgeschichte der modernen Gesellschaften ist an die Entstehungs- und Verteilungsgeschichte der Rauschmittel ebenso gekoppelt wie die Ökonomie an den Fortschritt der Technik. Ein Anfangspunkt: Im Jahre 1805 schrieb Goethe im klassizistischen Weimar seinen Faust und brachte mit dichterischen Mitteln eine seiner Thesen auf den Punkt, nach der die Genese des Menschen selbst drogeninduziert ist: Ich verändere mein Gehirn, also bin ich. Zur gleichen Zeit unternahm im weniger glamourösen westfälischen Paderborn der Apothekergehilfe Friedrich Wilhelm Sertürner Versuche mit dem Schlafmohn, dessen verdickter Saft, das Opium, die Schmerzen betäubt wie kein anderer Stoff. Goethe wollte auf poetisch-dramatischem Wege erkunden, was die Welt im Innersten zusammenhält – Sertürner hingegen ein handfestes jahrtausendealtes Problem lösen, das die Spezies mindestens ebenso tangierte.
Die konkrete Herausforderung für den einundzwanzig Jahre jungen, genialischen Chemiker: Je nach Wuchsbedingungen ist der Wirkstoff in der Mohnpflanze in sehr unterschiedlicher Konzentration vorhanden. Mal lindert ihr bitterer Saft die Pein nicht stark genug, mal kommt es zu ungewollter Überdosierung und Vergiftung. Ganz auf sich gestellt, ebenso wie der das opiumhaltige Laudanum konsumierende Goethe in seiner Dichterstube, machte Sertürner eine sensationelle Entdeckung: Es gelang ihm, das Morphin zu isolieren, jenes entscheidende Alkaloid des Opiums, eine Art pharmakologischen Mephisto, der Schmerz zu Wohlgefallen verzaubert. Es war ein Wendepunkt in der Geschichte nicht nur der Pharmazie, sondern eines der wichtigsten Ereignisse des beginnenden 19. Jahrhunderts, der Menschheitsgeschichte überhaupt. Der Schmerz, dieser unheimliche Begleiter, konnte nun präzise dosiert besänftigt, ja beseitigt werden. Apotheken überall in Europa, in denen bislang die Pharmazeuten nach bestem Wissen und Gewissen ihre Pillen aus den Zutaten des eigenen Gewürzgärtleins oder den Lieferungen des Kräuterweibleins gedreht hatten, entwickelten sich binnen weniger Jahre zu veritablen Manufakturen, in denen sich pharmakologische Standards etablierten.[b] Im Morphin steckte nicht nur Linderung vor allem Unbill des Lebens, sondern auch das große Geschäft.
In Darmstadt tat sich der Besitzer der Engel-Apotheke, Emanuel Merck, als Pionier dieser Entwicklung hervor und postulierte 1827 als Unternehmensphilosophie, Alkaloide und andere Arzneistoffe in stets gleicher Qualität liefern zu wollen. Es war die Geburtsstunde nicht nur der noch heute prosperierenden Firma Merck, sondern der deutschen pharmazeutischen Industrie überhaupt. Als um 1850 die Injektionsspritze erfunden wurde, konnte den Siegeszug des Morphins nichts mehr aufhalten. Massenhaft verwendete man den Schmerztöter im amerikanischen Bürgerkrieg 1861–65 ebenso wie im deutsch-französischen Krieg 1870/71. Dort ging bald gewohnheitsmäßig die Morphium-Fixe um.[4] Ihr Einfluss war entscheidend, im Guten wie im Schlechten. Zwar konnte die Pein selbst Schwerverletzter gebändigt werden – doch das machte Kriege im noch größeren Stil erst möglich: Die Kämpfer, früher durch eine Verwundung meist langfristig untauglich gemacht, wurden nun rascher wieder aufgepäppelt und nach Möglichkeit erneut in die vordersten Reihen befördert.
Mit dem Morphin, auch Morphium genannt, erreichte die Entwicklung der Schmerzbekämpfung und Betäubung einen entscheidenden Höhepunkt. Das betraf gleichermaßen die Armee wie die zivile Gesellschaft. Vom Arbeiter bis zum Adligen setzte das vermeintliche Allheilmittel sich durch, überall auf der Welt, von Europa über Asien bis Amerika. In den drugstores zwischen Ost- und Westküste der USA wurden zu dieser Zeit vor allem zwei Wirkstoffe rezeptfrei angeboten: Morphinhaltige Säfte stellten ruhig, während kokainhaltige Mischgetränke (wie in den Anfängen der Mariani-Wein, ein Bordeaux mit Coca-Extrakt, oder auch die Coca-Cola[c][5]) gegen Stimmungsleiden und als hedonistische Euphorika sowie zur Lokalanästhesie Verwendung fanden. Doch das war erst der Anfang. Rasch wollte die entstehende Industrie diversifizieren; neue Produkte mussten her. Am 10. August 1897 mischte Felix Hoffmann, ein Chemiker der Firma Bayer, aus einem Wirkstoff der Weidenrinde die Acetylsalicylsäure zusammen, die als Aspirin in den Handel kam und den Globus eroberte. Elf Tage später erfand derselbe Mann eine weitere Substanz, die ebenfalls weltberühmt werden sollte: Diacetylmorphin, ein Derivat des Morphins – die erste Designerdroge überhaupt. Unter dem Markennamen Heroin kam sie auf den Markt und trat ihren Siegeszug an. »Heroin ist ein schönes Geschäft«, verkündeten die Direktoren von Bayer stolz und vermarkteten das Mittel gegen Kopfschmerzen, Unwohlsein und sogar als Hustensaft für Kinder. Selbst Säuglingen könne es bei Darmkoliken oder Schlafproblemen gegeben werden.[6]
Fleischhacker, Wilhelm, »Fluch und Segen des Cocain«, in: Österreichische Apotheker-Zeitung, Nr. 26, 2006.
Das Geschäft brummte nicht nur bei Bayer. Gleich mehrere moderne Pharmaziestandorte entwickelten sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entlang des Rheins. Strukturell standen die Sterne günstig: Zwar gab es aufgrund der Kleinstaaterei im Deutschen Kaiserreich nur begrenzt Bankkapital und Risikobereitschaft für Großinvestitionen, doch genau das brauchte die chemische Industrie gar nicht, da sie im Vergleich zur traditionellen Schwerindustrie verhältnismäßig wenige Gerätschaften und Rohstoffe benötigte. Auch geringe Einsätze versprachen hohe Gewinnmargen. Es zählten vor allem Intuition und Sachverstand der Entwickler, und Deutschland, reich an Humankapital, konnte auf ein schier unerschöpfliches Potenzial an exzellent ausgebildeten Chemikern und Ingenieuren zurückgreifen, das sich aus dem damals noch besten Bildungssystem der Welt speiste. Das Netz aus Universitäten und technischen Hochschulen galt als vorbildlich: Wissenschaft und Wirtschaft arbeiteten Hand in Hand. Es wurde auf Hochtouren geforscht, eine Vielzahl an Patenten entwickelt. Deutschland wurde, gerade was die chemische Industrie anging, noch vor der Jahrhundertwende zur »Werkstatt der Welt« – und »Made in Germany« zum Gütesiegel, auch was Drogen betraf.
Deutschland, Land der Drogen
Das änderte sich nach dem Ersten Weltkrieg erst mal nicht. Konnten sich Frankreich und England natürliche Stimulanzien wie Kaffee, Tee, Vanille, Pfeffer und andere Naturheilmittel aus ihren Kolonien in Übersee beschaffen, mussten in Deutschland, das durch die Versailler Verträge seine (zumal vergleichsweise spärlichen) exterritorialen Besitztümer verlor, andere Wege gefunden, sprich künstlich produziert werden. Denn Anregungsmittel brauchte das Land: Das Kriegsdebakel hatte tiefe Wunden gerissen, mannigfaltige Schmerzen verursacht, körperliche wie psychische. In den Zwanzigerjahren gewannen Drogen für die niedergedrückte Bevölkerung zwischen Ostsee und Alpen kontinuierlich an Bedeutung. Und das Know-how für deren Produktion war vorhanden.
Die Weichen für eine moderne pharmazeutische Industrie waren also gestellt, und viele chemische Substanzen, die wir heute kennen, wurden in einer kurzen Zeitspanne entwickelt und zur Patentreife gebracht. Deutsche Firmen bauten sich die führende Position am Weltmarkt auf. Nicht nur produzierten sie die meisten Arzneien, auch lieferten sie den Löwenanteil der chemischen Grundstoffe für deren Herstellung überall auf der Welt. Eine New Economy entstand, ein Chemical Valley zwischen Oberursel und dem Odenwald. Zuvor unbekannte Klitschen prosperierten über Nacht, wurden zu einflussreichen Firmen. 1925 schlossen sich die großen Chemiefabriken zur IG Farben zusammen, aus dem Stand einem der mächtigsten Konzerne weltweit, mit Sitz in Frankfurt am Main. Vor allem Opiate waren noch immer deutsche Spezialität. 1926 stand das Land an der Spitze der Morphin produzierenden Staaten und war Exportweltmeister, was Heroin anging: 98 Prozent der Produktion gingen ins Ausland.[7] Von 1925 bis 1930 wurden 91 Tonnen Morphin hergestellt, 40 Prozent der Weltproduktion.[8] Nur unter Vorbehalt und dem Druck der Versailler Verträge unterzeichnete Deutschland 1925 das internationale Opiumabkommen des Völkerbundes, das den Verkehr regulierte. Erst 1929 kam es in Berlin zur Ratifikation. Die deutsche Alkaloidindustrie veredelte 1928 noch knapp 200 Tonnen Opium.[9]
Auch in einer anderen Stoffklasse führten die Deutschen: Die Firmen Merck, Boehringer und Knoll beherrschten 80 Prozent des Weltmarktes für Kokain. Vor allem Mercks Kokain aus Darmstadt galt auf dem gesamten Globus als Spitzenerzeugnis, sodass Produktpiraten in China die Etiketten millionenfach nachdruckten.[10] Für Rohkokain fungierte Hamburg als europäischer Hauptumschlagplatz: Jedes Jahr wurden Tausende von Kilogramm legal über den Hafen importiert. So verbrachte zum Beispiel Peru seine gesamte Jahresproduktion an Rohkokain, jeweils über fünf Tonnen, beinahe ausschließlich nach Deutschland zur Weiterverarbeitung. Die einflussreiche Interessenvertretung »Fachgruppe Opium und Kokain«, in der sich die deutschen Drogenhersteller zusammengeschlossen hatten, arbeitete unermüdlich an einer engen Verflechtung zwischen Regierung und chemischer Industrie. Zwei Kartelle, je aus einer Handvoll Firmen bestehend, teilten laut Kartellvertrag den lukrativen Markt des »gesamten Erdkreises«[11] unter sich auf: die sogenannte Kokainkonvention und die Opiatekonvention. Als geschäftsführend fungierte in beiden Fällen Merck.[12] Die junge Republik badete in bewusstseinsverändernden und rauscherzeugenden Substanzen, lieferte Heroin oder Kokain in alle vier Himmelsrichtungen und stieg zum globalen Dealer auf.
Die chemischen Zwanziger
Diese wissenschaftliche und ökonomische Entwicklung fand ihre Entsprechung auch im Zeitgeist. Künstliche Paradiese waren in der Weimarer Republik en vogue. Lieber flüchtete man sich in Scheinwelten, als sich mit der häufig weniger rosigen Realität auseinanderzusetzen – ein Phänomen, das diese erste Demokratie auf deutschem Boden geradezu definierte, politisch wie kulturell. Man wollte die wahren Gründe für die Kriegsniederlage nicht einsehen, verdrängte die Mitverantwortung des kaiserlich-deutschnationalen Establishments am Kriegsfiasko. Die böse Legende vom »Dolchstoß« machte die Runde: Das deutsche Militär habe nur deshalb nicht gesiegt, weil es aus dem eigenen Land, nämlich von der Linken, sabotiert worden sei.[13]
Diese Weltfluchttendenzen entluden sich häufig genug in blankem Hass wie im kulturellen Exzess. Nicht nur im Döblin’schen »Alexanderplatz«-Roman galt Berlin als die Hure Babylon, mit der schäbigsten Unterwelt aller Städte, die ihr Heil in den schlimmsten Ausschweifungen suchte, die man sich nur vorzustellen vermochte, und dazu gehörten nun einmal die Rauschmittel. »Das Berliner Nachtleben, Junge-Junge, so was hat die Welt noch nicht gesehen! Früher mal hatten wir eine prima Armee; jetzt haben wir prima Perversitäten!«, schrieb der Schriftsteller Klaus Mann.[14] Die Stadt an der Spree geriet zum Synonym für moralische Verwerflichkeit, und als die Währung aufgrund der massiven Ausweitung der Geldmenge zur Begleichung der Staatsschulden ins Bodenlose rutschte und im Herbst 1923 auf sage und schreibe 4,2 Billionen Mark zu einem US-Dollar fiel, schienen sämtliche moralischen Werte gleich mit zu verfallen.
Alles wirbelte in einem toxikologischen Taumel durcheinander. Die Ikone dieser Zeit, die Schauspielerin und Tänzerin Anita Berber, tauchte bereits zum Frühstück weiße Rosenblätter in einen Cocktail aus Chloroform und Äther, um sie abzulutschen: wake and bake. Filme über Kokain oder Morphium liefen in den Kinos, und an den Straßenecken gab es sämtliche Drogen rezeptfrei. Angeblich waren vierzig Prozent der Berliner Ärzte morphinsüchtig.[15] In der Friedrichstadt betrieben chinesische Händler aus dem ehemaligen Pachtgebiet Kiautschou Opiumhöhlen. Illegale Nachtlokale eröffneten in den Hinterzimmern von Mitte. Schlepper verteilten Flugblätter am Anhalter Bahnhof, warben für illegale Partys und »Schönheitsabende«. Große Clubs wie das berühmte Haus Vaterland am Potsdamer Platz, das für seine ausschweifende Promiskuität berüchtigte Ballhaus Resi in der Blumenstraße oder kleinere Etablissements wie die Kakadu-Bar oder die Weiße Maus, an deren Eingang Masken verteilt wurden, um die Anonymität der Gäste zu garantieren, zogen die Amüsierwilligen in Scharen an. Aus den westlichen Nachbarländern und den USA setzte eine frühe Form des Amüsier-und-Drogen-Tourismus ein – weil in Berlin alles so aufregend wie günstig war.
Weltkrieg verloren, alles erlaubt: Die Metropole mutierte zur Experimentierhauptstadt Europas. Plakate an Hauswänden warnten in greller expressionistischer Schrift: »Berlin, halte ein, besinne dich, dein Tänzer ist der Tod!«. Die Polizei kam nicht mehr hinterher; die Ordnung brach erst sporadisch, dann chronisch zusammen, und die Vergnügungskultur füllte das Vakuum, so gut sie konnte, wie ein populäres Lied aus jener Zeit illustriert:
Einst ward uns durch den Alkohol,
Das süße Ungeheuer,
Zu Zeiten kannibalisch wohl,
Doch jetzt kommt das zu teuer.
Und wir Berliner greifen drum
Zu Kokain und Morphium
Mag’s donnern drauß’ und blitzen,
Wir schnupfen und wir spritzen! (…)
Der Ober bringt im Restaurant
Das Kokadöschen gerne,
Dann lebt man ein paar Stunden lang
Auf einem besseren Sterne;
Das Morphium wirkt (subkutan)
Gar prompt auf das Zentralorgan,
Die Geister zu erhitzen
Wir schnupfen und wir spritzen!
Die Mittelchen sind zwar verwehrt
Durch das Gesetz von oben,
Doch was man offiziell entbehrt,
Wird heutzutag geschoben.
So kommt man leicht zur Euphorie
Und wenn uns wie das liebe Vieh
Die bösen Feinde rupfen
Wir spritzen und wir schnupfen!
Und spritzt man sich ins Irrenhaus
Und schnupft man sich zu Tode
Du lieber Gott, was macht das aus
In dieser Weltperiode!
Ein Narrenhaus ist ohnedies
Europa und ins Paradies
Mag Einer gern heut schlupfen
Durch Spritzen und durch Schnupfen![16]
1928 gingen allein in Berlin 73 Kilogramm Morphin und Heroin ganz legal auf Rezept in den Apotheken über den Ladentisch.[17] Wer es sich leisten konnte, konsumierte Kokain, die ultimative Waffe zum Intensivieren des Moments. Man schnupfte und empfand: Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Koks verbreitete sich überall und symbolisierte die ausschweifende Zeit. Als »Degenerationsgift« war es dagegen bei Kommunisten wie Nazis, die um die Macht auf den Straßen konkurrierten, gleichermaßen verpönt. Gegenreaktionen, was die freizügige Zeit anging, häuften sich. Deutschnationale gifteten gegen den »Verfall der Sitten«, aber auch aus dem konservativen Lager kamen solche Attacken. Selbst wenn man den Aufstieg Berlins zur Kulturmetropole mit Stolz aufnahm – gerade das Bürgertum, das in den Zwanzigerjahren an Status verlor, zeigte seine Verunsicherung durch radikale Verurteilung der Vergnügungs- und Massenkultur, die als dekadent westlich verschrien war.
Am ärgsten agitierten die Nationalsozialisten gegen die pharmakologische Heilsuche der Weimarer Zeit. Ihre unverhohlene Abkehr vom parlamentarischen System, von der verachteten Demokratie per se, wie auch von der urbanen Kultur einer sich öffnenden Gesellschaft fand in identitätsstiftenden Stammtischparolen gegen die vermeintlich verlotterten Zustände der verhassten »Judenrepublik« ihren Ausdruck.
Die Nazis hielten ihr eigenes Rezept für die Gesundung des Volkes parat und versprachen ideologische Heilung. Für sie konnte es nur einen legitimierten Rausch geben, den braunen. Denn auch der Nationalsozialismus strebte transzendente Zustände an: Die NS-Illusionswelt, in die die Deutschen gelockt werden sollten, nutzte von Anfang an Techniken des Rausches zur Mobilisierung. Weltgeschichtliche Entscheidungen, so stand es bereits in Hitlers Hetzschrift »Mein Kampf«, müssten während Zuständen von rauschhafter Begeisterung oder gegebenenfalls der Hysterie erzwungen werden. Die NSDAP bestach deshalb zum einen durch populistische Argumente, zum anderen durch Fackelläufe, Fahnenweihen, rauschhafte Kundgebungen und öffentliche Reden, die auf die Erreichung eines kollektiven Ekstasezustandes abzielten. Hinzu kamen die »Gewalträusche« der SA in der sogenannten Kampfzeit, häufig genug vom Alkoholmissbrauch befeuert.[d] Realpolitik tat man gern als unheroischen Kuhhandel ab: Eine Art gesellschaftlicher Rauschzustand sollte die Politik ersetzen.[18] Wenn die Weimarer Republik psychohistorisch als Verdrängergesellschaft gesehen werden kann, waren ihre vermeintlichen Antagonisten, die Nationalsozialisten, Speerspitze dieser Strömung. Die Drogen waren ihnen verhasst, denn sie wollten selbst wie eine wirken.
Machtwechsel heißt Substanzenwechsel
»… während der abstinente Führer schwieg«[19]
Günter Grass
Hitlers engstem Zirkel gelang es schon während der Weimarer Zeit, das Bild eines ununterbrochen arbeitenden Mannes zu etablieren, der seine Existenz komplett in den Dienst »seines« Volkes stellt. Eine unangreifbare Führungsfigur, einzig und allein mit der Herkulesaufgabe betraut, die gesellschaftlichen Widersprüche und Probleme in den Griff zu bekommen und die negativen Folgen des verlorenen Weltkrieges auszubügeln. Ein Mitstreiter Hitlers berichtete im Jahr 1930: »Er ist nur Genie und Körper. Und diesen Körper kasteit er, daß es unsereinen jammern kann! Er raucht nicht, er trinkt nicht, er ißt fast nur Grünzeug, er faßt keine Frau an.«[20] Nicht einmal Kaffee gönne sich Hitler. Nach dem Ersten Weltkrieg habe er seine letzte Packung Zigaretten bei Linz in die Donau geworfen; seitdem kämen keine Gifte mehr in seinen Körper.
»Wir Abstinenten haben – nebenbei erwähnt – eine besondere Ursache, unserem Führer dankbar zu sein, wenn wir bedenken, welch ein Vorbild seine persönliche Lebensführung und seine Stellung zu den Rauschgiften für jeden sein kann«, hieß es in der Mitteilung eines Abstinentenverbandes.[21] Der Reichskanzler: ein angeblich reiner Mensch, allen weltlichen Genüssen abhold, ohne Privatleben. Ein Dasein, von vermeintlicher Entsagung und dauerndem Opfer geprägt. Ein Vorbild für eine rundum gesunde Existenz. Der Mythos des Drogenfeindes und Abstinenzlers Hitler, der seine eigenen Bedürfnisse hintanstellt, war essenzieller Bestandteil der NS-Ideologie und wurde durch die Massenmedien immer wieder inszeniert. Ein Mythos entstand, der sich in der öffentlichen Meinung, aber auch bei kritischen Denkern festsetzte und bis heute nachhallt. Ein Mythos, den es zu dekonstruieren gilt.
In der Folge ihrer Machtergreifung am 30. Januar 1933 erstickten die Nationalsozialisten in kurzer Zeit die exaltierte Vergnügungskultur der Weimarer Republik mit all ihren Offenheiten und Ambivalenzen. Drogen wurden tabuisiert, da sie andere Irrealitäten erlebbar machten als die nationalsozialistischen. »Verführungsgifte«[22] hatten in einem System, in dem allein der Führer verführen sollte, keinen Platz mehr. Der Weg, den die Machthaber in ihrer sogenannten Rauschgiftbekämpfung beschritten, lag dabei weniger in einer Verschärfung des Opiumgesetzes, das man aus der Weimarer Zeit schlicht übernahm[23], sondern in mehreren neuen Verordnungen, die der nationalsozialistischen Leitidee der »Rassenhygiene« dienten. Dem Begriff »Droge«, der einmal ganz neutral »getrocknete Pflanzenteile« bedeutet hatte[e], wurden negative Werte zugeschrieben, Drogenkonsum stigmatisiert und – mithilfe der rasch ausgebauten entsprechenden Abteilungen der Kriminalpolizei – schwerstens geahndet.
Diese neue Akzentuierung griff bereits im November 1933, als der gleichgeschaltete Reichstag ein Gesetz verabschiedete, das die Zwangseinweisung Süchtiger in eine geschlossene Anstalt bis zu zwei Jahren ermöglichte, wobei dieser Aufenthalt durch richterlichen Beschluss unbegrenzt verlängert werden konnte.[24] Weitere Maßnahmen sahen vor, dass Ärzte, die Rauschmittel konsumierten, mit Berufsverbot von bis zu fünf Jahren belegt werden sollten. Was die Erfassung von Konsumenten illegaler Substanzen anging, galt das Ärztegeheimnis als aufgehoben. Der Vorsitzende der Berliner Ärztekammer ordnete an, dass jeder Arzt eine »Rauschgiftmeldung« zu erstatten habe, sobald ein Patient länger als drei Wochen Betäubungsmittel erhielt, denn »die öffentliche Sicherheit ist fast in jedem Fall von chronischem Alkaloidmißbrauch gefährdet«.[25] Ging eine solche Meldung ein, überprüften zwei Gutachter den Betreffenden. Befanden sie seine Erbanlagen für »in Ordnung«, kam es zu einer abrupten Zwangsentziehung. Während man in der Weimarer Republik noch den langsamen oder sanften Entzug bevorzugt hatte, wollte man nun zur Abschreckung den Abhängigen die Entzugsschmerzen nicht ersparen.[26] Fiel die Bewertung der Erbanlagen negativ aus, konnte ein Gericht die Einweisung auf unbestimmte Zeit anordnen. Drogenkonsumenten landeten bald auch in Konzentrationslagern.[27]
Die Erfassungskarte der Reichszentrale zur Bekämpfung von Rauschgiftvergehen konnte über Leben und Tod entscheiden.[28]
Zudem wurde jeder Deutsche aufgefordert, »Beobachtungen über etwa an Rauschgiftsucht leidende Angehörige und Bekannte mitzuteilen, damit sofort Abhilfe geschaffen werden kann«.[29] Karteien wurden erstellt, die eine lückenlose Erfassung ermöglichen sollten. Früh instrumentalisierten die Nazis also auch ihren Kampf gegen die Rauschmittel zum Ausbau eines Spitzelstaates. Bis in jeden Winkel des Reiches hinein exekutierte die Diktatur ihre sogenannte Gesundheitsführung: In allen Gauen gab es eine »Arbeitsgemeinschaft für Rauschgiftbekämpfung«. Darin betätigten sich Ärzte, Apotheker, Vertreter von Sozialversicherungen und der Justiz, der Armee und Polizei sowie der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt – und woben ein lückenloses Antidrogennetz. Dessen Fäden liefen im Reichsgesundheitsamt in Berlin zusammen, in der Hauptabteilung II des Reichsausschusses für Volksgesundheit. Eine »Pflicht zur Gesundheit« wurde postuliert, die mit der »totalen Eindämmung aller nachweisbaren Schäden körperlicher, geistiger und sozialer Art einhergehen will, die durch den Missbrauch sowohl von artfremden Giftstoffen wie auch durch Alkohol und Tabak entstehen könnten«. Zigarettenwerbung wurde stark eingeschränkt, und Drogenverbote sollten die »letzten noch vorhandenen Einbruchsstellen internationaler Lebensideale in unser Volk verrammeln«.[30]
Im Herbst 1935 wurde mit dem Ehegesundheitsgesetz die Hochzeit untersagt, wenn einer der Heiratswilligen an einer »geistigen Störung« litt. Betäubungsmittelsüchtige fielen automatisch in diese Kategorie und wurden als »psychopathische Persönlichkeiten« gebrandmarkt – und zwar ohne Aussicht auf Heilung. Dieses Eheverbot sollte eine »Ansteckung des Partners, sowie erblich bedingtes Suchtpotential« bei Kindern verhindern, denn bei »den Nachkommen von Rauschgiftsüchtigen (sei) eine erhöhte Anzahl von seelischen Abartigkeiten«[31] gefunden worden. Das Gesetz zur Verhinderung erbkranken Nachwuchses zog die brutale Konsequenz der Zwangssterilisation nach sich: »Aus rassenhygienischen Gründen müssen wir daher darauf bedacht sein, hochgradig Süchtige von der Fortpflanzung auszuschalten.«[32]
Es sollte noch schlimmer kommen. Unter dem propagandistisch verwendeten Begriff der Euthanasie wurden »kriminelle Geisteskranke«, zu denen auch Menschen zählten, die Drogen konsumierten, in den ersten Kriegsjahren ermordet. Die genaue Zahl lässt sich nicht mehr rekonstruieren.[33] Entscheidend für das Schicksal war hierbei die Beurteilung auf der jeweiligen Erfassungskarte: Ein Plus hieß Todesspritze oder Gaskammer, ein Minus gab noch einmal Aufschub. Wurde eine Überdosis Morphin zur Tötung verwendet, stammte diese mitunter aus der Reichszentrale zur Bekämpfung von Rauschgiftvergehen, die 1936 als erste reichsweite Drogenpolizeibehörde aus dem Berliner Rauschgiftdezernat hervorgegangen war. Unter den Selektionsärzten habe »eine berauschende Gehobenheit«[34] geherrscht. So diente die Antidrogenpolitik als Vehikel zur Ausgrenzung und Unterdrückung wie sogar zur Vernichtung von Randgruppen und Minderheiten.
Antidrogenpolitik als antisemitische Politik
»Der Jude hat mit den raffiniertesten Mitteln versucht, Geist und Seele des deutschen Menschen zu vergiften und das Denken auf einen undeutschen Weg, der ins Verderben führen mußte, zu leiten. (…) Diese jüdische Infektion, die zu einer Volkskrankheit und zum Volkstod führen konnte, restlos aus dem Volkskörper zu entfernen, ist ebenfalls eine Pflicht der Gesundheitsführung.«[35]
Ärzteblatt für Niedersachsen, 1939
Die rassistische Terminologie des Nationalsozialismus war von Anfang an von Sprachbildern des Infekts und des Giftes, vom Topos des Toxikums geprägt. Juden wurden mit Bazillen oder Erregern gleichgesetzt, es hieß, sie seien Fremdstoffe und vergifteten das Reich, machten den gesunden sozialen Organismus krank, weshalb es sie auszuscheiden beziehungsweise auszumerzen gelte. Hitler verkündete: »Es gibt da keinen Kompromiß mehr, weil es Gift für uns selber wäre.«[36]
Tatsächlich lag das Gift in der Sprache, die die Juden als Vorstufe zu ihrer späteren Ermordung zuerst dehumanisierte. Die Nürnberger Rassengesetze von 1935 und die Einführung des arischen Ahnenpasses manifestierten die Forderung nach Reinheit des Blutes – dies sei eines der höchsten und schutzbedürftigsten Güter des Volkes. So entstand eine Schnittstelle zwischen antisemitischer Hetze und Antidrogenpolitik. Nicht die Dosis bestimmte hier das Gift, sondern die Kategorie der Fremdheit, wie ein ebenso unwissenschaftlicher wie zentraler Satz des damals häufig als Standardwerk verwendeten Buches »Magische Gifte« vor Augen führt: »Die größte Giftwirkung entfalten stets die landesfremden, die rassefremden Berauschungsmittel.«[37] Juden und Drogen verschmolzen zu einer toxischen oder infektiologischen Einheit, die Deutschland bedrohte: »Seit Jahrzehnten war unserem Volk von marxistisch-jüdischer Seite eingeredet worden: ›Dein Körper gehört dir.‹ Das wurde dahin verstanden, daß in Geselligkeiten der Männer untereinander oder zwischen Männern und Frauen jegliche Alkoholmengen genossen werden durften, selbst auf Kosten der Gesundheit des Körpers. Gegen diese marxistisch-jüdische Auffassung steht unvereinbar die germanisch-deutsche, daß wir Träger des ewigen Erbgutes der Ahnen sind, und daß demnach unser Körper der Sippe und dem Volk gehört.«[38]
SS-Hauptsturmführer Kriminalkommissar Erwin Kosmehl, ab 1941 Leiter der Reichszentrale zur Bekämpfung von Rauschgiftvergehen, lag ganz auf Linie, als er behauptete, dass im internationalen Drogenhandel »Juden eine herausragende Stellung einnehmen«. Es gehe bei seiner Arbeit darum, »die internationalen Verbrecher, die häufig im Judentum ihre Wurzeln hatten, unschädlich zu machen«.[39] Das Rassenpolitische Amt der NSDAP behauptete, dass der jüdische Charakter per se drogenabhängig sei: Der intellektuelle Großstadtjude bevorzuge das Kokain oder das Morphium, um seine stets »aufgeregten Nerven« zu beruhigen und um sich ein Gefühl der Ruhe und inneren Sicherheit zu geben. Über jüdische Ärzte wurde kolportiert, dass sich unter ihnen »Morphinismus (…) außerordentlich häufig« finde.[40]
Vermischung von Rauschgiftbekämpfung und Judenhass – selbst im Kinderbuch
Im antisemitischen Kinderbuch »Der Giftpilz«[41] vereinigten die Nationalsozialisten ihre Feindbilder Jude und Droge zur rassenhygienischen Propaganda, die in den Schulen und Kinderzimmern des Reiches Verbreitung fand. Die Geschichte war exemplarisch, die Botschaft eindeutig: Die gefährlichen giftigen Pilze galt es auszusondern.
Indem die Auslesestrategien der Rauschgiftbekämpfung sich gegen ein als bedrohlich empfundenes Fremdes richteten, um alle auszugrenzen, die nicht dem gesellschaftlichen Ideal entsprachen, waren sie im Nationalsozialismus deshalb geradezu automatisch antisemitisch konnotiert. Wer Drogen konsumierte, litt unter einer »Auslandsseuche«[42]. Rauschmittelhändler wurden als skrupellos, gierig oder fremdvölkisch hingestellt, Drogenkonsum als »rassisch minderwertig« und sogenannte Rauschgiftkriminalität als eine der größten Bedrohungen der Gesellschaft.
Es ist erschreckend, wie familiär manche dieser Begriffe noch heute klingen. Während wir andere NS-Wortungetüme ausgetrieben haben, ist uns die Terminologie der Rauschgiftbekämpfung längst in Fleisch, Blut und Psyche übergegangen. Um jüdisch versus deutsch geht es heute nicht mehr – die gefährlichen Dealer werden nun anderen Kulturkreisen zugeschrieben. Und die äußerst politische Frage, ob unsere Körper uns gehören oder einem juristisch-gesellschaftlichen Geflecht aus sozial- und gesundheitspolitischen Interessen, ist noch immer virulent.
Der Promiarzt vom Kurfürstendamm
JUDE wurde während einer Nacht des Jahres 1933 an ein Praxisschild in der Bayreuther Straße in Berlin-Charlottenburg geschmiert. Der Name des Doktors, eines Facharztes für Haut- und Geschlechtskrankheiten, war am nächsten Morgen nicht mehr lesbar, nur noch seine Sprechstundenzeit: Werktags 11–1 und 5–7 Uhr außer Sonnabend-Nachmittag. Der übergewichtige, glatzköpfige Dr. Theodor Morell reagierte auf diese Attacke ebenso erbärmlich wie typisch[43]: Rasch trat er der NSDAP bei, um künftige Anfeindungen dieser Art zu entkräften. Denn Morell war kein Jude; aufgrund seines dunklen Teints hatte ihn die SA fälschlicherweise als solchen verdächtigt.
Nachdem er sich als Parteigenosse registriert hatte, lief Morells Praxis bald besser als je zuvor. Er vergrößerte sich und zog in die repräsentativen Räume eines Gründerzeitbaus Ecke Kurfürstendamm und Fasanenstraße. Wer mitmachte, der profitierte – Morell war das eine Lehre, die er bis zum Schluss nicht vergessen sollte. Mit Politik selbst hatte der dicke Hesse derweil nichts am Hut. Die Genugtuung, die sein Dasein lebenswert machte, ergab sich dann, wenn ein Patient sich nach einer Behandlung besser fühlte, brav das Honorar bezahlte und baldmöglich wiederkehrte. Damit all dies gewährleistet war, hatte Morell im Laufe der Jahre Strategien entwickelt, die ihm gegenüber den anderen Ku’damm-Ärzten, mit denen er um die wohlbetuchte Kundschaft buhlte, Vorteile verschaffte. Tatsächlich galt seine schicke Privatpraxis bald als eine der profitabelsten im Westen der Stadt. Ausgerüstet mit modernstem Hochfrequenz-Röntgengerät, mit Diathermie, Vierzellenbad, Bestrahlungsapparaten – zunächst alles vom Vermögen seiner Gattin Hanni erstanden –, gab sich bei Morell, der früher Schiffsarzt in den Tropen gewesen war, mit der Zeit die Prominenz der Reichshauptstadt die Klinke in die Hand. Ob es Max Schmeling war oder die Lebensgefährtin von Hans Albers, die Darstellerin Marianne Hoppe, diverse Grafen und Botschafter, erfolgreiche Sportler, Bonzen aus der Wirtschaft, Koryphäen aus der Wissenschaft, Politiker, die halbe Filmwelt: Alles pilgerte zu Morell, der sich auf neuartige Behandlungsmethoden spezialisierte oder – wie spöttische Zungen behaupteten – auf die Behandlung nicht existenter Krankheiten.
Tatsächlich gab es da ein Feld, auf dem der ebenso egozentrische wie bauernschlaue Modearzt als Pionier galt, und das waren die Vitamine. Man wusste damals noch wenig über diese unsichtbaren Helfer, die der Körper nicht selbst produzieren kann, die er aber für gewisse Stoffwechselvorgänge dringend benötigt. Direkt ins Blut gespritzt, wirken deshalb Vitaminzugaben in Fällen der Unterversorgung geradezu Wunder. Genau darin lag Morells Strategie, um seine Patienten bei der Stange zu halten, und falls Vitamine einmal nicht reichten, mischte er flugs ein Kreislaufstimulans in die Spritzenmischung hinein, bei Männern vielleicht etwas Testosteron mit anaboler Wirkung für Muskelaufbau und Potenz, bei den Damen einen Tollkirschenextrakt als Energiezusatz und für einen hypnotisch schönen Blick. Wenn eine melancholische Theaterschauspielerin ihn aufsuchte, um sich das Lampenfieber vor ihrer Premiere im Admiralspalast vertreiben zu lassen, zögerte Morell nicht, sondern griff mit seinen stark behaarten Händen nach der Nadel, und das Injizieren beherrschte er angeblich wie niemand sonst. Es gingen sogar Gerüchte, es sei unmöglich, seinen Einstich zu spüren – trotz der damaligen Größe des Bestecks.
Der Erfolg sprach sich über die Stadtgrenzen hinaus herum, und im Frühling 1936 klingelte sein Telefon im Behandlungszimmer, obwohl er seinen Sprechstundenhilfen kategorisch verboten hatte, ihn während der Visite zu stören. Doch dies war kein gewöhnlicher Anruf. Es war das »Braune Haus«, die Parteizentrale in München: ein gewisser Schaub am Apparat, der sich als Adjutant Hitlers vorstellte und ihn wissen ließ, dass Heinrich Hoffmann, der »Reichsbildberichterstatter der NSDAP«, an einer delikaten Krankheit litt. Es sei der Wunsch der Partei, dass Morell als prominenter und für seine Verschwiegenheit bekannter Facharzt für Geschlechtskrankheiten sich der Sache annehme. Einen Münchner Doktor wolle man in dieser Angelegenheit aus Gründen der Diskretion nicht konsultieren. Der Führer habe auf dem Flugplatz Gatow höchstpersönlich eine Maschine bereitgestellt, fügte Schaub schicksalsschwer hinzu.
Auch wenn Morell Überraschungen auf den Tod nicht ausstehen konnte – eine solche Einladung konnte er nicht ausschlagen. In München angekommen, stieg er auf Staatskosten im noblen Regina-Palast-Hotel ab, kurierte die bei Hoffmann diagnostizierte Nierenbeckenentzündung als Folge einer Gonorrhö – umgangssprachlich auch als Tripper bekannt – und wurde gemeinsam mit seiner Gattin von seinem einflussreichen Patienten zum Dank zur Nachkur nach Venedig eingeladen.
Zurück in München, gaben die Hoffmanns in ihrer Villa im vornehmen Viertel Bogenhausen ein Abendessen. Es gab Spaghetti mit Muskat, Tomatensoße an der Seite, grünen Salat – das Leibgericht von Adolf Hitler, der wie so häufig bei Hoffmann zu Gast und ihm bereits seit den Zwanzigerjahren eng verbunden war, als Hoffmann durch seine fotografischen Inszenierungen zum Führerkult und dem Aufstieg des Nationalsozialismus wesentlich beigetragen hatte. Hoffmann besaß das Urheberrecht auf wichtige Fotografien des Diktators, veröffentlichte zahlreiche Bildbände mit Titeln wie »Hitler, wie ihn keiner kennt« oder »Ein Volk ehrt seinen Führer« und erzielte Millionenauflagen damit. Zudem gab es noch einen weiteren, persönlicheren Grund, der die beiden Männer verband: Hitlers Geliebte Eva Braun hatte früher als Assistentin bei Hoffmann gearbeitet, und dieser hatte sie 1929 in seinem Münchner Fotogeschäft mit dem NS-Führer bekannt gemacht.
Hitler, der von Hoffmann viel Gutes über den jovialen Morell vernommen hatte, bedankte sich vor dem Abendessen für die Heilung seines alten Kameraden und bedauerte, den Doktor nicht schon früher getroffen zu haben, womöglich wäre dann sein Chauffeur Julius Schreck noch am Leben, der einige Monate zuvor an Hirnhautentzündung verstorben war. Morell reagierte nervös auf das Kompliment und bekam während des Spaghetti-Essens kaum ein Wort heraus. Der stets schwitzende Doktor mit dem vollen Gesicht und der dicken runden Brille auf der Knollennase wusste, dass er in höheren Kreisen als nicht gesellschaftsfähig galt. Seine einzige Chance auf Anerkennung waren seine Spritzen, und so horchte er auf, als Hitler im Laufe des Abends wie beiläufig über starke Magen- und Darmbeschwerden klagte, die ihn seit Jahren quälten. Hastig erwähnte Morell eine ungewöhnliche Kur, die Erfolg versprechen könnte. Hitler sah ihn prüfend an – und lud ihn mitsamt Gattin zu weiteren Konsultationen auf den Berghof ein, sein Domizil am Obersalzberg bei Berchtesgaden.
Dort gab der Diktator einige Tage später bei einem privaten Gespräch Morell gegenüber unumwunden zu, mit seiner Gesundheit so weit herunter zu sein, dass er kaum noch agieren könne. Dies liege an den falschen Behandlungen seiner bisherigen Ärzte, denen nichts anderes einfiele, als ihn hungern zu lassen. Wenn dann doch einmal ein reichhaltigeres Mahl auf dem Programm stehe, was bei ihm ja häufig der Fall sei, leide er sofort unter unsäglichen Blähungen, außerdem juckenden Ekzemen an beiden Beinen, sodass er mit Verbänden gehen müsse und keine Stiefel mehr tragen könne.
Morell glaubte sofort, die Ursache von Hitlers Beschwerden zu erkennen, und diagnostizierte eine abnormale Bakterienflora, die Fehlverdauungsvorgänge veranlasse. Er empfahl das Präparat Mutaflor, von dem befreundeten Freiburger Arzt und Bakteriologen Professor Alfred Nißle entwickelt: Bakterienstämme, die ursprünglich 1917 aus der Darmflora eines Unteroffiziers gewonnen worden waren, der den Krieg auf dem Balkan im Gegensatz zu vielen seiner Kameraden ohne Darmbeschwerden überstanden hatte. Die Bakterien gibt es in Kapseln, lebend, sie siedeln sich im Darm an, überwuchern und ersetzen dort alle anderen, möglicherweise Beschwerden verursachenden Stämme.[44] Das tatsächlich wirksame Konzept ging für Hitler, für den offenbar selbst innerkörperliche Vorgänge einen Kampf um Lebensraum darstellten, schlüssig auf. Überschwänglich versprach er, Morell ein Haus zu schenken, falls ihn Mutaflor tatsächlich kuriere, und ernannte den dicken Doktor zu seinem Leibarzt.
Als dieser seiner Gattin von der neuen Berufung berichtete, reagierte Hanni wenig begeistert. Mit dem Kommentar, das hätten sie doch nicht nötig, verwies sie auf die gut gehende Praxis am Kurfürstendamm. Womöglich ahnte sie bereits, dass sie ihren Ehemann künftig nur noch selten zu Gesicht bekommen würde. Denn zwischen Hitler und seinem Leibarzt bahnte sich ein Verhältnis an, das ganz und gar ungewöhnlich war.
Spritzencocktail für Patient A
»Er allein ist das Unerklärliche, das Geheimnis und der Mythos unseres Volkes.«[45]
Joseph Goebbels
Der Diktator scheute sich stets davor, von anderen berührt zu werden, und verweigerte Ärzten grundsätzlich eine nach den Ursachen seiner Beschwerden forschende Behandlung. Nie konnte er einem Spezialisten trauen, der mehr über ihn wusste als er selbst. Der gute alte Hausarzt Morell mit seiner harmlos-gemütlichen Ausstrahlung vermittelte ihm hingegen von Anfang an ein Gefühl von Sicherheit. Morell hatte gar nicht vor, in Hitler zu dringen, um irgendwelche verborgenen Gründe für gesundheitliche Probleme aufzuspüren. Das Eindringen der Nadel reichte ihm, substituierte das seriöse ärztliche Handeln, und wenn das Staatsoberhaupt zu funktionieren hatte und augenblickliche umgehende Beschwerdefreiheit bei allen gesundheitlichen Beeinträchtigungen verlangte, zögerte Morell bei Hitler ebenso wenig wie bei einer Schauspielerin am Metropol-Theater, sondern machte eine zwanzigprozentige Traubenzuckerlösung von Merck oder eine Vitaminspritze zurecht. Sofortige Symptombeseitigung lautete die Devise, die neben der Boheme Berlins auch »Patient A« goutierte, als den Morell seinen Neuzugang führte.
Hitler sprang auf die Geschwindigkeit an, mit der eine Zustandsverbesserung eintrat – meist noch während die Nadel in seiner Vene steckte. Das Argument seines Leibarztes überzeugte ihn: Für den Führer mit seinen mannigfaltigen Aufgaben sei der Energieverbrauch derart hoch, dass man nicht warten könne, bis ein Stoff per Tablette verabreicht durch den (ohnehin belasteten) Verdauungstrakt ins Blut finde. Hitler verstand: »Morell will mir heute nochmals eine große Jodspritze geben sowie eine Herz-, eine Leber-, eine Kalk- und eine Vitaminspritze. Das hat er in den Tropen gelernt, daß das Medikament in die Venen gespritzt werden muß.«[46]
Da der viel beschäftigte Herrscher beständig fürchtete, in seiner Einsatzfähigkeit eingeschränkt zu sein, nicht alles zu schaffen, und sich krankheitsbedingten Ausfall nicht leisten zu können glaubte, weil sonst keiner imstande sei, ihm Aufgaben abzunehmen, gewannen die unkonventionellen Behandlungsmethoden ab 1937 rasch an Bedeutung. Mehrere Injektionen täglich waren bald keine Seltenheit mehr. Hitler gewöhnte sich an den wiederholten Durchstich und das darauffolgende geheimnisvolle Fließen einer vermeintlich potenten Substanz in seinen Adern. Jedes Mal fühlte er sich momentan besser danach. Die feine Nadel aus Edelstahl, die die Haut penetrierte und zu einer »Sofortherstellung« führte, entsprach seinem Naturell: Die Lage erforderte ständig geistige Frische, körperliche Vitalität, zupackende Entschlusskraft. Neurotische oder andere psychische Hemmungen mussten dauerhaft wie auf Knopfdruck ausgeschaltet bleiben und er selbst jederzeit aufgefrischt sein.
Bald schon durfte der neue Leibarzt seinem Patienten nicht mehr von der Seite weichen, und die Befürchtungen von Hanni Morell bewahrheiteten sich: Ihr Gatte hatte für seine Berliner Praxis keine Zeit mehr. Am Kurfürstendamm musste eine Vertretung eingestellt werden, und Morell behauptete später einmal, oszillierend zwischen Stolz und Fatalismus, er sei der einzige Mensch, der Hitler seit 1936 jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag gesehen habe.
Vor jeder großen Rede genehmigte sich der Reichskanzler jetzt eine »Kraftspritze«, um optimal zu funktionieren. Das Aufkommen von Erkältungen, die sein öffentliches Auftreten hätten behindern können, wurde bereits im Vorfeld durch intravenöse Vitaminbeigabe ausgeschlossen. Um den Arm beim »deutschen Gruß« möglichst lange oben halten zu können, machte Hitler einerseits Expandertraining und ließ andererseits seinen Körper Traubenzucker und Vitamine naschen. Die intravenös verabreichte Glukose sorgte nach zwanzig Sekunden für einen Energieschub im Gehirn, die kombinierten Vitamine ließen Hitler auch an kältesten Tagen in dünner SA-Uniform vor seinen Truppen oder dem Volk ohne Zeichen von körperlicher Schwäche Paraden abnehmen. Als er beispielsweise 1938 vor einer Rede in Innsbruck plötzlich heiser wurde, behob Morell diesen Missstand rasch mit einer Injektion.
Auch die Verdauungsbeschwerden besserten sich zunächst. Also wurde das versprochene Haus für den Leibarzt fällig – und zwar auf Berlins nobler Havelinsel Schwanenwerder, in direkter Nachbarschaft zu Propagandaminister Goebbels. Als komplettes Geschenk gab es die repräsentative Villa zwar nicht: Die Morells mussten das von einem handgeschmiedeten Eisenzaun umgebene Anwesen Inselstraße 24–26[f] für 338000 Reichsmark selbst kaufen, erhielten allerdings von Hitler ein zinsloses Darlehen über 200000 RM, das später als Behandlungshonorar verrechnet wurde. Das neue Heim brachte für den Promiarzt, der nun in die A-Liga aufgestiegen war, nicht nur Vorteile: Morell musste Haushaltskräfte anstellen und einen Gärtner; seine Fixkosten stiegen sprunghaft an, obwohl er nicht automatisch mehr verdiente. Aber er konnte jetzt nicht mehr zurück. Zu sehr genoss er seinen neuen Lebensstil, die unverstellte Nähe zur Macht.
Auch Hitler hatte sich an den Doktor mehr als gewöhnt, und die Kritik an dem korpulenten Mann, den viele im hart umkämpften Führerumfeld unappetitlich fanden, bürstete der Reichskanzler trocken ab: Morell sei nicht zum Beriechen da, sondern um ihn gesund zu halten. Kraft seines Amtes ernannte er den früheren Modearzt, um ihm einen Anstrich von Seriosität zu verpassen, 1938 ohne Habilitation zum Professor.