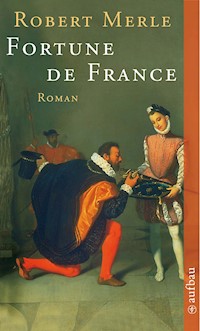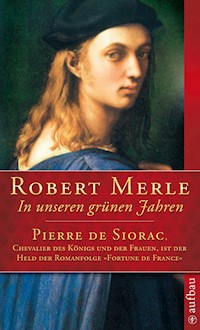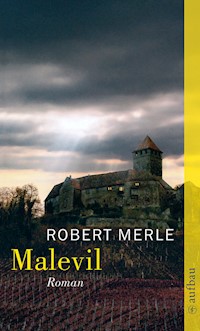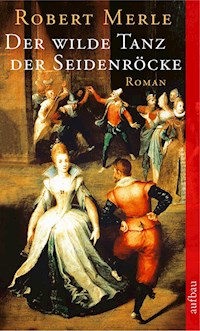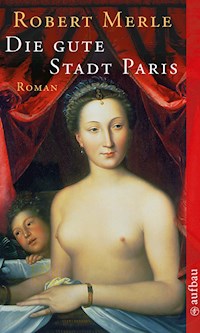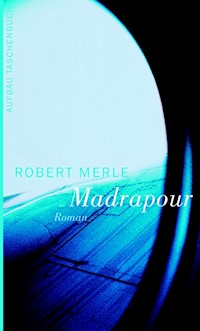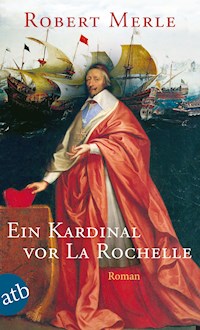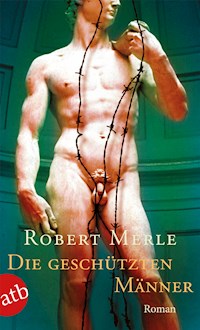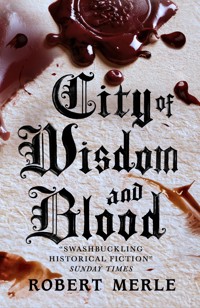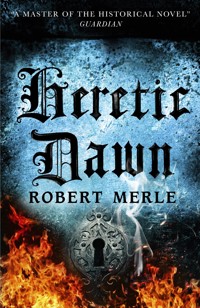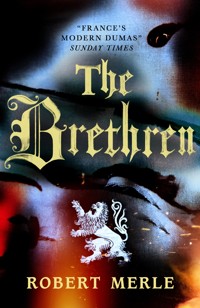9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von der Banalität des Bösen.
Inspiriert vom Tagebuch des Lagerkommandanten Rudolf Höß schrieb Merle diesen ersten Holocaust-Roman aus Tätersicht, der ihn weltberühmt machte. Die einzigartige Psychostudie eines Massenmörders aus Gründlichkeit und Gehorsam erschüttert selbst ein halbes Jahrhundert nach ihrem Erscheinen noch in ihrer schonungslosen, banalen Logik.
„Wann endlich wird man den Mut haben, diesen Roman als unverzichtbare Ergänzung zu Hannah Arendts ›Bericht von der Banalität de Bösen‹ zu sehen?“ Le Monde.
"Dieser Roman ist genau das, was an Littell gerühmt wird: groß und kalt." Die Welt.
„Ein grausiges Buch, das man gelesen haben muss." Stuttgarter Zeitung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über Robert Merle
Robert Merle wurde 1908 in Tébessa in Algerien geboren. Nach Schule und Studium in Frankreich war er von 1940 bis 1943 in deutscher Kriegsgefangenschaft. 1949 erhielt er den Prix Goncourt für seinen ersten Roman »Wochenende in Zuydcoote«, 1952 gelang ihm ein weltweiter Erfolg mit »Der Tod ist mein Beruf«. Robert Merle starb im März 2004 in seinem Haus in Montfort-l’Amaury in der Nähe von Paris.
Informationen zum Buch
Von der Banalität des Bösen
Inspiriert vom Tagebuch des Lagerkommandanten Rudolf Höß schrieb Merle diesen ersten Holocaust-Roman aus Tätersicht, der ihn weltberühmt machte. Die einzigartige Psychostudie eines Massenmörders aus Gründlichkeit und Gehorsam erschüttert selbst ein halbes Jahrhundert nach ihrem Erscheinen noch in ihrer schonungslosen, banalen Logik.
»Wann endlich wird man den Mut haben, diesen Roman als unverzichtbare Ergänzung zu Hannah Arendts ›Bericht von der Banalität de Bösen‹ zu sehen?« Le Monde
»Dieser Roman ist genau das, was an Littell gerühmt wird: groß und kalt.« Die Welt
»Ein grausiges Buch, das man gelesen haben muss.« Stuttgarter Zeitung
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Robert Merle
Der Tod ist mein Beruf
Roman
Aus dem Französischen von Curt Noch
Inhaltsübersicht
Über Robert Merle
Informationen zum Buch
Newsletter
1913
1916
1918
1922
1929
1934
1945
Nachbemerkung
Impressum
Wem kann ich dieses Buch widmen,
wenn nicht den Opfern jener,
deren Beruf der Tod ist?
1913
Ich bog um die Ecke der Kaiserallee, böiger Wind und eiskalter Regen schlug an meine nackten Beine, und ich dachte voll Angst daran, daß Sonnabend war. Die letzten Meter legte ich im Laufschritt zurück, verschwand im Hausflur, raste die fünf Treppen hinauf und klopfte zweimal leicht.
Mit Erleichterung erkannte ich den schleppenden Schritt der dicken Maria. Die Tür ging auf, Maria strich ihre graue Locke nach oben, ihre guten blauen Augen sahen mich an, sie beugte sich zu mir nieder und sagte leise und verstohlen: »Du kommst aber spät.«
Und mir war es, als stände Vater vor mir, schwarz und mager, und sagte in seiner abgerissenen Redeweise: »Pünktlichkeit – ist eine deutsche Tugend – mein Herr!«
Ich flüsterte: »Wo ist er?«
Maria schloß behutsam die Vorsaaltür.
»In seinem Arbeitszimmer. Er macht die Geschäftsabrechnung.« Sie setzte hinzu: »Ich habe dir deine Hausschuhe mitgebracht. Da brauchst du nicht erst in dein Zimmer zu gehen.«
Ich mußte an Vaters Arbeitszimmer vorbei, wenn ich in mein Zimmer wollte. Ich kniete mit einem Bein nieder und fing an, meine Schuhe aufzuschnüren. Maria stand dabei, massig und unbeweglich. Ich hob den Kopf und sagte: »Und meine Schultasche?«
»Die nehm ich selber mit. Ich habe noch dein Zimmer zu bohnern.«
Ich zog meine Windjacke aus, hängte sie neben Vaters großen schwarzen Mantel und sagte: »Danke schön, Maria.«
Sie schüttelte den Kopf, ihre graue Locke fiel wieder auf die Augen herunter, und sie klopfte mir auf die Schulter.
Ich konnte zur Küche gelangen, öffnete leise die Tür und schloß sie hinter mir. Mama stand am Ausguß und wusch.
»Guten Abend, Mama.«
Sie drehte sich um, ihre blassen Augen blickten über mich weg, sie sah nach der Uhr auf dem Küchenschrank und sagte in ängstlichem Ton: »Du kommst aber spät.«
»Es waren heute viele Schüler zur Beichte. Und nachher hat mich Pater Thaler zurückbehalten.«
Sie fing wieder an zu waschen, und ich sah nur noch ihren Rücken. Sie fuhr fort, ohne mich anzusehen: »Deine Schüssel und deine Lappen sind auf dem Tisch da. Deine Schwestern sind schon bei der Arbeit. Beeile dich.«
»Ja, Mama.«
Ich nahm die Schüssel und die Lappen und ging auf den Korridor. Ich ging langsam, um das Wasser in der Schüssel nicht zu verschütten.
Ich kam am Eßzimmer vorbei, die Tür stand offen, Gerda und Bertha standen auf Stühlen am Fenster. Sie kehrten mir den Rücken zu. Dann ging ich am Salon vorbei und in Mamas Zimmer. Maria stellte den Schemel vors Fenster. Sie hatte ihn für mich aus der Rumpelkammer geholt. Ich sah sie an und dachte: ›Danke schön, Maria‹, aber ich öffnete den Mund nicht. Man durfte nicht sprechen, wenn man Fenster putzte.
Nach einer Weile trug ich den Schemel in Vaters Zimmer, holte die Schüssel und die Lappen herüber, kletterte auf den Schemel und machte mich ans Putzen. Ein Zug pfiff, die Eisenbahnstrecke drüben füllte sich lärmend mit Rauch, ich ertappte mich dabei, daß ich mich zum Fenster hinausbeugen wollte, um zuzuschauen, und sagte ganz leise voller Entsetzen: »Lieber Gott, gib, daß ich nicht auf die Straße hinausgesehen habe.« Dann setzte ich hinzu: »Lieber Gott, gib, daß ich beim Fensterputzen keinen Verstoß begehe.«
Danach sprach ich ein Gebet, fing an, halblaut einen Choral zu singen, und fühlte mich etwas wohler.
Als Vaters Fenster fertig waren, wollte ich in den Salon gehen. Am Ende des Korridors tauchten plötzlich Gerda und Bertha auf. Sie kamen hintereinander, jede mit ihrer Schüssel in der Hand. Sie wollten nun das Fenster ihres Zimmers drannehmen. Ich stellte den Schemel an die Wand, machte mich dünn, sie gingen an mir vorüber, und ich wandte den Kopf weg. Ich war der Älteste, aber sie waren größer als ich.
Ich stellte den Schemel vor das Fenster des Salons und kehrte in Vaters Zimmer zurück, um die Schüssel und die Lappen zu holen; in einer Ecke setzte ich sie ab. Ich bekam Herzklopfen, schloß die Tür und betrachtete die Porträts. Es waren die drei Brüder, und Vaters Onkel, sein Vater und sein Großvater: Offiziere alle, alle in großer Uniform. Das Porträt meines Großvaters betrachtete ich länger: Er war Oberst gewesen, und man behauptete, ich sähe ihm ähnlich.
Ich öffnete das Fenster und kletterte auf den Schemel; der Wind und der Regen drangen herein. Ich stand auf Vorposten und spähte im Sturm nach dem sich nähernden Feind aus. Dann wechselte die Szene, ich befand mich auf einem Kasernenhof und wurde von einem Offizier bestraft; der Offizier hatte die leuchtenden Augen und das hagere Gesicht von Vater; ich stand still und sagte ehrerbietig: »Jawohl, Herr Hauptmann!« Ein Prickeln lief mir über den Rücken, mein Lappen fuhr mit mechanischen Bewegungen kräftig über die Scheiben, und ich fühlte die starren Blicke der Offiziere meiner Familie mit wollüstigem Behagen auf Schulter und Rücken.
Als ich fertig war, trug ich den Schemel in die Rumpelkammer, holte Schüssel und Lappen und ging in die Küche.
Mama sagte, ohne sich umzudrehen: »Setz dein Zeug ab und wasch dir hier die Hände.«
Ich trat an den Ausguß, Mama machte mir Platz, ich tauchte die Hände ins Wasser, es war heiß. Vater hatte uns verboten, uns in heißem Wasser zu waschen, und ich sagte leise: »Aber das Wasser ist ja heiß.«
Mama seufzte, nahm die Schüssel, goß sie wortlos im Ausguß aus und drehte den Wasserhahn auf. Ich nahm die Seife, Mama trat beiseite und wandte mir zur Hälfte den Rücken zu, die rechte Hand auf den Ausgußrand gestützt und die Augen fest auf den Küchenschrank gerichtet. Ihre rechte Hand zitterte leicht.
Als ich fertig war, hielt sie mir den Kamm hin und sagte, ohne mich anzusehen: »Kämm dich!«
Ich stellte mich vor den kleinen Spiegel, hörte, wie Mama wieder das Waschfaß in den Ausguß stellte, betrachtete mich im Spiegel und fragte mich, ob ich meinem Großvater ähnlich sähe oder nicht. Es war für mich wichtig, das zu wissen, denn wenn ja, konnte ich hoffen, wie er Oberst zu werden.
Mutter sagte hinter meinem Rücken: »Der Vater erwartet dich.«
Ich legte den Kamm auf den Schrank und fing an zu zittern.
»Leg den Kamm nicht auf den Schrank«, sagte Mama.
Sie tat zwei Schritte, nahm den Kamm, wischte ihn an der Schürze ab und legte ihn in die Schublade des Küchenschranks. Ich sah sie verzweifelt an, ihr Blick glitt über mich weg, sie kehrte mir den Rücken zu und nahm wieder ihren Platz vor dem Ausguß ein.
Ich ging hinaus und langsamen Schritts nach dem Arbeitszimmer meines Vaters. Auf dem Korridor kam ich wieder an meinen Schwestern vorbei. Sie warfen mir tückische Blicke zu, und ich begriff, daß sie erraten hatten, wohin ich ging.
Ich blieb vor der Tür des Arbeitszimmers stehen, bemühte mich mit aller Gewalt, nicht mehr zu zittern, und klopfte an. Vaters Stimme rief: »Herein!«, ich öffnete die Tür, schloß sie wieder und nahm Haltung an.
Sofort drang eine eisige Kälte durch meine Kleider hindurch bis auf die Knochen. Vater saß an seinem Schreibtisch, dem weit offenstehenden Fenster gegenüber. Er drehte mir den Rücken zu und rührte sich nicht. Ich verharrte im Stillgestanden. Der Wind trieb Regenböen ins Zimmer, und vor dem Fenster war eine kleine Pfütze.
Vater sagte in seiner abgerissenen Sprechweise: »Komm her – setz dich.«
Ich ging hin und setzte mich auf einen kleinen niedrigen Stuhl links von ihm. Vater ließ seinen Sessel herumschwingen und sah mich an. Seine Augen lagen noch tiefer als gewöhnlich, und sein Gesicht war so mager, daß man alle Muskeln hätte einzeln zählen können. Die kleine Schreibtischlampe brannte, und ich war glücklich, im Schatten sitzen zu können.
»Frierst du?«
»Nein, Vater.«
»Du – zitterst doch nicht – hoffe ich?«
»Nein, Vater.« Und ich bemerkte, daß es ihm selbst sehr schwerfiel, sein Zittern zu unterdrücken. Sein Gesicht und seine Hände waren blau.
»Bist du fertig – mit Fensterputzen?«
»Ja, Vater.«
»Hast du – dabei gesprochen?«
»Nein, Vater.« Er senkte wie geistesabwesend den Kopf, und da er nichts mehr sagte, fügte ich hinzu: »Ich habe einen Choral gesungen.«
Er hob den Kopf wieder und sagte: »Begnüge dich damit – auf meine Fragen – zu antworten.«
»Ja, Vater.«
Er fuhr in seinem Verhör fort, aber zerstreut, gleichsam aus bloßer Gewohnheit: »Haben deine Schwestern – gesprochen?«
»Nein, Vater.«
»Hast du – Wasser verschüttet?«
»Nein, Vater.«
»Hast du – auf die Straße gesehen?«
Ich zögerte eine Viertelsekunde.
»Nein, Vater.«
Er sah mich fest an.
»Gib gut acht. Hast du – auf die Straße gesehen?«
»Nein, Vater.«
Er schloß die Augen. Er mußte wirklich zerstreut sein. Sonst hätte er mich nicht so schnell davonkommen lassen.
Ein Schweigen entstand. Sein großer steifer Körper bewegte sich auf dem Sessel hin und her. Der Regen drang mit böartigen Windstößen ins Zimmer, und ich fühlte, daß mein linkes Knie naß war. Die Kälte ging mir durch und durch, aber es war nicht die Kälte, unter der ich litt. Es war die Furcht, Vater könnte bemerken, wie ich wieder zu zittern anfing.
»Rudolf – ich habe mit dir zu reden.«
»Ja, Vater.«
Er wurde von einem entsetzlichen Husten geschüttelt. Dann sah er zum Fenster hin, und ich hatte den Eindruck, er wollte aufstehen, um die Flügel zuzuschlagen. Aber er besann sich anders und fuhr fort: »Rudolf – ich habe mit dir – über deine Zukunft zu reden.«
»Ja, Vater.«
Eine ganze Weile saß er schweigend da und sah nach dem Fenster hin. Seine Hände waren blau vor Kälte, aber er gestattete sich keine Bewegung.
»Vorher – wollen wir – beten.«
Er stand auf, und ich stand auch auf. Er trat vor das Kruzifix, das hinter dem kleinen niedrigen Stuhl an der Wand hing, und kniete auf dem Fußboden nieder. Ich kniete ebenfalls nieder, nicht neben, sondern hinter ihm. Er machte das Zeichen des Kreuzes und begann, langsam, deutlich und ohne eine Silbe auszulassen, ein Vaterunser zu sprechen. Seine Sprechweise war nicht mehr abgerissen, wenn er betete.
Ich hielt meine Augen fest auf die große, steife Gestalt gerichtet, die vor mir kniete, und wie immer hatte ich das Empfinden, daß mein Gebet sich viel mehr an sie als an Gott wandte.
Vater sagte mit fester Stimme amen und stand auf. Ich stand gleichfalls auf. Er setzte sich wieder an seinen Schreibtisch.
»Setz dich.«
Ich nahm wieder auf meinem kleinen Stuhl Platz. In meinen Schläfen hämmerte es.
Er sah mich eine ganze Weile an, und ich hatte den außergewöhnlichen Eindruck, daß es ihm an Mut gebrach zu sprechen. Während dieses Zögerns hörte der Regen plötzlich auf. Sein Gesicht erhellte sich, und ich wußte, was geschehen würde.
Vater stand auf und schloß das Fenster: Gott selbst hatte der Strafe ein Ende gesetzt.
Vater setzte sich wieder, und mir schien es, als hätte er neuen Mut geschöpft.
»Rudolf«, sagte er, »du bist dreizehn Jahre – und du bist in dem Alter – es zu verstehen. Gott sei Dank – bist du verständig – und dank mir – oder vielmehr«, fuhr er fort, »dank der Erleuchtung, die Gott mir – betreffs deiner Erziehung – hat zuteil werden lassen – bist du – in der Schule – ein guter Schüler. Denn ich habe dich gelehrt – Rudolf – ich habe dich gelehrt – deine Pflicht zu tun – so wie du die Fenster putzt – gründlich!«
Er schwieg eine Viertelsekunde und fuhr mit lauter Stimme, fast schreiend, fort: »Gründlich!«
Ich begriff, daß ich etwas sagen mußte, und antwortete mit schwacher Stimme: »Ja, Vater.« Seitdem das Fenster geschlossen war, kam es mir vor, als wäre es im Zimmer noch kälter.
»Ich werde also – dir sagen – was ich – betreffs deiner Zukunft – beschlossen habe. – Aber ich will«, fuhr er fort, »daß du – die Gründe – meines Entschlusses – erfährst und verstehst.«
Er hielt inne, preßte seine Hände gegeneinander, und seine Lippen fingen an zu beben.
»Rudolf – einst habe ich – einen Fehltritt begangen.«
Ich sah ihn verblüfft an.
»Und damit du – meinen Entschluß verstehst – muß ich heute – muß ich – dir meinen Fehltritt mitteilen. Einen Fehltritt – Rudolf – eine Sünde – so groß – so entsetzlich – daß ich nicht hoffen kann – nicht hoffen darf – daß Gott mir verzeiht – wenigstens nicht in diesem Leben …«
Er schloß die Augen, seine Lippen zuckten krampfhaft, und er sah so verzweifelt aus, daß es mich im Halse würgte und ich ein paar Minuten lang aufhörte zu zittern.
Vater löste mit Anstrengung seine Hände und legte sie flach auf die Knie.
»Du kannst dir wohl denken – wie peinlich – es mir ist – mich vor dir – so zu erniedrigen – zu demütigen. Aber auf meine Leiden – kommt es nicht an. Ich bin nichts.«
Er schloß die Augen und wiederholte: »Ich bin nichts.«
Das war seine Lieblingsredensart, und jedesmal, wenn er sie gebrauchte, fühlte ich mich schrecklich unsicher und schuldig, als ob um meinetwillen das sozusagen göttliche Geschöpf, das mein Vater war, »ein Nichts« wäre.
Er schlug die Augen auf und blickte ins Leere.
»Rudolf – einige Zeit – genauer einige Wochen – vor deiner Geburt – habe ich mich – meiner Geschäfte wegen …«, er sprach mit Ekel, »nach Frankreich begeben müssen – nach Paris …«
Er hielt inne, schloß die Augen, und jedes Zeichen des Lebens schwand aus seinem Gesicht.
»Paris, Rudolf, ist die Hauptstadt aller Laster!«
Mit einem Ruck richtete er sich in seinem Sessel auf und starrte mich mit haßerfüllten Augen an.
»Verstehst du das?«
Ich hatte es nicht verstanden, aber sein Blick schreckte mich, und ich sagte mit erloschener Stimme: »Ja, Vater.«
»Gott«, fuhr er mit leiser Stimme fort, »suchte in seinem Zorn – meinen Körper und meine Seele heim.«
Er blickte ins Leere.
»Ich wurde krank«, sagte er in einem Ton unglaublichen Ekels, »ich pflegte mich und genas – aber die Seele genas nicht.« Und er fing plötzlich an zu schreien: »Sie sollte nicht genesen!«
Es entstand ein langes Schweigen, dann schien er wieder zu bemerken, daß ich da war.
»Du zitterst?« fragte er mechanisch.
»Nein, Vater.«
Er fuhr fort: »Ich kehrte zurück – nach Deutschland. Ich gestand meinen Fehltritt deiner Mutter – und entschloß mich – von nun an – zu meinen eigenen Fehlern – die Fehler meiner Kinder – und meiner Frau – auf mich zu nehmen – und Gott um Verzeihung zu bitten – für ihre wie für meine.«
Nach einer Weile fing er wieder an zu sprechen, und es war, als ob er betete. Seine Stimme war nicht mehr abgerissen.
»Schließlich versprach ich der Heiligen Jungfrau feierlich, daß, wenn das Kind, das wir erwarteten, ein Sohn wäre, ich ihn ihrem Dienst widmen würde.«
Er blickte mir in die Augen.
»Die Heilige Jungfrau wollte – daß es ein Sohn war.«
Ich hatte eine Anwandlung unerhörter Kühnheit: ich erhob mich.
»Setz dich!« sagte er, ohne die Stimme zu heben.
»Vater …«
»Setz dich!«
Ich setzte mich wieder.
»Wenn ich fertig bin, kannst du sprechen.«
Ich sagte: »Ja, Vater«, aber ich wußte schon, daß, wenn er fertig war, ich nicht mehr sprechen könnte.
»Rudolf«, fuhr er fort, »seitdem du in dem Alter bist – Fehltritte begehen zu können – habe ich sie – einen nach dem andern – auf meine Schultern genommen. Ich habe – für dich – Gott um Verzeihung gebeten – als ob ich es wäre – der schuldig war – und ich werde weiter so handeln – solange du minderjährig bist.«
Er fing an zu husten.
»Aber du – Rudolf – mußt deinerseits – wenn du zum Priester geweiht bist – hoffentlich lebe ich so lange – meine Sünden – auf deine Schultern nehmen …«
Ich machte eine Bewegung, und er schrie mich an: »Unterbrich mich nicht!«
Er fing wieder an zu husten, aber diesmal auf eine herzzerreißende Weise, wobei er sich über den Tisch krümmte, und plötzlich dachte ich, daß, wenn er sterben würde, ich nicht Priester zu werden brauchte.
»Wenn ich sterbe«, fuhr er fort, als ob er meine Gedanken erraten hätte, und eine Flut von Scham überfiel mich, »wenn ich sterbe – bevor du ordiniert bist – habe ich meine Anordnungen getroffen – mit deinem künftigen Vormund – damit sich nach meinem Tode nichts ändert. Und selbst nach meinem Tode – Rudolf – selbst nach meinem Tode – wird es deine Pflicht – deine Pflicht als Priester sein – bei Gott für mich einzutreten.«
Er schien auf eine Antwort von mir zu warten. Ich kam nicht dazu, zu antworten.
»Vielleicht – Rudolf«, begann er wieder, »hast du manchmal gefunden – daß ich – zu dir – strenger war – als zu deinen Schwestern – oder zu deiner Mutter – aber begreife – Rudolf – begreife – du – du hast – nicht das Recht – verstehst du? – du hast nicht das Recht – Fehltritte zu begehen. – Als ob es«, fuhr er leidenschaftlich fort, »nicht genug wäre – an meinen eigenen Sünden – müssen alle in diesem Hause – alle – alle« (er fing plötzlich wieder an zu schreien) »– jeden Tag – diese Last – diese furchtbare Last – vermehren.«
Er stand auf, begann im Zimmer hin und her zu laufen, und seine Stimme zitterte vor Wut.
»Jawohl, das tut ihr mir an. Ihr drückt mich tiefer in Schuld. Alle. Alle. Ihr drückt mich tiefer hinab. Jeden Tag – drückt ihr mich tiefer hinab!«
Er kam auf mich zu, ganz außer sich. Ich sah ihn bestürzt an. Er hatte mich bis dahin noch nie geschlagen.
Einen Schritt vor mir blieb er unvermittelt stehen, er holte tief Atem, ging um meinen Stuhl herum und warf sich vor dem Kruzifix nieder.
Ich stand mechanisch auf.
»Bleib, wo du bist«, sagte er über die Schulter weg, »das geht dich nichts an.«
Er begann wieder ein Vaterunser in der langsamen, fließenden Redeweise, die ihm eigen war, wenn er betete.
Er betete eine ganze Weile, setzte sich dann wieder an seinen Schreibtisch und sah mich so lange an, daß ich von neuem zu zittern anfing.
»Hast du etwas zu sagen?«
»Nein, Vater.«
»Ich glaubte, du hättest etwas zu sagen.«
»Nein, Vater.«
»Es ist gut, du kannst gehen.«
Ich stand auf und nahm Haltung an. Er winkte ab. Ich machte kehrt, ging hinaus und schloß die Tür.
Ich ging in mein Zimmer, öffnete das Fenster und schloß die Läden. Ich zündete die Lampe an, setzte mich an meinen Tisch und begann eine arithmetische Aufgabe zu lösen. Aber ich kam nicht weiter. Die Kehle war mir wie zugeschnürt, und mir wurde ganz übel.
Ich stand auf, holte meine Schuhe unter dem Bett hervor und machte mich daran, sie zu reinigen. Sie hatten seit meiner Heimkehr aus der Schule Zeit gehabt zu trocknen, und nachdem ich etwas Krem aufgetragen hatte, begann ich, sie mit einem Lappen zu polieren. Nach kurzer Zeit fingen sie an zu glänzen. Aber ich rieb immer weiter, schneller und immer stärker, bis mir die Arme weh taten.
Um halb acht läutete Maria zum Abendessen. Nach dem Essen wurde das Abendgebet gesprochen. Vater stellte uns die üblichen Fragen, niemand hatte den Tag über einen Verstoß begangen, und Vater zog sich in sein Arbeitszimmer zurück.
Um halb neun ging ich wieder auf mein Zimmer, und um neun kam Mama, um das Licht zu löschen. Ich lag schon im Bett. Sie schloß die Tür wieder, ohne ein Wort zu sagen und ohne mich anzusehen, und ich blieb im Dunkeln allein.
Nach einer Weile streckte ich mich lang aus, die Beine steif nebeneinander, mit starrem Kopf und geschlossenen Augen, die Hände über der Brust gekreuzt. Mir war, als wäre ich gestorben. Meine Familie lag betend auf den Knien um mein Bett. Maria weinte. Das dauerte ein Weilchen, dann endlich erhob sich mein Vater, schwarz und mager, ging steifen Schrittes hinaus, schloß sich in seinem eiskalten Arbeitszimmer ein, setzte sich vor das weitgeöffnete Fenster und wartete darauf, daß der Regen aufhörte, um es dann zu schließen. Aber das nützte jetzt nichts mehr. Ich war nicht mehr da und konnte weder Priester werden noch bei Gott für ihn eintreten.
Am nächsten Montag stand ich wie gewöhnlich um fünf Uhr auf, es war eiskalt, und als ich meine Fensterläden öffnete, konnte ich sehen, daß auf dem Dach des Bahnhofs Schnee lag.
Um halb sechs frühstückte ich mit Vater im Eßzimmer. Als ich wieder in mein Zimmer ging, stand auf dem Korridor plötzlich Maria vor mir. Sie hatte auf mich gewartet.
Sie legte mir ihre große rote Hand auf die Schulter und sagte leise: »Vergiß nicht, noch einmal rauszugehen!«
Ich blickte weg und sagte: »Ja, Maria.«
Ich rührte mich nicht, ihre Hand drückte auf meine Schulter, und sie flüsterte: »Du mußt nicht sagen: ›Ja, Maria‹, du mußt gehen. Sofort.«
Sie drückte stärker.
»Los, Rudolf!«
Sie ließ mich los, ich ging nach dem Abort, ich fühlte ihren Blick in meinem Nacken. Ich öffnete die Tür und schloß sie hinter mir. Einen Schlüssel gab es nicht, und die Glühbirne hatte Vater herausgedreht. Das graue Licht des frühen Morgens fiel durch ein immer offenstehendes kleines Fensterchen herein. Der Raum war dunkel und kalt.
Ich setzte mich schlotternd hin und starrte unentwegt auf den Fußboden. Aber das nützte nichts. Er war da mit seinen Hörnern, seinen großen herausquellenden Augen, seiner abfallenden Nase und seinen dicken Lippen. Das Papier war etwas vergilbt, weil Vater es schon vor einem Jahr an die Tür gezweckt hatte, gerade dem Sitz gegenüber in Augenhöhe. Schweiß lief mir über den Rücken. Ich dachte: ›Es ist nur eine Zeichnung. Du wirst doch vor einer Zeichnung keine Angst haben.‹ Ich hob den Kopf. Der Teufel blickte mir ins Gesicht, und seine eklen Lippen fingen an zu lächeln. Ich stand auf, zog meine Hose hoch und flüchtete in den Korridor.
Maria kriegte mich zu fassen und zog mich an sich.
»Hast du was gemacht?«
»Nein, Maria.«
Sie schüttelte den Kopf, und ihre guten Augen blickten mich traurig an.
»Du hast Angst gehabt?«
Ich hauchte: »Ja.«
»Du brauchst bloß nicht hinzusehen.«
Ich schmiegte mich an sie und wartete mit Schrecken darauf, daß sie mir den Befehl gab, noch einmal zu gehen. Sie sagte nur: »Ein großer Junge wie du!«
In Vaters Zimmer war ein Geräusch von Schritten zu hören, und sie flüsterte mir noch schnell zu: »Mach’s in der Schule. Vergiß es nicht.«
»Nein, Maria.«
Sie ließ mich los, und ich ging in mein Zimmer. Ich knöpfte die Hose zu, zog die Schuhe an, nahm meine Schultasche vom Tisch und setzte mich auf einen Stuhl, die Schultasche auf den Knien, wie in einem Wartezimmer.
Nach einer Weile hörte ich Vaters Stimme durch die Tür hindurch: »Sechs Uhr zehn, mein Herr!«
Das »mein Herr« klang wie ein Peitschenknall.
Auf der Straße lag der Schnee schon hoch. Vater ging seinen steifen, gleichmäßigen Schritt, ohne zu sprechen, und blickte geradeaus. Ich reichte ihm kaum bis zur Schulter und hatte Mühe, ihm zur Seite zu bleiben. Ohne den Kopf zu drehen, sagte er: »Halt doch Schritt!«
Ich wechselte den Tritt, zählte dabei ganz leise: »Links … links …«, Vaters Beine streckten sich maßlos, ich fiel von neuem in falschen Tritt, und Vater sagte in seinem abgerissenen Ton: »Ich habe dir gesagt – du sollst Schritt halten.«
Ich setzte wieder dazu an, ich krümmte mich, um ebenso große Schritte zu machen wie er, aber es war zwecklos, ich kam immer wieder aus dem Takt, und hoch über mir sah ich Vaters mageres Gesicht sich vor Zorn verzerren.
Wie alle Tage kamen wir zehn Minuten vor Beginn der Messe in der Kirche an. Wir nahmen Platz, knieten nieder und beteten. Nach einer Weile erhob sich Vater wieder, legte sein Meßbuch auf das Betpult, setzte sich und kreuzte die Arme. Ich tat das gleiche.
Es war kalt, Schnee wirbelte an die Kirchenfenster, ich stand auf einer ungeheuren vereisten Steppe und gab als Nachhut mit meinen Männern Schüsse ab. Die Steppe verschwand, ich war in einem Urwald, mit einem Gewehr in der Hand, von wilden Tieren umzingelt, von Eingeborenen verfolgt, und litt unter Hitze und Hunger. Die Eingeborenen fingen mich, sie banden mich an einen Pfahl, sie schnitten mir Nase, Ohren und die Geschlechtsteile ab. Plötzlich befand ich mich im Palast des Gouverneurs, er wurde von den Negern belagert, ein Soldat fiel an meiner Seite, ich ergriff seine Waffe und schoß ohne Unterbrechung mit verblüffender Treffsicherheit.
Die Messe begann, ich stand auf und betete im stillen: ›Lieber Gott, gib, daß ich wenigstens Missionar werde.‹ Vater nahm sein Meßbuch zur Hand, ich tat das gleiche und folgte dem Gottesdienst, ohne eine Zeile zu überspringen.
Nach der Messe blieben wir noch zehn Minuten, und plötzlich schnürte sich mir die Kehle zusammen; mir kam der Gedanke, Vater hätte mich vielleicht schon zum Weltgeistlichen bestimmt. Wir verließen die Kirche. Als wir ein paar Schritte gegangen waren, unterdrückte ich das Zittern, das mich schüttelte, und sagte: »Bitte, Vater!«
Er sagte, ohne den Kopf zu drehen: »Ja?«
»Ich bitte, sprechen zu dürfen.«
Die Muskeln seiner Kiefer zogen sich zusammen, und er sagte in trockenem, unzufriedenem Ton: »Ja.«
»Wenn es dir recht ist, Vater, möchte ich Missionar werden.«
Er sagte barsch: »Du wirst tun, was man dir sagt.«
Es war aus. Ich wechselte den Tritt, ich zählte ganz leise: »Links … links …« Vater blieb plötzlich stehen und ließ seinen Blick auf mir ruhen.
»Und warum willst du Missionar werden?«
Ich log: »Weil es am mühseligsten ist.«
»So, du willst Missionar werden, weil es am mühseligsten ist?«
»Ja, Vater.«
Er ging weiter, nach etwa zwanzig Schritten drehte er den Kopf leicht zu mir her und sagte verlegen: »Wir werden sehen.«
Nach ein paar Schritten begann er wieder: »So, du möchtest Missionar werden.«
Ich sah zu ihm auf, er sah mich scharf an, runzelte die Stirn und wiederholte in strengem Ton: »Wir werden sehen.« An der Ecke der Schloßstraße blieb er stehen. »Auf Wiedersehen, Rudolf.«
Ich stand stramm.
»Auf Wiedersehen, Vater.«
Er winkte, ich machte eine vorschriftsmäßige Kehrtwendung und ging in gerader Haltung davon. Ich bog in die Schloßstraße ein, ich drehte mich um, Vater war nicht mehr zu sehen, und ich fing an, wie ein Verrückter zu rennen. Es war etwas Unerhörtes geschehen: Vater hatte nicht nein gesagt.
Im Laufen schwang ich das Gewehr, das ich im Palast des Gouverneurs dem verwundeten Soldaten abgenommen hatte, und schoß damit auf den Teufel. Mein erster Schuß riß ihm die linke Gesichtshälfte weg. Die Hälfte seines Gehirns spritzte an die Aborttür, sein linkes Auge hing heraus, während er mich mit dem rechten entsetzt ansah und in seinem zerfetzten, blutigen Mund sich seine Zunge noch bewegte. Ich gab einen zweiten Schuß ab, der die rechte Seite wegriß, während sich die andere unverzüglich erneuerte und nun das linke Auge mich entsetzt und flehend ansah.
Ich durchschritt die Vorhalle der Schule, zog meine Mütze, um den Pförtner zu grüßen, und hörte auf zu schießen. Es klingelte, ich begab mich auf meinen Platz, und Pater Thaler kam.
Um zehn Uhr gingen wir in den Arbeitssaal, Hans Werner setzte sich neben mich, sein rechtes Auge war schwarz und verquollen, ich blickte ihn an, und mit einem Anflug von Stolz flüsterte er mir zu: »Mensch, hab ich aber was abgekriegt!« Und er setzte leise hinzu: »Ich erkläre es dir in der Pause.«
Ich blickte sofort weg und vertiefte mich in mein Buch. Es klingelte, und wir gingen auf den Hof der großen Schüler. Der Schnee war sehr glatt geworden, ich erreichte die Mauer der Kapelle und fing an, meine Schritte zu zählen. Von der Kapellmauer bis zur Mauer des Zeichensaals waren es hundertzweiundfünfzig. Wenn ich am Ziel nur hunderteinundfünfzig oder aber hundertdreiundfünfzig herausbekam, zählte der Marsch nicht. Innerhalb einer Stunde mußte ich die Strecke vierzigmal zurückgelegt haben. Wenn ich sie aus Versehen nur achtunddreißigmal zurückgelegt hatte, mußte ich sie in der nächsten Pause nicht bloß zweimal mehr ablaufen, um meinen Rückstand aufzuholen, sondern noch zweimal zusätzlich als Strafe.
Ich zählte: »Eins, zwei, drei, vier …«, da tauchte der heitere rothaarige Hans Werner neben mir auf, packte mich am Arm, zog mich mit fort und rief: »Mensch, ich hab aber was abgekriegt!«
Ich verzählte mich, kehrte um und fing an der Kapellmauer wieder zu zählen an: »Eins, zwei …«
»Siehst du da«, sagte Werner und legte die Hand aufs Auge, »das war mein Vater.«
Da blieb ich doch lieber stehen.
»Er hat dich geschlagen?«
Werner brach in ein Gelächter aus.
»Hihi! Geschlagen! Das ist nicht das richtige Wort. Es war eine ganze Tracht von Schlägen. Mensch, eine mächtige Tracht. Und weißt du, was ich gemacht hatte?« fuhr er, noch lauter lachend, fort. »Ich hatte … hihi! die chinesische Vase … im Salon … zerbrochen …«
Dann wiederholte er in einem Zuge und ohne zu lachen, aber mit außerordentlich zufriedener Miene: »Ich hatte die chinesische Vase im Salon zerbrochen.«
Ich nahm meinen Marsch wieder auf und zählte ganz leise: »Drei, vier, fünf …« Dann blieb ich stehen. Daß er ein so zufriedenes Gesicht machen konnte, nachdem er ein solches Verbrechen begangen hatte, bestürzte mich.
»Und du hast es deinem Vater gesagt?«
»Ich – es sagen! Was denkst du dir denn? Der Alte hat alles entdeckt.«
»Der Alte?«
»Na ja, mein Vater.«
Also nannte er seinen Vater den »Alten«, und was mir noch sonderbarer vorkam als dieser unglaubliche Mangel an Ehrfurcht, war, daß er in dieses Wort so etwas wie Zuneigung hineinlegte.
»Der Alte hat eine kleine Untersuchung angestellt … Er ist schlau, der Alte; Mensch, er hat alles herausgekriegt!«
Ich sah Werner an. Sein rotes Haar leuchtete in der Sonne, er sprang im Schnee auf der Stelle umher, und trotz seines blauen Auges strahlte er. Ich merkte, daß ich mich verzählt hatte, empfand meine Unzuverlässigkeit und Unbehagen darüber und lief zurück zur Kapellmauer.
»He, Rudolf«, rief Werner neben mir, »was hast du denn? Warum rennst du so? Bei diesem Schnee kann man sich ja die Knochen brechen.«
Ich ging, ohne ein Wort zu sagen, an die Mauer und fing wieder an zu zählen.
»Dann aber«, sagte Werner, während er seinen Schritt dem meinen anpaßte, »hat es mir der Alte gegeben! Im Anfang war es ja eher zum Lachen, aber als ich ihm einen Fußtritt ans Schienbein versetzt hatte …«
Ich blieb wie vor den Kopf geschlagen stehen.
»Du hast ihm einen Fußtritt ans Schienbein versetzt?«
»Aber dann«, sagte Werner lachend, »Mensch, da wurde er unangenehm. Er fing an zu boxen. Da hab ich was gekriegt! Er boxte und boxte. Und schließlich hat er mich k. o. geschlagen …«
Er brach wieder in Lachen aus.
»Darüber war er selber ganz verdattert. Er übergoß mich mit Wasser und gab mir Kognak zu trinken, er wußte nicht mehr, was er machen sollte, der Alte.«
»Und dann?«
»Dann? Na, da hab ich dumm getan, klar.«
Ich schluckte meinen Speichel hinunter.
»Du hast dumm getan?«
»Klar. Und da war der Alte noch verdatterter. Schließlich hat er in der Küche herumgesucht, und dann kam er wieder und gab mir ein Stück Kuchen.«
»Er gab dir Kuchen?«
»Klar. Und weißt du, was ich da zu ihm gesagt habe? Wenn es so ist, habe ich gesagt, werde ich auch die andere Vase zerbrechen.«
Ich starrte ihn fassungslos an.
»Das hast du gesagt? Was hat er denn da gemacht?«
»Er hat gelacht.«
»Er hat gelacht?«
»Er hat sich gebogen vor Lachen, der Alte. Die Tränen standen ihm in den Augen. Und er sagte – da siehst du, wie pfiffig der Alte ist! – er sagte: ›Wenn du kleiner Sauhund die andere Vase zerbrichst, schlag ich dir das andere Auge blau!‹«
»Und dann?« sagte ich mechanisch.
»Da hab ich gelacht, und wir waren alle beide sehr lustig.«
Ich sah ihn mit offenem Munde an.
»Ihr wart lustig?«
»Klar!« Und mit entzückter Miene setzte er hinzu: »Kleiner Sauhund hat er mich genannt, kleiner Sauhund.«
Ich wachte aus meiner Betäubung auf. Ich hatte meine Schritte überhaupt nicht mehr gezählt. Ich sah auf die Uhr. Die Hälfte der Freistunde war schon vorüber. Ich war mit zwanzig Strecken im Rückstand, was mit der Strafe zusammen vierzig ausmachte. Mir war klar, daß ich diesen Rückstand nie aufholen konnte. Ein Angstgefühl überkam mich, und ich empfand Haß gegen Werner.
»Was hast du bloß?« sagte Werner, während er hinter mir herlief. »Wo willst du denn hin? Warum kehrst du immer an der Mauer um?«
Ich gab keine Antwort und fing wieder an zu zählen. Werner wich mir nicht von der Seite.
»Übrigens«, sagte er, »hab ich dich heute früh in der Messe gesehen. Du gehst wohl alle Tage?«
»Ja.«
»Ich auch. Wie kommt es, daß ich dich nie beim Herausgehen sehe?«
»Vater bleibt immer zehn Minuten länger.«
»Wozu denn? Wenn die Messe vorüber ist?«
Ich blieb plötzlich stehen und sagte: »Habt ihr nicht wegen der Vase … gebetet?«
»Gebetet?« sagte Werner und sah mich groß an. »Gebetet? Warum? Weil ich die Vase zerbrochen hatte?«
Er lachte laut heraus, ich fühlte seinen Blick auf mir ruhen, und plötzlich faßte er mich am Arm und zwang mich stehenzubleiben.
»Du hättest wegen der Vase gebetet?«
Voller Verzweiflung wurde ich mir darüber klar, daß ich mich von neuem verzählt hatte.
»Laß mich los!«
»Antworte! Hättest du wegen der Vase gebetet?«
»Laß mich los!«
Er ließ mich los, und ich kehrte wieder zur Kapellmauer zurück. Er folgte mir. Ich startete wieder, mit zusammengepreßten Zähnen. Er ging ein Weilchen schweigend neben mir her, dann brach er mit einemmal in Lachen aus.
»Also, es ist so! Du hättest gebetet.«
Ich blieb stehen und blickte ihn wütend an.
»Ich nicht! Ich nicht! Mein Vater hätte gebetet.«
Er sah mich mit großen Augen an.
»Dein Vater?« Und er lachte noch mehr. »Dein Vater? Ist das komisch! Dein Vater betet, weil du etwas zerbrochen hast.«
»Schweig!«
Aber er konnte sich nicht mehr halten.
»Ist das komisch! Mensch! Du zerbrichst die Vase, und dein Vater betet! Der ist doch verrückt, dein Alter.«
Ich schrie auf: »Schweig!«
»Aber er ist …«
Ich ging mit erhobenen Fäusten auf ihn los. Er wich zurück, strauchelte, bemühte sich, wieder das Gleichgewicht zu gewinnen, glitt aber auf dem Schnee aus und stürzte hin. Man hörte es knacken, er stieß einen durchdringenden Schrei aus, am Knie war ein Knochen gebrochen und hatte sich durch die Haut gebohrt.
Der Lehrer und drei große Schüler kamen vorsichtig über den Schnee gelaufen. Einen Augenblick später war Werner auf eine Bank gelegt, ein Kreis von Schülern stand um ihn herum, ich schaute bestürzt auf den Knochen, der die Haut am Knie durchbohrt hatte. Werner war blaß, er hatte die Augen geschlossen und wimmerte leise.
»Du Tolpatsch«, sagte der Lehrer, »wie hast du denn das gemacht?«
»Ich bin gerannt und hingefallen.«
»Euch war doch gesagt worden, ihr sollt bei diesem Schnee nicht rennen.«
»Ich bin hingefallen«, sagte Werner.
Sein Kopf fiel nach hinten, und er wurde ohnmächtig. Die großen Schüler hoben ihn sacht auf und trugen ihn weg.
Ich stand da wie betäubt, wie angenagelt, durch die Schwere meines Verbrechens vernichtet. Nach einem Weilchen wandte ich mich an den Lehrer und stand stramm.
»Bitte, kann ich zum Pater Thaler gehen?«
Der Lehrer blickte mich an, sah auf seine Uhr und nickte bejahend.
Ich lief nach der Nordtreppe und raste klopfenden Herzens hinauf. Im dritten Stock wandte ich mich nach links, noch ein paar Schritte, und ich klopfte an eine Tür.
»Herein!« rief eine laute Stimme.
Ich trat ein, schloß die Tür und stand stramm. Pater Thaler war in eine Rauchwolke gehüllt. Er wedelte mit der Hand, um sie zu zerteilen.
»Du, Rudolf? Was willst du denn?«
»Bitte, Hochwürden, ich möchte beichten.«
»Du hast doch am Montag gebeichtet.«
»Ich habe eine Sünde begangen.«
Pater Thaler sah auf seine Pfeife und sagte in einem Ton, der keine Antwort zuließ: »Jetzt ist nicht die Zeit dazu.«
»Bitte, Hochwürden, ich habe etwas Schweres begangen.«
Er rieb mit dem Daumen am Bartansatz.
»Was hast du denn gemacht?«
»Wenn es Ihnen recht ist, Hochwürden, möchte ich es Ihnen in der Beichte sagen.«
»Und warum nicht sofort?«
Ich stand schweigend da. Pater Thaler tat einen Zug aus seiner Pfeife und sah mich einen Augenblick an.
»So ernst ist es also?«
Ich wurde rot, sagte aber nichts.
»Meinetwegen«, sagte er mit einer leichten Mißstimmung im Ton. »Ich nehme sie dir ab.«
Er warf einen bedauernden Blick auf seine Pfeife, legte sie auf seinen Schreibtisch und setzte sich auf einen Stuhl. Ich kniete vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Er hörte mir aufmerksam zu, stellte einige Fragen, erlegte mir als Buße zwanzig Paternoster und zwanzig Aves auf und erteilte mir die Absolution.
Er stand auf, setzte seine Pfeife wieder in Brand und sah mich an.
»Und deshalb wünschtest du das Beichtgeheimnis?«
»Ja, Hochwürden.«
Er zuckte die Achseln, warf mir dann einen funkelnden Blick zu, und sein Gesichtsausdruck veränderte sich.
»Hat Hans Werner gesagt, daß du es warst?«
»Nein, Hochwürden.«
»Was hat er denn gesagt?«
»Daß er hingefallen wäre.«
»So, so«, sagte er und blickte mich an, »so daß nur ich es weiß, und ich bin durch das Beichtgeheimnis gebunden.«
Er legte die Pfeife auf den Schreibtisch.
»Kleiner Schurke!« sagte er entrüstet. »Auf diese Weise ziehst du dich heraus, entlastest dein Gewissen und entgehst zugleich der Strafe.«
»Nein, Hochwürden!« rief ich leidenschaftlich. »Nein! So ist es nicht! Es ist nicht wegen der Strafe. In der Schule kann man mich bestrafen, soviel man will!«
Er sah mich überrascht an.
»Weshalb denn dann?«
»Weil ich nicht möchte, daß Vater etwas davon erfährt.«
Er rieb sich wieder mit dem Daumen den Bart.
»Aha! Deswegen!« sagte er in ruhigerem Ton. »Solche Angst hast du vor deinem Vater?«
Er setzte sich, nahm wieder seine Pfeife und rauchte schweigend ein Weilchen.
»Was würde er denn tun? Er würde dich durchprügeln?«
»Nein, Hochwürden.«
Er schien noch weitere Fragen stellen zu wollen, besann sich aber anders und fing wieder an zu rauchen.
»Rudolf«, hob er endlich wieder mit sanfter Stimme an.
»Hochwürden?«
»Es wäre trotzdem besser, du sagtest es ihm.«
Ich fing sofort an zu zittern.
»Nein, Hochwürden! Nein, Hochwürden! Bitte!«
Er stand auf und sah mich verdutzt an.
»Aber was hast du denn? Du zitterst ja? Du wirst doch nicht ohnmächtig werden, hoffe ich.«
Er packte mich an den Schultern und schüttelte mich, gab mir zwei Klapse auf die Backen, ließ mich dann los, machte das Fenster auf und sagte nach einem Weilchen: »Ist dir jetzt besser?«
»Ja, Hochwürden.«
»Setz dich doch!«
Ich gehorchte, und er fing an, brummelnd in seinem Zimmerchen hin und her zu gehen, wobei er mir von Zeit zu Zeit einen flüchtigen Blick zuwarf. Nach einer Weile schloß er das Fenster wieder. Die Schulglocke ertönte.
»Und jetzt geh, du kommst sonst zu spät zum Unterricht.«
Ich stand auf und wandte mich nach der Tür.
»Rudolf!«
Ich drehte mich um. Er stand hinter mir.
»Was deinen Vater angeht«, sagte er fast leise, »kannst du tun, was du willst.«
Er legte mir für ein paar Sekunden die Hand auf den Kopf, dann öffnete er die Tür und schob mich hinaus.
Als mir an diesem Abend Maria die Tür öffnete, sagte sie ganz leise: »Dein Onkel Franz ist da.«
Ich sagte lebhaft: »Ist er in Uniform?«
Onkel Franz war nur Unteroffizier, sein Bild hing nicht neben den Offizieren im Salon, aber trotzdem bewunderte ich ihn sehr.
»Ja«, sagte Maria mit ernster Miene, »aber du darfst nicht mit ihm sprechen.«
»Warum denn nicht?«
»Herr Lang hat es verboten.«
Ich zog meine Windjacke aus, hängte sie auf und bemerkte, daß Vaters Mantel nicht da war.
»Wo ist Vater?«
»Er ist ausgegangen.«
»Warum darf ich nicht mit Onkel Franz sprechen?«
»Er hat Gott gelästert.«
»Was hat er denn gesagt?«
»Das geht dich nichts an«, sagte Maria streng. Dann setzte sie aber sofort mit wichtigtuender und entsetzter Miene hinzu: »Er hat gesagt, die Kirche wäre ein großer Schwindel.«
Ich hörte in der Küche Laute, spitzte die Ohren und erkannte die Stimme von Onkel Franz.
»Herr Lang hat verboten, daß du mit ihm sprichst«, sagte Maria.
»Kann ich ihn begrüßen?«
»Sicher«, sagte Maria zögernd, »es ist nicht schlimm, wenn man höflich ist.«
Ich ging an der Küche vorüber, die Tür stand weit offen, ich blieb stehen und stand stramm. Onkel Franz saß da, ein Glas in der Hand, seine Bluse war aufgeknöpft, und seine Füße lagen auf einem Stuhl. Mama stand neben ihm mit glücklicher, aber schuldbewußter Miene.
Onkel Franz bemerkte mich und rief mit lauter Stimme: »Da ist ja der kleine Pfarrer! Guten Tag, kleiner Pfarrer!«
»Franz!« sagte Mama vorwurfsvoll.
»Was soll ich denn sagen? Da ist das kleine Opfer! Guten Tag, kleines Opfer!«
»Franz!« sagte Mama und drehte sich erschrocken um, wie wenn sie erwartet hätte, daß Vater hinter ihrem Rücken auftauchte.
»Was denn?« sagte Onkel Franz. »Ich sage doch bloß die Wahrheit, nicht wahr?«
Ich stand regungslos stumm vor der Tür. Ich sah Onkel Franz an.
»Rudolf«, sagte Mama schroff, »geh unverzüglich in dein Zimmer!«
»Ach was«, sagte Onkel Franz und blinzelte mir zu, »laß ihn doch eine Minute in Ruhe.«
Er hob mir sein Glas entgegen, blinzelte mir noch einmal zu und setzte mit jener weltmännischen Miene, die mir so sehr an ihm gefiel, hinzu: »Laß ihn doch von Zeit zu Zeit einen wirklichen Mann sehen!«
»Rudolf«, sagte Mama, »geh in dein Zimmer!«
Ich machte kehrt und ging den Korridor entlang. Hinter meinem Rücken hörte ich, wie Onkel Franz sagte: »Das arme Kind! Du wirst mir zugeben, daß es ein starkes Stück ist, wenn er gezwungen wird, Pfarrer zu werden, nur weil dein Mann in Frankreich …«
Die Küchentür wurde heftig zugeschlagen, und ich hörte die Fortsetzung nicht. Dann vernahm ich Mamas scheltende Stimme, aber ohne die einzelnen Worte unterscheiden zu können, und wieder von neuem die Stimme von Onkel Franz, und ich hörte deutlich: »Ein großer Schwindel.«
Wir aßen an jenem Abend etwas früher, weil Papa zu einer Elternversammlung in die Schule mußte. Nach dem Essen knieten wir im Eßzimmer nieder, und das Abendgebet wurde gesprochen. Als Vater zu Ende war, wandte er sich zu Bertha und sagte:
»Bertha, hast du dir ein Vergehen vorzuwerfen?«
»Nein, Vater.«
Dann wandte er sich an Gerda. »Gerda, hast du dir ein Vergehen vorzuwerfen?«
»Nein, Vater.«
Ich war der Älteste. Deshalb sparte Vater mich bis zuletzt auf.
»Rudolf, hast du dir ein Vergehen vorzuwerfen?«
»Nein, Vater.«
Er erhob sich, und alle taten es ihm nach. Er zog seine Uhr heraus, sah Mama an und sagte: »Acht Uhr. Um neun Uhr liegen alle im Bett.«
Mama nickte bejahend. Vater wandte sich an die dicke Maria.
»Sie auch, meine Dame.«
»Ja, Herr Lang«, sagte Maria.
Vater überblickte seine Familie, ging auf den Korridor hinaus, legte Mantel und Schal an und setzte den Hut auf. Wir rührten uns nicht. Er hatte uns noch nicht erlaubt, uns zu rühren.
Er erschien wieder auf der Schwelle, schwarz gekleidet und behandschuht. Das Licht des Eßzimmers ließ seine tiefliegenden Augen aufleuchten. Er blickte über uns hin und sagte: »Gute Nacht.«
Man hörte einstimmig ein dreifaches »Gute Nacht«, dann, etwas verspätet, das »Gute Nacht, Herr Lang« Marias.
Mama folgte Vater bis an die Flurtür, öffnete sie und machte sich dünn, um ihn durchzulassen. Sie hatte das Recht, ihm einzeln gute Nacht zu sagen.
Ich lag schon zehn Minuten im Bett, als Mama mein Zimmer betrat. Ich schlug die Augen auf und überraschte sie, als sie mich ansah. Es dauerte nur einen Augenblick, denn sie wandte sofort die Augen ab und löschte das Licht. Dann schloß sie wortlos die Tür, und ich hörte ihren leisen Schritt sich auf dem Korridor verlieren.
Ich wurde durch das Zuklappen der Vorsaaltür und einen schweren Schritt im Korridor aufgeweckt. Helles Licht blendete mich, ich blinzelte und glaubte Vater neben meinem Bett zu sehen, im Mantel und mit dem Hut auf dem Kopf. Eine Hand schüttelte mich, und ich wurde hellwach. Vater stand da, unbeweglich, ganz in Schwarz, und seine Augen in den tiefen Augenhöhlen funkelten.
»Steh auf!« sagte er mit eisiger Stimme.
Ich blickte ihn an, schreckgelähmt.
»Steh auf!«
Mit seiner schwarzbehandschuhten Hand warf er heftig das Deckbett zurück. Es gelang mir, aus dem Bett zu schlüpfen, und ich bückte mich, um meine Hausschuhe zu suchen. Mit einem Fußtritt schleuderte er sie unter das Bett.
»Komm, wie du bist!«
Er ging auf den Korridor hinaus, ließ mich vor sich hergehen, schloß die Tür meines Zimmers, ging dann schweren Schrittes zum Zimmer Marias, klopfte laut an ihre Tür und rief: »Aufstehen!«
Dann klopfte er an die Tür meiner Schwestern: »Aufstehen!«
Und endlich klopfte er womöglich noch heftiger an Mamas Tür. »Aufstehen!«
Maria erschien als erste, mit eingewickelten Haaren, in einem grünen, geblümten Hemd. Sie blickte Vater an, der im Mantel und mit dem Hut auf dem Kopfe dastand, dann mich, barfuß und schlotternd neben ihm.
Mama und meine beiden Schwestern kamen aus ihren Zimmern, erschrocken blinzelnd. Vater wandte sich an sie gemeinsam und sagte: »Zieht eure Mäntel an und kommt!«
Er wartete, ohne sich zu bewegen und ohne ein Wort zu sagen. Die Frauen kamen wieder aus ihren Zimmern heraus, er begab sich ins Eßzimmer, alle folgten ihm. Er machte Licht, setzte den Hut ab, legte ihn auf das Büfett und sagte: »Wir wollen beten.«
Wir knieten nieder, und Vater begann zu beten. Das Feuer war schon ausgegangen, aber obwohl ich im Hemd auf dem eiskalten Fußboden kniete, fühlte ich die Kälte kaum.
Vater sagte amen und erhob sich. Er stand da, in Handschuhen, unbeweglich. Er erschien mir riesenhaft.
»Unter uns«, sagte er, ohne die Stimme zu heben, »ist ein Judas.«
Niemand bewegte sich, niemand hob die Augen zu ihm auf.
»Hörst du, Martha?«
»Ja, Heinrich«, sagte Mama mit schwacher Stimme.
Vater fuhr fort: »Heute abend – beim Beten – ihr habt es alle gehört – fragte ich Rudolf – ob er – sich ein Vergehen vorzuwerfen hätte.«
Er sah Mama an, und Mama nickte.
»Und ihr habt – alle – gehört – ihr habt es deutlich gehört, nicht wahr? – wie Rudolf – nein – antwortete.«
»Ja, Heinrich«, sagte Mama.
»Rudolf«, sagte Vater, »steh auf!«
Ich stand auf, ich zitterte vom Kopf bis zu den Füßen.
»Schaut ihn an!«
Mama, meine Schwestern und Maria starrten mich an.
»Er hat also nein geantwortet«, sagte Vater triumphierend, »nun sollt ihr erfahren – daß er – nur einige Stunden – bevor er nein antwortete – eine unerhörte – brutale Handlung – begangen hatte. Er hat«, fuhr Vater mit eiskalter Stimme fort, »einen kleinen hilflosen Kameraden mit Schlägen traktiert – und ihm das Bein zerbrochen.«
Vater brauchte nicht mehr zu sagen: Schaut ihn an! Aller Augen ließen mich nicht mehr los.
»Und dann«, fuhr Vater fort und hob seine Stimme, »hat sich dieses grausame Geschöpf – unter uns gesetzt – hat von unserm Brot gegessen – schweigend – und hat – mit uns gebetet – gebetet!«
Er sah auf Mama herab.
»Das ist der Sohn – den du mir geschenkt hast.«
Mama wandte den Kopf weg.
»Sieh ihn an!« sagte Vater wütend.
Mama blickte mich wieder an, und ihre Lippen fingen an zu beben.
»Und dieser Sohn«, fuhr Vater mit zitternder Stimme fort, »dieser Sohn – hat – hier – nur liebevolle Lehren empfangen …«
Da geschah etwas Unerhörtes. Die dicke Maria murmelte etwas.
Vater reckte sich, ließ einen funkelnden Blick über uns hinschweifen und sagte leise, bedächtig und fast mit einem Lächeln auf den Lippen: »Wer etwas – zu sagen hat – sage es!«
Ich sah Maria an. Ihre Augen waren gesenkt, aber ihre dicken Lippen waren leicht geöffnet, und ihre derben Finger verkrampften sich in ihren Mantel. Eine Sekunde später hörte ich mit Bestürzung meine eigene Stimme.
»Ich habe gebeichtet.«
»Ich wußte es«, schrie Vater triumphierend.
Ich sah ihn niedergeschmettert an.
»Ihr sollt wissen«, fuhr Vater mit lauter Stimme fort, »daß dieser Teufel – nachdem er seine Missetat begangen hatte – in der Tat – einen Pater aufgesucht hat – mit einem Herzen voller Arglist – und von ihm – durch geheuchelte Reue – Absolution erhalten hat. Und noch mit der göttlichen Vergebung auf der Stirn – hat er gewagt – die Ehrfurcht – die er seinem Vater schuldig war – zu schänden – indem er ihm sein Verbrechen verheimlichte. Und wenn nicht zufällige Umstände – mir das Verbrechen – enthüllt hätten – hätte ich – sein Vater …«
Er hielt inne, und in seine Stimme kam ein Schluchzen.
»Ich, sein Vater – der ich seit seinem zartesten Alter – seine Sünden – aus Liebe – auf mich genommen habe – als ob es meine wären – ich hätte mein eigenes Gewissen – besudelt – ohne es zu wissen …« Und er schrie auf einmal: »… ohne es zu wissen! – mit seiner Missetat.«
Er sah Mama wütend an.
»Hörst du, Martha? … Hörst du? Wenn ich nicht – zufällig – das Verbrechen deines Sohnes – erfahren hätte – hätte ich mich – vor Gott …«, er schlug an seine Brust, »… ohne mein Wissen – auf ewig – mit seiner Grausamkeit und seinen Lügen – belastet – Herr!« fuhr Vater fort und warf sich auf die Knie, »wie – kannst du mir – jemals – verzeihen …«
Er hielt inne, und dicke Tränen rollten über die Runzeln seiner Wangen. Dann nahm er seinen Kopf in beide Hände, beugte sich vornüber, pendelte mit dem Oberkörper hin und her und stöhnte dabei mit eintöniger, ergreifender Stimme: »Vergebung, Herr! Vergebung, Herr! Vergebung, Herr! Vergebung, Herr!«
Nachher schien er leise zu beten, er beruhigte sich allmählich, hob den Kopf und sagte: »Rudolf, knie nieder und bekenne deine Schuld!«
Ich kniete nieder, faltete die Hände, öffnete den Mund, aber ich konnte kein einziges Wort herausbringen.
»Bekenne deine Schuld!«
Aller Augen richteten sich auf mich, ich machte eine verzweifelte Anstrengung, ich öffnete wieder den Mund, aber es kam kein Wort heraus.
»Es ist der Teufel!« rief Vater in einer Art Raserei. »Es ist der Teufel – der ihn am Sprechen hindert.«
Ich sah Mama an und flehte inständig und schweigend um Hilfe. Sie versuchte wegzublicken, aber diesmal gelang es ihr nicht. Eine volle Sekunde lang starrte sie mich mit aufgerissenen Augen an, dann flackerte ihr Blick, sie wurde bleich, und ohne ein Wort zu sagen, fiel sie der Länge nach zu Boden.
Ich begriff blitzschnell, was geschah. Wieder einmal lieferte sie mich Vater aus.
Maria richtete sich halb auf.
»Rühren Sie sich nicht!« schrie Vater mit schrecklicher Stimme.
Maria erstarrte, dann aber kniete sie wieder nieder. Vater blickte auf Mamas vor ihm liegenden regungslosen Körper und sagte ganz leise mit einer Art Freude: »Die Züchtigung beginnt.« Dann sah er wieder mich an und sagte mit dumpfer Stimme: »Bekenne deine Schuld!«
Es war in der Tat, als wäre der Teufel in mich gefahren. Ich konnte einfach nicht sprechen.
»Das ist der Teufel!« sagte Vater.
Bertha verbarg ihr Gesicht in den Händen und fing an zu schluchzen.
»Herr«, sagte Vater, »da du meinen Sohn – verlassen hast – erlaube mir – in deiner Barmherzigkeit – noch einmal – seine abscheuliche Missetat – auf meine Schultern zu nehmen.«
Schmerz entstellte sein Gesicht, er rang die Hände, und dann kamen in einem grauenvollen Röcheln nacheinander die Worte aus seiner Kehle: »Mein Gott – ich klage mich an – das Bein – Hans Werners – zerbrochen zu haben.«
Nichts von allem, was er bisher gesagt hatte, tat größere Wirkung auf mich.
Vater hob wieder den Kopf, ließ einen funkelnden Blick über uns schweifen und sagte: »Laßt uns beten!«
Er stimmte das Vaterunser an. Den Bruchteil eines Augenblicks später vereinigten Maria und meine beiden Schwestern ihre Stimmen mit der seinen. Vater sah mich an. Ich öffnete den Mund, kein einziger Ton kam heraus, der Teufel war in mir. Ich fing an, die Lippen zu bewegen, als ob ich leise betete, ich versuchte, gleichzeitig an die Worte des Gebets zu denken, aber alles war vergeblich, es gelang mir nicht.
Vater machte das Zeichen des Kreuzes, stand auf, holte aus der Küche ein Glas Wasser und goß es Mama ins Gesicht. Sie bewegte sich etwas, schlug die Augen auf und kam taumelnd auf die Beine.
»Geht schlafen«, sagte Vater.
Ich tat einen Schritt vorwärts.
»Sie nicht, mein Herr!« sagte Vater mit eisiger Stimme.
Mama ging hinaus, ohne mich anzusehen. Meine beiden Schwestern folgten ihr. Maria drehte sich auf der Schwelle noch einmal um, blickte Vater an und sagte langsam und deutlich: »Es ist eine Schande!«
Dann ging sie hinaus. Ich wollte schreien: Maria!, aber ich vermochte nicht zu sprechen. Ich hörte ihren schleppenden Schritt sich auf dem Korridor verlieren. Eine Tür klappte, und ich blieb mit Vater allein.
Er wandte sich um und sah mich so haßerfüllt an, daß ich einen Augenblick lang Hoffnung hatte. Ich glaubte, er würde mich schlagen.
»Komm!« sagte er mit dumpfer Stimme.
Mit seinem steifen Schritt ging er voraus, ich folgte ihm. Nach den Fliesen des Eßzimmers erschien der Fußboden des Korridors meinen nackten Füßen fast warm.
Vater öffnete die Tür seines Arbeitszimmers, es war eiskalt darin, er ließ mich vorangehen und schloß die Tür. Er zündete keine Lampe an, sondern zog die Vorhänge des Fensters auf. Die Nacht war klar, und die Dächer des Bahnhofs waren mit Schnee bedeckt.
»Wir wollen beten.«
Er kniete zu Füßen des Kruzifixes nieder, ich kniete hinter ihm. Nach einem Weilchen drehte er sich um.
»Du betest nicht?«
Ich sah ihn an und nickte bejahend.
»Bete laut!«
Ich wollte sagen: Ich kann nicht! Meine Lippen rundeten sich, ich griff mit den Händen nach meiner Kehle, aber es kam kein Ton heraus.
Vater faßte mich an den Schultern, als ob er mich schütteln wollte. Er ließ mich aber gleich wieder los, wie wenn die Berührung mit mir ihm Abscheu einflößte.
»Bete!« sagte er feindselig. »Bete, bete!«
Ich bewegte die Lippen, aber es kam nichts. Vater lag auf den Knien, halb zu mir gewandt; seine tiefliegenden funkelnden Augen starrten mich an, und es schien, als hätte es nun ihm die Sprache verschlagen.
Nach einer Weile blickte er weg und sagte: »Nun gut, dann bete leise!«
Dann drehte er sich um und stimmte ein Ave an. Diesmal bemühte ich mich nicht einmal mehr, die Lippen zu bewegen.
Mein Kopf war leer und heiß. Ich versuchte nicht mehr, mein Zittern zu unterdrücken. Von Zeit zu Zeit preßte ich die Schöße meines Hemdes an die Seiten.
Vater bekreuzigte sich, drehte sich um, sah mich starr an und sagte gewissermaßen triumphierend:
»Hiernach – Rudolf – wirst du verstehen – wie ich hoffe – wirst du verstehen – daß du noch – Priester – werden kannst – aber nicht mehr – Missionar.«
Am nächsten Tag wurde ich ernstlich krank. Ich erkannte niemanden, ich verstand nicht, was man zu mir sagte, und ich konnte nicht sprechen. Man drehte mich hin, man drehte mich her, man legte mir Kompressen auf, man ließ mich etwas trinken, man legte mir Eisbeutel auf den Kopf, man wusch mich. Darauf beschränkten sich meine Beziehungen zur Familie.