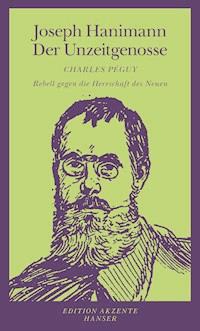
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Er kam aus der Provinz nach Paris und blieb dort immer ein Außenseiter. Als Dichter und Denker jedoch scharte Charles Péguy (1873-1914) eine verschworene Gemeinde um sich. In jüngerer Zeit zählten dazu ganz unterschiedliche Persönlichkeiten aus Philosophie und Literatur: Gilles Deleuze, Alain Finkielkraut, Bruno Latour und Thomas Bernhard imponierte die Unabhängigkeit dieses Intellektuellen aus Frankreich. Seine Dramen und seine Prosa betreiben eine radikale Kritik der Moderne, als Herausgeber einer eigenen Zeitschrift musste er keine Kompromisse eingehen. Von Péguy kann man lernen, ohne Rücksicht auf irgendeinen Zeitgeist zu denken. Es wird Zeit, ihn auch hierzulande zu entdecken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Er kam aus der Provinz nach Paris und blieb dort immer ein Außenseiter. Als Dichter und Philosoph jedoch scharte Charles Péguy (1873 –1914) eine verschworene Gemeinde um sich. In jüngerer Zeit zählen dazu so unterschiedliche Persönlichkeiten wie Gilles Deleuze, Alain Finkielkraut, Bruno Latour und Thomas Bernhard. Ihnen allen imponierte Péguys intellektuelle Unabhängigkeit. In seinen Werken und in seiner eigenen Zeitschrift blickte er als radikaler Kritiker der Moderne tiefer auf den Grund der Verhältnisse als viele ihrer Befürworter: Von Péguy kann man lernen, ohne Rücksicht auf irgendeinen Zeitgeist zu denken. Joseph Hanimann porträtiert in einem biographischen Essay.
Edition Akzente
Joseph Hanimann
Der Unzeitgenosse
Charles PéguyRebell gegen die Herrschaft des Neuen
Carl Hanser Verlag
Inhalt
Klima
Kindheit
Aufbruch
Engagement
Gründung
Freundschaft
Krise
Glaube
Kampf
Clios Klage
Post Scriptum
Anhang
Anmerkungen
Bibliographie
Personenregister
Klima
»Schreiben Sie, wie sie beten!« Die Anweisung des Zeitungsdirektors an den Reporter im Prolog zu Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus vor der aufgebahrten Leiche des Erzherzogs Franz-Ferdinand im Wiener Südbahnhof war Programm für eine neue Epoche. Sommer 1914. »Schreiben Sie, wir brauchen die Stimmung!« Niederknien, mitschreiben, kämpfen – drei Dinge, deren Echo noch heute nachhallt.
Ewigkeitsanspruch heiliger Bücher, politische Tagesaktualität aus der Zeitung, dramatische Unmittelbarkeit detonierender Gewehre oder Granaten: Die Triade schien sich zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts aus ihrer bedrohlichen Verbindung zu lösen. Religion, aktuelle Berichterstattung und diplomatische oder militärische Kampfstrategie sollten auf getrennten Wegen weniger Unheil anrichten. Ein Jahrhundert später zeigt sich jedoch: Sie sind zueinander in Reichweite geblieben. Die politische Berufung auf angeblich göttliche Botschaften, Propaganda im Tarnkleid der Information und der Einsatz von Kriegswaffen gehen im Namen höherer Ziele nach wie vor miteinander Verbindungen ein. Kategorien wie Fanatismus, Nihilismus, Zynismus, inszenierte oder blindwütige Barbarei, Zivilisierung, Realpolitik wirbeln dann in der Debatte durcheinander. Man kann sich diesem Phänomen von dem Punkt aus nähern, wo die Stränge eng verknotet waren, auf den Spuren eines Mannes, der sich zeitlebens leidenschaftlich mit den Verstrickungen zwischen Gesellschaftskritik, Sozialutopie, intellektuellem Engagement und zugleich Intellektuellenverachtung, zwischen Ideologiescheu, Patriotismus, religiösen Gefühlen und militärischer Waffenbereitschaft abmühte.
Am 5. September des Kriegsjahrs 1914 stürmte er mit seinen Soldaten über ein Getreidefeld der Gemeinde Villeroy, östlich von Paris. »Schießt! Schießt doch, um Himmels willen!«, soll er seinen Leuten noch zugerufen haben, bevor eine Kugel ihn traf. Seine Leiche wurde am Tag danach neben anderen Gefallenen geborgen. Charles Péguy war einundvierzig Jahre alt, als er am Tag vor Beginn der Marne-Schlacht fiel. Ein Jahr später schrieb Karl Kraus, einundvierzigjährig, seinen Prolog zu Die letzten Tage der Menschheit. Es sind zwei Literatenschicksale unter vielen anderen. In ihren Ähnlichkeiten und ihren Kontrasten geben sie aber interessante Aufschlüsse. Der eine zog begeistert zur Front, der andere blieb ihr entgeistert fern. Der eine pflegte zu beten, der andere zu spotten.
Péguy kam 1873 in bescheidenen Verhältnissen des Faubourg de Bourgogne in Orléans zur Welt und wuchs als Einzelkind bei der Mutter, einer Stuhlflickerin, und der Großmutter auf. Nach einer soliden Schulbildung in den großen Etablissements der Republik war er zunächst engagierter Sozialist, dann Erzkatholik und blieb lebenslang seiner bäuerlichen Herkunft verbunden. Ihr wollte er angehören, nicht dem Bürgertum. Das hieß für ihn: gekrümmter Rücken, schweres Schuhwerk und lieber als einen Polstersessel »einen Holzschemel unterm Hintern«.1
Karl Kraus, 1874 als neuntes Kind einer wohlhabenden jüdischen Unternehmerfamilie geboren, wuchs ab dem dritten Lebensjahr im Wien des erweiterten Kaiserreichs auf, verkehrte zunächst gern in aristokratisch-konservativen Kreisen, trat zum Katholizismus über und von dort wieder aus, bekannte sich schließlich zur österreichischen Republik. Beide waren Schriftsteller und Herausgeber einer Zeitschrift, die jede auf ihre Weise für das Europa des neuen Jahrhunderts bedeutsam wurde. Die Erstlingsnummer von Die Fackel kam 1899 in Wien heraus, Les Cahiers de la Quinzaine erschienen ab Januar 1900 in Paris.
Kraus wie Péguy waren Alleinherausgeber ihrer Zeitschrift, der erstere bald auch ihr praktisch einziger Autor. Für die im Zweiwochenrhythmus erscheinenden Cahiers de la Quinzaine, einer Mischung aus Periodikum und Buch, die pro Nummer oft nur einen großen Essay enthielten, schrieben neben Péguy selbst die Schriftsteller Romain Rolland, Anatole France, die Politiker Jean Jaurès, Georges Clemenceau, der politische Autor Georges Sorel sowie die Essayisten Bernard Lazare, André Suarès, Daniel Halévy, Julien Benda.
Im Alter von gut zwanzig Jahren war Péguy während der Dreyfus-Affäre als junger Sozialist und leidenschaftlicher Dreyfusard ins Engagement für republikanische Überzeugung, soziale Gerechtigkeit, allgemeinen Fortschritt, Transparenz des Staatsapparats und Aufrichtigkeit der politischen Akteure hineingewachsen. Zehn Jahre später wurde er zum virulenten Kritiker seiner einstigen Kampfgenossen, die mittlerweile an den Schalthebeln des Staats saßen und ihren Sieg in der Dritten Republik über die nostalgischen Reaktionäre des Ancien Régime machtpolitisch zu nutzen gelernt hatten. Charles Péguy polemisierte nunmehr als katholischer Kreuzritter des Geistes gegen das moderne Dogma vom technischen Fortschritt und materiellen Wohlstand, diese »Verheißung auf Sterilität«.2 Er kämpfte als Intellektueller gegen den Aufstieg der intellektuellen Macht von links wie von rechts, gegen deren Anspruch auf moralische Vorbildlichkeit und gegen den Hang zur Quantifizierung der Vernunft durch Statistik. Eine Macht, die seiner Ansicht nach im Kurzschluss aus Denken und Rechnen in den neuen Wissenschaftszweigen Soziologie, Ökonomie, Psychologie an der Universität die Wirklichkeit auf Begriffsschemen und Zahlenkolonnen reduzierte: Völkergeschichte auf Sozialtheorie, Literatur und Philosophie auf Philologie, Kunstwerke auf Formanalyse, Sinnzusammenhänge auf Milieustudien, politische Willenskraft auf faktische Wirtschaftskraft. Für Péguy war das eine Kapitulation des Geistes.
Auch Karl Kraus führte in einem Beitrag der Fackel 1908 den bevorstehenden Weltuntergang auf eine Vernichtung des Geistes zurück. Darin liege der »wahre« Weltuntergang, schrieb er.3 Der »andere«, allgemein sichtbare Weltuntergang, den alle für den wirklichen hielten, sei nur ein Nachspiel des ersteren, und sein Eintreten hänge davon ab, ob überhaupt »nach Vernichtung des Geistes noch eine Welt bestehen« könne. Bewegte Péguy sich mit seiner Kulturkritik aber allmählich vom Sozialismus weg hin zu den konservativ-statischen Werten von Militär, Kirche und gesellschaftlichem Standesbewusstsein, so entwickelte Kraus sich von anfänglich konservativen Positionen in umgekehrter Richtung und kam nach 1918 beim ungefähren Bekenntnis zur Sozialdemokratie an.
Beide Autoren haben überdies ein sperriges literarisches Werk hinterlassen. Kraus konzipierte sein Drama Die letzten Tage der Menschheit eher für ein »Marstheater« als für eine konventionelle Bühne. Péguy schrieb mehrere für die Bühne ebenso ungeeignete Stücke über Jeanne d’Arc und ein Monumentalgedicht mit Tausenden von Versen unter dem Titel Ève. Die beiden Schriftsteller sind einander im Leben nie begegnet. Die interessante Wechselbeziehung zwischen ihnen geistert mitunter durch die germanistische Literatur, von Claude David4 bis Gerald Stieg5, ist aber nie wirklich untersucht worden. Das soll auch in diesem Buch nicht geschehen. Es geht hier vielmehr darum zu zeigen, wie diese beiden nebst einigen anderen Zeitgenossen für das stehen, was Péguy6 einmal »les mécontemporains«, die »Unzeitgenossen«, genannt hat – eine Kategorie Leute, die sich als besonders zeitbeständig erwiesen und die inkognito weiterhin unter uns leben.
Der 100. Jahrestag von Péguys Tod im September 2014 offenbarte in zahlreichen Publikationen, wie anregend dieser wenig gelesene, im deutschen Sprachraum fast schon vergessene Autor dennoch bleibt. In den Büchern des Philosophen Gilles Deleuze steht er ungenannt manchmal im Hintergrund. Bruno Latour sieht in ihm die Figur, die am hellsichtigsten das Gift erkannte, das die heraufziehende Moderne von Anfang an in sich trug: ihr Unvermögen zu halten, was sie verspricht. Denn was ihr nicht ins Konzept passt, habe die Moderne stets einfach als rückständig, überholt, ja suspekt beiseitegeschoben – und diese Neigung habe sich im global gewordenen, alles archaisch, lokal, kulturell oder religiös Sperrige einebnenden Kapitalismus noch verstärkt.7 Aus dem toten Winkel der damals politisch noch nicht vorbelasteten Begriffe wie Rasse, Boden, Volk, Nation habe der Moderne-Verächter Péguy, so Latour, unsere heutige Welt schärfer und tiefer vorausgedacht als die meisten Moderne-Theoretiker: »Er, der sein Leben lang den Flecken Erde kaum verließ, auf dem er lebte, war der wahre Vordenker der Globalisierung.«8
Alain Finkielkraut hat dem philosophischen Vermächtnis Péguys mit seinem Buch Le mécontemporain schon 1991 eine ausführliche Studie gewidmet und ist seither ein unermüdlicher Péguy-Leser geblieben. Anlässlich des 100. Todestags ließ er sich auf eine neue Auseinandersetzung mit ihm ein und kam zu einem ähnlichen Schluss wie Bruno Latour. In der aus der Dreyfus-Affäre hervorgegangenen Alternative zwischen humanistischer, menschenverbindender Universalidee und konfliktschürenden Kategorien wie Vaterland, Armee, Staat, Gott liege Péguy irgendwie quer, schreibt Finkielkraut9: Statt sich wie Zola oder Clemenceau im Kampf gegen Rassenwahn und Fanatismus auf die Vernunft Voltaires zu berufen, habe Péguy das Beispiel Rodrigos aus CorneillesLe Cid angeführt und dessen Schwur auf die »Ehre des Bluts« – »rein gebe ich mein Blut zurück, wie ich es empfangen habe«. Dadurch sei Péguy für viele heute unlesbar geworden, gibt Finkielkraut zu, denn nachdem der Nationalsozialismus den gesamten Begriffszusammenhang von Blut, Ehre und Rasse verwüstet habe, könne man den Autor heute kaum mehr anders als durch die Brille des Rassismus sehen. Zwischen der grausigen Schimäre einer ethnischen, reinen Blutsgemeinschaft und einer notfalls mit Blut bezahlten Reinheit der ethischen Überzeugung wagen oder vermögen wir Nachgeborene tatsächlich nicht mehr recht zu unterscheiden.
Gerade deswegen vielleicht greifen aber Denker unterschiedlichster Couleur weiterhin gern auf Péguy zurück. Seine Zeit sei wieder im Kommen und werde immer näher kommen, erklärt der Marxist Alain Badiou,10 denn in unserer unüberschaubaren Zwischen- und Übergangsepoche bräuchten wir Beispiele von so hartnäckiger Unbeugsamkeit und »denkerischer Brutalität« gegenüber dem Diktat der angeblichen Sachzwänge. Für den Historiker und Journalisten Jacques Julliard ist unsere Epoche sogar »pégyistischer« als die Epoche, in der er selbst lebte. Zusammen mit dem Philosophen Pascal, dem Utopisten Proudhon, dem Gesellschaftskritiker Georges Sorel, der Existentialistin Simone Weil stellt Julliard den Autor Péguy in die Reihe der teilweise katholischen Einzelgänger, die sich abseits des intellektuellen Königswegs von Voltaire zu Sartre widerspenstig gegen die jeweils vorherrschenden Denksysteme ihrer Epoche gestellt hätten.11 Péguys Agenda, resümiert Jérôme Roger in der Zeitschrift Europe,12 laufe mit ihren scheinbar antiquierten Begriffen der Zeit immer hinterher oder voraus.
So hat dieser Denker eine seltsame Rezeptionsgeschichte. Walter Benjamin fühlte sich von ihm »unglaublich verwandt angesprochen« und dachte 1919 daran, ihn durch eine Edition ausgewählter Schriften auch in Deutschland besser bekannt zu machen, woraus jedoch nichts wurde.13 Frühe Biographien von Mitarbeitern der Cahiers wie Jérôme und Jean Tharaud, Daniel Halévy, Romain Rolland hielten mit persönlichen Erinnerungen die originelle Persönlichkeit Péguys lebendig, verfestigten sie aber mit Legenden und Klischees. Katholische Kreise vereinnahmten den Autor schnell und umso lieber, als er ursprünglich aus dem Lager der Linken kam. Doch gab es in dieser katholischen Vereinnahmung auch Bemerkenswertes. Der Schweizer Theologe Hans Urs von Balthasar las Péguy mit wachem Auge. Er sah in ihm einen Denker vom Schlage Kierkegaards, einen großen Einzelkämpfer gegen den Systemgeist seiner Epoche, und beschrieb subtil den Zweifrontenkrieg, den er führte: vom Sozialismus her gegen die klerikalisch-kirchliche Bourgeoisie und vom Heilsmysterium Christi her gegen die antiklerikalisch-sozialistische Spießbürgerei – denn, so Balthasar, »die solidarité ist nicht billiger zu haben als mitsamt den ursprünglichen biblischen Tiefen der charité«.14 Im linkskatholischen Spektrum war Péguy überdies immer eine wichtige Figur. Emmanuel Mounier, der Gründer der Zeitschrift Esprit und Begründer der Bewegung des »Personalismus«, hat schon 1931 eine maßgebende Studie vorgelegt: La pensée de Charles Péguy. Im sozialistischen und kommunistischen Lager hingegen wurde Péguy lange gemieden, manchmal als Verräter abgetan oder einfach als Gesinnungsbruder von Charles Maurras in die national-reaktionäre Ecke der Action Française gerückt.
Besonders verhängnisvoll war für Péguy die Zeit des Faschismus und Pétainismus, dessen Anhänger ihn als Wegbereiter der »nationalen Revolution« präsentierten. Péguys eigener Sohn Marcel machte ihn 1941 in seinem zwar detailreichen, aber ideologisch vergifteten Erinnerungsbuch Le destin de Charles Péguy zum Vertreter des Prinzips »Ein Land, eine Rasse, ein Chef« und zu einem Propheten des Nationalsozialismus. Dass Charles de Gaulle und andere aus dem Exil in London oder New York sowie aus dem inneren Widerstand der »France libre« sich ebenfalls auf Péguy beriefen, setzte einen entscheidenden Gegenakzent.
Direkte Nachfolger hat Péguy keine gehabt. Seine Zeitschrift hörte nach seinem Tod auf zu erscheinen und kam trotz einiger Wiederbelebungsversuche nie wieder in Fahrt. Niemand wollte das sperrige Erbe übernehmen. Vielmehr sind die geistigen Erben bis heute quer durch alle politischen Lager, intellektuellen Kreise und alle Berufskategorien verstreut. Damien Le Guay hat zum 100. Todestag in seinem Buch Les héritiers Péguy ein Panorama bekannter lebender Péguy-Leser erstellt. »Sie sind selten, die Schriftsteller, die auf eine so lange Zeit eine so breit gestreute Nachkommenschaft hatten«, schreibt er.15 Neben den schon genannten Intellektuellen Alain Finkielkraut und Jacques Julliard findet man dort auch den früheren Trotzkisten und ehemaligen Chefredakteur von Le Monde, Edwy Plenel, den Raymond-Aron-Schüler und Liberalismus-Theoretiker Pierre Manent, den Zentrumspolitiker François Bayrou oder Yann Moix, einen schwer klassifizierbaren Vertreter der französischen Gegenwartsliteratur. Sie alle führen ihr Denken in wesentlichen Zügen auf ihre regelmäßige Péguy-Lektüre zurück. Und der 1942 gegründete, in Orléans angesiedelte Verein L’Amitié Charles Péguy beweist mit seinen Tagungen und seinem Vierteljahresbulletin, wie beständig das zwischen »historischer« und »prophetischer Perspektive« pendelnde Erbe Péguys16 von einer Generation zur nächsten weitergereicht wird.
Seit der Aufklärung waren die tonangebenden Geister Europas durch die Schule der Kritik gegangen. Anzweifeln, Hinterfragen, Argwöhnen, Anklagen oder Verspotten waren die Etappen auf den neuen Wegen zur Wahrheit. Getragen wurde diese Begeisterung für die kritische Vernunft von einer Figur, die unter den neuen gesellschaftlichen Bedingungen des 19. Jahrhunderts – allgemeine Schulbildung, vereinheitlichte Lehrpläne, Rotationspresse, beschleunigtes Fernmelde- und Verkehrswesen, Großstadtkultur und öffentliche Meinung – als politische Kraft allmählich Konturen annahm: die Figur des »Intellektuellen«. Er verlieh der wechselhaften Volksstimmung im Spannungsfeld der Meinungen eine verständliche Stimme und feierte unter dem Schlachtruf von Zolas »J’accuse …!« 1898 auf dem Höhepunkt der Dreyfus-Affäre in Frankreich seinen ersten Triumph. In ihren russischen, mitteleuropäischen, national- oder international-sozialistischen, später südamerikanischen, heute vielleicht arabischen Varianten haben die Intellektuellen sich in der Gesellschaft mittlerweile als eine feste Instanz etabliert.
Charles Péguy, Karl Kraus und einige andere passen nicht in diese Genealogie. Mit ihrem ideologisch schwer fixierbaren polemischen oder satirischen Temperament verkörpern sie eine Ausdrucksform des kritischen Engagements, die von der klassischen Intellektuellengeschichte ausgeblendet wurde. Statt allgemeinen Systemwissens, mit dem man historisch recht oder unrecht haben konnte, gab es für sie nur Erfahrungswissen für jeweils konkrete Situationen: ein Wissen, das für allgemeine Theorien wenig hergab. Wie viele Entscheidungen in unserem Leben eignen sich denn »zur allgemeinen Gesetzgebung« im Sinne Kants? – fragte Péguy einmal.17 Kaum eine, lautet seine Antwort, denn die wichtigsten Entscheidungen im Leben würden nicht aus abgeklärter Distanz, sondern in fiebriger Bange, zermürbender Ungewissheit, glühender Hingabe getroffen. Und ausgeführt würden sie mit zitternder, nicht mit der von der Kantschen Vernunft geführten sicheren Hand. Oh, gewiss, räumte Péguy ein,18 der Kantianismus habe keine schmutzigen Hände, denn er habe gar keine Hände. Wir hingegen, fuhr er fort, »haben hornhäutige, knorrige, sündige und manchmal auch volle Hände«.
So hatte Péguy sich in den ersten Augusttagen 1914 bereitwillig in den Krieg aufgemacht und eine angefangene Studie über Descartes und Bergson mitten im Satz liegengelassen. Es war der Krieg, dem Karl Kraus mit derselben Entschiedenheit fernblieb, den er zunächst totschwieg und dann verfluchte. Was lässt sich daraus schließen? So viel, dass es neben den großen Erklärungen für oder gegen den Krieg auch die Reaktion des Verstummens gab, bei Péguy endgültig, bei Kraus immerhin vier Monate lang, bis im Dezember 1914 sein Aufsatz In diesen großen Zeiten erschien. Man möge in dieser »ernsten Zeit« von ihm »kein eigenes Wort« erwarten, bat er dort seine Leser. Neue Worte könne er nicht und alte dürfe er nicht sagen, solange Taten geschähen, die ihm neu seien: »Die jetzt nichts zu sagen haben, weil die Tat das Wort hat, sprechen weiter. Wer etwas zu sagen hat, trete vor und schweige!«19 Péguy verkündete auf seine herbe Art im Grunde nichts anderes. In allen entscheidenden Momenten bleibe die Wirklichkeit für unsere Begriffe und Worte unfassbar, schrieb er,20 denn »sie geifert und bewegt sich immerfort«.
Mit dieser Überzeugung einer radikalen Unvereinbarkeit zwischen Realität, Begriff und Sprache stehen Péguy, Karl Kraus und einige andere im Abseits der europäischen Intellektuellengeschichte. Wie lässt sich von dieser Position aus eine Überzeugung, eine Stellungnahme, ein Engagement begründen? Die Kriegsbereitschaft des einen und die Kriegsverweigerung des anderen traten mit derselben Emphase der Endgültigkeit auf – einer Endgültigkeit, die der junge Péguy im Kontext der Dreyfus-Affäre kennengelernt hatte. Durch sie waren die französische Dritte Republik und das moderne Staatsmodell der demokratischen Mehrheitsbeschlüsse, Kompromisse, relativen Wahrheiten jäh ins Dilemma eines Entweder-Oder gestürzt worden. Wäre die Staatsraison, durch die der jüdische Hauptmann Alfred Dreyfus für Hochverrat verurteilt und unter dem Beifall der Bevölkerungsmehrheit ins Straflager auf die Teufelsinsel verbannt worden war, unwiderrufen geblieben, schrieb Péguy später, dann wäre es mit der Republik Frankreich endgültig vorbei gewesen, denn ihre Glaubwürdigkeit wäre zerbrochen. Die Vertrauenswürdigkeit eines Staats oder eines Volks sei nicht in gelungene und misslungene Episoden aufteilbar, fand er. Vielmehr galt für ihn: »L’honneur d’un peuple est d’un seul tenant.«21 Hat ein Staat einmal versagt, hat er für immer versagt. Für Staaten und Völker sah Péguy keine zweite Chance.
Dieser Stachel der Endgültigkeit steckt, wenn auch durch Pragmatik entschärft, noch heute im Fleisch unserer zwischen Ideal und Realpolitik schwankenden Demokratien. Er ist etwa in der Frage zu spüren, wofür wir zu sterben bereit wären. In seinem berühmtesten Prosatext, der 1910 erschienenen Schrift Notre jeunesse, stellt Péguy dem Begriff der »Politik« den der »Mystik« gegenüber. Von einer »Mystik« seien jene getrieben gewesen, die 1898 für die Rehabilitierung des unschuldigen Dreyfus gekämpft hätten, heißt es dort. Doch was als »Mystik« beginne, ende meistens in der »Politik«, das heißt in einem Kompromiss aus Ideal, Kalkül, Intrige, Verrat und Wahlstrategie. »Wir haben die Lektion der Republik verlernt, aber wir haben das Regieren gelernt.«22
Eine politische Sache, pfui, »also eine Gemeinheit« – schrieb auch Karl Kraus etwa zur selben Zeit. Im Text Apokalypse spekulierte er 1908 über einen eventuellen »gelegentlichen Barbarenangriff auf unsere Kultur, unsere Parlamente, Redaktionen und Universitäten«.23 Die Idee eines solchen Totalangriffs mache ihm keine Angst, im Gegenteil, gestand er – vorausgesetzt, er sei erfolgreich, das heißt endgültig, und arte nicht seinerseits wieder in eine politische Gemeinheit aus.
Mit solcher Politikverachtung standen Péguy und Kraus nicht allein. Was aber als antiparlamentarisches Dandytum bei Maurice Barrès oder als Stahlgewitter-Dezisionismus bei Ernst Jünger, was als royalistisch-reaktionärer Kampfruf bei Charles Maurras oder als ästhetische Schwärmerei in Thomas MannsBetrachtungen eines Unpolitischen patriotisch aufflammte, führte bei Kraus und Péguy auf eine andere Ebene: jene der Sprachkritik. Ausgelöst wurden die satirischen Texte bei Karl Kraus oft durch politische Reden, deren Worte ihm schrill im Ohr klangen. Das Wort »Durchhalten« zum Beispiel, ein Ausdruck, an dem, wie er schrieb, die ausgehungerten Wiener im Kriegsjahr 1916 täglich wie an einem rhetorischen Feingebäck knabberten.24 Der Schriftsteller Franz Werfel hielt diese an einzelnen Worten sich entzündende Gesellschafts- und Kulturkritik für überzogen, bezichtigte Kraus der »Nichtigkeit des Anlasses« und fügte boshaft hinzu, dass der, »der die Sprache an allen jenen rächen will, die sie sprechen«, manchmal selbst schlechte Verse schreibe, mit gestelzten Wortungeheuern wie dem Wort »dorten«, das Kraus in einem Text verwende. Ganz richtig, antwortete dieser, nach Hans Sachs, Goethe, Schiller und vielen anderen habe auch er dieses Wort »dorten« benützt, doch sei dem Kollegen Werfel der Hintersinn, den er dem Ausdruck unterlegt habe, offenbar ganz entgangen.25
Der nicht weniger streitselige Péguy konnte sich sogar manchmal über einzelne Buchstaben ärgern. So warf er dem von ihm sonst geschätzten Schriftsteller Victor Hugo vor, Worte wie »Liberté«, »Égalité«, »Fraternité«, »Droit«, »Justice« immer groß, ausgerechnet das Wort »dieu« aber in seiner Légende du siècle beharrlich kleingeschrieben zu haben. Immer wieder waren es Formulierungen aus der literarischen, politischen oder mondänen Aktualität, die den Satiriker Kraus zum Spott und den Polemiker Péguy manchmal zum Zorn veranlassten.
Die kritische westliche Intellektuellentradition steht heute nach mehr als einem Jahrhundert an einem Wendepunkt ihrer Geschichte. Ihre Positionsbestimmungen sind kompliziert, manchmal undurchschaubar, ihr Einfluss ist geringer geworden. Dahinter aber wird jene Stimme wieder hörbar, die lange von der eingespielten formalen Begriffsdialektik zwischen Links und Rechts, Fortschritt und Reaktion, Emanzipation und Rückständigkeit, Freiheit und Unmündigkeit übertönt wurde. Die Botschaft dieser »anderen«, mehr an Sprache als an allgemeinen Denksystemen sich abarbeitenden Intellektuellenstimme zielt nicht auf einen programmierten Bruch mit dem Bestehenden und reißt doch vielleicht tiefere Breschen in die Fundamente unserer Anschauungen als alle revolutionären Programme. Einen »Aufständischen aus den Wurzeln heraus« nannte der Essayist Jean Bastaire den hartnäckigen Neinsager Péguy: einen »Kenotiker« und großen Vernichter etablierter Wahrheiten, in der Nachfolge Pascals, Kierkegaards, Dostojewskis. Man könnte auch an Nietzsche denken, allerdings ohne dessen visionäre Zukunftsmusik, ohne Botschaft vom »Übermenschen« und ohne Berggipfelrhetorik. Ein Nietzschevon unten vielleicht, ein Nietzsche aus dem Volk, mit krummem Rücken und der Entschlossenheit eines Soldaten, Mönchs, Verbrechers oder Heiligen, jener wiederkehrenden Leitfiguren in Péguys Denkhorizont, die außer sich selbst nichts zu verlieren haben.
Vieles erscheint ideologisch vermint bei diesen intellektuellen Querläufern. Der Spötter Kraus liebte Hierarchien und feste Gesellschaftsordnungen, verfluchte die Verbindung von wirtschaftlichem und politischem Liberalismus, nahm zur Rettung des Geistes gern auch Pressezensur oder Barbarenangriffe in Kauf. Der Sozialist Péguy mutierte zum scharfen Kritiker der parlamentarischen Demokratie und zum antimodernen Bewunderer archaischer Werte wie Ehre, Opferbereitschaft, Todesverachtung. Autoritätsnostalgiker, Demokratiekritiker, Reaktionäre, Populisten und Fundamentalisten können sich bei ihm bestens bedienen – und können damit doch wenig anfangen. Denn anregend bleibt Péguy vor allem für jene, die keine fertigen Antworten haben, denen aber die Alleinherrschaft der emanzipatorischen Vernunft, das naive Vertrauen in demokratische Mehrheitsbeschlüsse, die Verabsolutierung der individuellen Freiheit, die Euphorie des Abbaus von Grenzen aller Art, die formale Menschenrechtsgläubigkeit, die Überführung des Guten ins immer Bessere sowie das Vertrauen in technische Problemlösungen manchmal Unbehagen bereiten.
Kindheit
Kindheit ist Vorgeschichte, so lehrt unsere Emanzipationsphilosophie. Kindheit bedeutet Unmündigkeit und ist insofern bedeutsam, als man ihr entwachsen kann. Das erzählen die zahlreichen Kindheitserinnerungen aus der Literatur. »Hätte mein Vater gelebt, hätte er mit seinem ganzen Gewicht auf mir gelastet und hätte mich erdrückt. Zum Glück starb er im jungen Alter« – schrieb Jean-Paul Sartre in Die Wörter.26 Unter all den Aeneas-Brüdern, die auf dem Rücken ihre Väter Anchises mitschleppten, schreite er allein von einem Ufer zum anderen, voll Abscheu für die unsichtbaren Erzeuger auf dem Buckel der Söhne: Sein Vater habe keine Zeit gehabt, sein Vater zu werden, und könnte inzwischen sein Sohn sein. Der vaterlos aufgewachsene Sartre beschrieb mit besonderer Virulenz das Paradox der modernen Intellektuellenbiographie: Man stammt aus einer Familie und einem sozialen Milieu, lässt dies aber nur so weit gelten, wie man es abstößt und hinter sich lässt.
Anders war das bei Charles Péguy. Auch er hat seinen Vater nie gekannt. Der starb mit siebenundzwanzig Jahren im November 1873, geschwächt vom Dienst als Soldat im Deutsch-Französischen Krieg. Dem damals einjährigen Péguy blieb also keine direkte Erinnerung an den Vater. Die Kindheit im Vorstadthäuschen am Quai de Bourgogne in Orléans, die er zusammen mit der in Arbeit sich verausgabenden Mutter und einer des Lesens und Schreibens nicht mächtigen Großmutter verbrachte, war nicht Aufbruch in die Freiheit eines ganz anderen Lebens. Sie war für Péguy eine prägende, dauerhafte Daseinsform. Er blieb Kind nicht nur in dem Sinne, wie man Kind seiner Epoche oder seines Milieus ist. Lebenslängliche Kindheit bedeutete für Péguy das Verharren in einer ungebrochenen Zeitimmanenz, die den großen Befreiungsschlag, die alles ändernde Erleuchtung und den Sprung in ein ganz neues Leben nicht kennt. Dass er das Elternhaus früh verließ, als Student heiratete und selbst bald Vater wurde, steht dazu nicht im Widerspruch. Die Familienväter seien neben den Spielern, Bettlern, Industriellen und einigen anderen »die großen Abenteurer der Moderne«, lautet eine seiner berühmt gewordenen Äußerungen.27
Erwachsen geworden im Sinne Sartres ist Charles Péguy nie. Ein »anderes Ufer« gab es für ihn nicht. Statt Durchgangsstadium war die Kindheit für ihn die prägende Erfahrung eines lebenslänglichen Kampfs gegen jenen Zeitbegriff, der alles über den Kamm eines emanzipatorischen Epochenwechsels schert zwischen »vorher« und »nachher«, unmündig und mündig, unfrei und frei, vormodern und modern. Diese Einstellung schlug sich im Werk nieder. Greifen wir also der Chronologie etwas vor und nähern uns Péguys Kindheit über den Umweg seiner eigenen Dichtung.
Im Januar 1910 – Péguy war damals siebenunddreißig Jahre alt – publizierte er ein langes dramatisches Stück über Johanna von Orléans, Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc. Die Figur dieses Bauernmädchens Johanna hat ihn zeitlebens beschäftigt. Schon anderthalb Jahrzehnte zuvor hatte er als Student ein großes Drama mit dem Titel Jeanne d’Arc verfasst. Der mehrere hundert Seiten umfassende Text von 1910 knüpft an dieses Jugendwerk an und behandelt teils in Versform, teils in Prosa mit Dialogen und langen Monologen die Berufung der Dreizehnjährigen zu ihrem Schicksal. Zwei hinzuerfundene Figuren, Johannas Freundin Hauviette und Madame Gervaise, eine Klosterfrau, sind die einzigen Nebenfiguren im Stück, das eher zur Lektüre als für die Bühne bestimmt war.
Wir befinden uns im lothringischen Dorf Domrémy, im Jahr 1425, es ist Hochsommer. Johanna hütet an einem Hang an der Maas die Schafe. Vom Flussufer her stößt die zehnjährige Hauviette zu ihr. Die beiden Mädchen kommen ins Gespräch über das Leben im Dorf und im Land. Die westlichen Teile des Königreichs Frankreich stehen seit mehreren Generationen unter englischer Herrschaft. Das sei unerträglich, finden die Mädchen, zumal die Engländer immer noch mehr Gebiete einnähmen. Doch was tun? Gegenüber der Ungeduld Johannas vertritt Hauviette den Standpunkt des duldsamen Hinnehmens: Gegen die Wirren dieses Kriegs – es handelt sich um den Hundertjährigen Krieg – könnten sie als einfache Bauernmädchen nichts machen. Madame Gervaise kommt hinzu und plädiert ebenfalls dafür, sich in den Lauf der Dinge zu schicken. Statt zum resignierten Erdulden mahnt sie jedoch zur Duldsamkeit einer höheren Ordnung: dem Hinnehmen im Vertrauen auf die göttliche Fügung. Das Drängen Johannas nach mutigen Taten für Frankreich und für den König tut sie als Anmaßung, Überheblichkeit und eine Versuchung des Teufels ab. Wo nicht einmal Christus am Kreuz die Vermehrung des Übels in der Welt habe aufhalten können, meint sie, wie sollte das einem dreizehnjährigen Bauernmädchen aus Lothringen gelingen?
Tonfall und Inhalt dieser Dichtung spielen mit der doppelten Kinderperspektive aus Einfalt und Durchtriebenheit. Die naiv wirkende, über die politische Lage Frankreichs sich empörende Johanna wird holzschnittartig den beiden anderen Figuren gegenübergestellt. Lange Reprisen von Rede und Gegenrede, die an Gebetslitaneien erinnern – eine für Péguy charakteristische Ausdrucksform –, zeichnen den Text aus. Sie verleihen ihm einen mehr musikalisch suggestiven als logisch diskursiven Zug. Oft ist nicht ganz klar, wie viel Verfremdung und hintergründiger Humor da im Spiel sind. Mitunter glaubt man, den Effekt einer gekünstelten Naivität zu erkennen, wie er beim Douanier Rousseau, bei Alfred Jarry oder Erik Satie zu finden ist.
Johanna will in Péguys Mystère den Hundertjährigen Krieg durch Krieg töten.28 Sie ist Strategin, nicht Pazifistin. Sie will auch die soziale Not lindern, indem sie den hungrigen Kindern um sie herum ihr eigenes Brot verteilt, weiß dabei aber um das Elend der Wohltätigkeit, die die Not in der Welt nicht beseitigt, sondern perpetuiert, und die Freude der Kinder über das geschenkte Stück Brot bereitet ihr Schmerz. Vor allem aber hört Johanna innere Stimmen, die sie zum Handeln antreiben, ihr allerdings nicht verraten, auf welche Art. So wartet das Mädchen in einem Zustand höchster Gespanntheit und zugleich totaler Lähmung auf weitere Botschaften, die nicht kommen. Sie hat gehört, dass am Mont Saint-Michel ein französischer Vorstoß gegen England versucht worden sei, doch mit welchem Ergebnis? Nicht einmal die militärisch-politischen Ereignisse sind ihr bekannt. »Nichts, immer noch nichts«, klagt sie und stellt eine theologische Hochrechnung über das Massenverhältnis des Heiligen in der Welt an.29 Verzeih mir, lieber Gott, wenn ich dir weh tu mit meiner Klage, betet sie zum Himmel, doch wenn es für die Rettung Frankreichs noch nicht genug Heilige gegeben habe, »dann schick uns welche, schick uns so viele wie nötig«.30 Auch nach vierzehn Jahrhunderten Christenheit sei ja möglicherweise das erforderliche Maß an Heiligenleben noch nicht erreicht.
Der braven Hauviette, die auf die natürliche Regeneration aller Dinge nach den Unwettern und Kriegen vertraut, setzt Johanna ihr kindlich aufbrausendes Temperament gegenüber. Sie wird zwar von Madame Gervaise ermahnt, den Mut nicht mit Hochmut zu verwechseln,31 jener Erfindung des Teufels, für welche gerade Kinder besonders anfällig seien – das habe man ja schon beim Christkind in seinen jungen Jahren gesehen. Seinen Eltern habe es große Sorge bereitet, und Maria habe gleich zu Joseph gesagt: Mit dem gibt es noch Ärger, denn kaum habe er sprechen können, habe er schon mit den Gelehrten im Tempel disputiert.32 Dennoch muss auch Madame Gervaise zugeben: Das Heil kommt oft von den Kindern, denn der Gekreuzigte sei selbst ja im Grunde ein Kind geblieben, »ein Kind, das stark gewachsen war«.33
Dieses Bild einer Kindheit, das Frömmigkeit, Auflehnung, Unerschrockenheit, visionäre Ungeduld und Frühreife in sich vereint, war auch im Jugenddrama Jeanne d’Arc schon da, das der Student Péguy 1897 per Subskription im Selbstverlag an seine Mitstudenten verteilt hatte. Das Erwachsenwerden erscheint dort ebenfalls mehr als eine Vertiefung der Kindheit denn als ein Herauswachsen aus ihr. Von der Kindheit emanzipiert man sich nach Ansicht Péguys nie wirklich.
Einem Kritiker, der ihm vorwarf, mit seinem Mystère statt einer kritischen Durchleuchtung der historischen Figur aufgrund der Quellen eine Legenden-Johanna »für die Kleinen« vorgelegt zu haben, antwortete Péguy 1911 mit einem virulenten Gegenangriff. Viel mehr Legende als die Kinderwelt mit ihrer Perspektive »quand nous étions petits« produziere die Wissenschaft mit ihrer Obsession handfester Dokumente und stichfester Beweise, schrieb er.34 Der Wahrheitsanspruch durch wissenschaftliche Beweisbarkeit beruhte in den Augen Péguys ebenfalls auf einer Legende. Bei manchen Phänomenen, fand er, komme man mit Wissenschaftlichkeit nicht weiter und müsse auf eine andere Form von Vernunft zurückgreifen, die der kindlichen Wahrnehmung verwandt ist: eine Kindheit nicht im Sinne von Verniedlichung, Unernst und Spaß, sondern von größerer Ernsthaftigkeit, die, statt mit Hypothesen zu spielen, alles aufs Spiel setzt.
Denn der Ausdruck »quand nous étions petits« geht bei Péguy eng einher mit einer nicht weniger bedeutsamen anderen Formel: jener des »homme de quarante ans«, die der Autor für sich später gern benützte. Das Kind und der Vierzigjährige gehören im Leben zusammen. »Péguy, dieser Mann von vierzig Jahren, weiß genau, wer er ist«, sagt in einem Text von 1913 die Geschichtsmuse Clio vom Autor. Er sehe noch »den kleinen Jungen, von zehn, zwölf Jahren an den Ufern der Loire herumspazieren. Er weiß aber auch, dass Péguy dieser stürmische, finstere, dickschädlige junge Mann von achtzehn Jahren ist, der dann frisch aus Orléans in Paris auftauchte. Er weiß, dass danach (…) die Zeit der Verstellungen begann, dass die Sorbonne, die École normale und die politischen Parteien ihm seine Jugend geraubt haben, nicht aber sein Herz.« Und seit dem Alter von fünfunddreißig oder siebenunddreißig Jahren wisse er endgültig, wer er sei: dies alles in einem, das heißt »ein guter Franzose von der gemeinen Art«.35 Vor diesem Hintergrund muss man Péguys Kinderjahre verstehen.
Sein Ausspruch, im Alter von zwölf Jahren sei im Leben schon alles gelaufen,36 bedeutet nicht einfach Determinierung durch ein soziales, familiäres oder intellektuelles Herkunftsmilieu. Er zielt auf die prägende Verschränkung zwischen persönlichem Alters- und allgemeinem Epochenwechsel. Péguy gehörte zu einer Generation, die in jungen Jahren die Zeitbeschleunigung durch Eisenbahn, Telegraphie und Presse, die Ablösung der bis dahin vorherrschenden Bauern- durch die Stadtkultur, das Zurückweichen des Handwerks gegenüber der industriellen Warenproduktion, die beginnende Herrschaft des Kapitals über Landes- und Kontinentalgrenzen hinweg sowie die Anfänge eines verbindlichen Allgemeinwissens durch die obligatorische Volksschule am eigenen Leib miterlebt hat. Der Unterschied zwischen »früher« und »heute« wurde für jene Generation zur Herausforderung, der man sich stellen musste – dafür oder dagegen. »Ein Kind, das zwischen 1873 und 1880 in einer Stadt wie Orléans aufwuchs, stand wahrhaftig noch in Berührung mit dem alten Frankreich, dem alten Volk, dem Volk schlechthin«, schrieb Péguy im Rückblick.37 Er bestand wie wohl kein anderer Intellektueller seiner Generation zeitlebens darauf, trotz seines Milieuwechsels als ein Kind aus der Provinz und aus dem Volk verstanden zu werden.
In das Haus am Quai de Bourgogne in der Vorstadt von Orléans war die Großmutter Étiennette Quéré wahrscheinlich um die Mitte des 19. Jahrhunderts zusammen mit ihrer etwa zehnjährigen Tochter Cécile Quéré, Péguys Mutter, gekommen. Étiennette stammte aus einer Holzfäller- und Landarbeiterfamilie aus der Gegend von Moulins im Département Allier, etwas weiter loireaufwärts. Sie hatte als Kuhmagd gearbeitet und nie eine Schule besucht. In Orléans hoffte sie auf ein besseres Auskommen. Mit ihren Erzählungen vom Leben auf dem Land mit »Werwölfen, Irrlichtern, Gespenstern und Hexen«38 bürgte sie dem Kind Péguy für die Konstanz der Überlieferung aus der schriftlosen Volkstradition.
Die 1846 in Moulins geborene Cécile Quéré, Péguys Mutter, arbeitete in Orléans zunächst in einer Fabrik und lernte dann das Handwerk des Polsterstuhlstopfens. Im Januar 1872 heiratete sie den ebenfalls 1846 geborenen Désiré Péguy, einen Winzersohn aus der Gegend von Orléans, der als Schreiner tätig war. Im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 tat Désiré bei der Verteidigung der französischen Hauptstadt Dienst und kehrte krank zurück. Er starb zehn Monate nach der Geburt seines einzigen Sohns Charles am 18. November 1873. Zusammen mit der Stuhlstopferin Cécile und der sich um den Haushalt kümmernden Großmutter Étiennette wuchs Charles als Einzelkind auf.
Ein fester Tagesablauf, bescheidene Häuslichkeit, wenige Außenkontakte und Arbeit von morgens bis abends im eingeschossigen Zweizimmerhäuschen prägten die nicht unglücklichen Kinderjahre, die Péguy in einer unvollendet gebliebenen Lebensskizze unter dem Titel Pierre, commencement d’une vie bourgeoise hinterließ. Das 1898 entstandene, durch das Pseudonym Pierre auf Distanz gesetzte autobiographische Fragment beschreibt ein nachträglich wohl etwas überzeichnetes Kindheitsidyll. »Mein ganzes Leben lang wird mir die Erinnerung an die geliebte Arbeit im warmherzig arbeitsamen Häuschen teuer sein«, heißt es.39 Im engen Flur habe das auf die Verarbeitung wartende Stroh sich bis zur Decke gestapelt. Auf der Haustürschwelle wurden mit dem Hammer die Strohhalme geschmeidig geschlagen. Und die Art, wie die Mutter die Halme schlug, schnitt und presste, wie die Großmutter allmorgendlich mit dem Besen den Abfall durchs Zimmer über die Türschwelle bis zum Rinnstein wischte, wie die Straßenkehrer dort ein- bis zweimal die Woche mit dem Pferdewagen den Müll abholten – all diese Alltagsverrichtungen werden im Text mit einer zärtlichen Aufmerksamkeit für jede einzelne Geste geschildert.
Der Vater, »ein sanfter, kleiner, ernsthafter und duldsamer Mann«,40 ist für Péguy eine vage, ferne Phantasiegestalt geblieben. Es scheint nicht oft von ihm die Rede gewesen zu sein. Ein Brief von ihm aus dem Krieg, den die Mutter zusammen mit einem hart gewordenen Stück Brot aus der Soldatenzeit in Paris sorgsam aufbewahrte, waren die einzigen Lebenszeugnisse. Das Auskommen des bescheidenen Haushalts ruhte ganz auf den Schultern der Mutter. Diese Frau mit einem ausgeprägten Sinn fürs Praktische, die zu den begehrtesten Stuhlflickerinnen von Orléans gehörte, brachte dem Sohn früh das Lesen und Kopfrechnen bei. Ohne ihre Arbeit zu unterbrechen, setzte sie den Kleinen auf einen Schemel neben sich und blickte, während sie weiter Stroh in die Stühle stopfte, hie und da über die Schultern ins Heft. So konnte der Junge, als er 1879 mit sechs Jahren in die Schule eintrat, schon lesen und rechnen.
Obligatorisch war der Unterricht in Frankreich damals noch nicht, das sollte erst drei Jahre später mit dem Gesetz des Bildungsministers Jules Ferry kommen, das für die ganze Republik den allgemeinen, kostenlosen und religiös neutralen Grundschulunterricht für alle einführte. Öffentliche Schulgebäude standen aber schon reichlich bereit. So konnte Madame Péguy ihren Sohn in der nur ein paar Schritte vom Haus entfernt gelegenen École primaire annexe einschreiben. Der dreiflüglige Neubau mit den hohen Fenstern war eine Nebenstelle der École normale d’instituteurs du Loiret in Orléans, in der die angehenden Volksschullehrer ihre ersten Praxisjahre absolvierten. Diese »schwarzen Husaren« der Republik im öffentlichen Schuldienst wurden für Péguy bald zu leuchtenden Vorbildern des Gemeinwohls. Ihr Bemühen, durch Wissen und kritisches Denken das Volk zu einer Staatsbürgergemeinschaft zu machen, hat er zeitlebens in Ehre gehalten.
Mit dem Glockenschlag morgens um acht Uhr begann im Schulhof der École annexe in der Rue de Bourgogne ein »wunderbares und unerwartetes Schauspiel«, erinnerte der Autor sich später schwärmend. Auf ein Kommando der Lehrer durch Händeklatschen stellten die Schüler sich in Reih und Glied, die Kleinen vorn, die Größeren hinten. Nach erneutem Klatschen setzten sie sich in Bewegung, und auf ein weiteres Signal hin verschwanden sie singend im Gleichschritt in den Klassenräumen. »Das berührte mich, ich hätte weinen können«, notierte Péguy.41 Nie hätte er gedacht, dass man »so im Gleichschritt singen und marschieren könne«.
Ist das schon die Stimmung, mit der er im August 1914 als Soldat in den Krieg zog? Fest steht, dass dieser Mann mit der gestochen scharfen Schülerhandschrift, deren Buchstabenreihen bis in die letzten Lebensjahre wie Soldaten auf dem Appellplatz gerade standen, wenig übrig hatte für individuellen Eigensinn. Verzappelte Frühreife oder genialische Spätblüte waren nicht seine Sache. Weder ein »barbarisches Zu früh« noch ein »byzantinisches Zu spät«! – mahnte er später trocken42 und plädierte für das Maß des Klassischen in allen Dingen: »le classique exact«. Dieses Maß erkannte er in der »vollendeten, wohltuenden Regelmäßigkeit«43 des Schulgebäudes hinter dem Gittertor mit den Lettern »École normale primaire« im Faubourg de Bourgogne.
Die Schule als Zwangsanstalt, die anderen Zöglingen wie dem Törleß bei Robert Musil, Hanno Buddenbrook bei Thomas Mann, dem jungen Träumer in Portrait of the Artist as a Young Man von James Joyce und den zahlreichen anderen Junggenies nur Fesseln anlegte, ist in Frankreich nicht zum Topos für Langeweile geworden. Allenfalls bei Marcel Proust oder in André GidesDie Falschmünzer





























