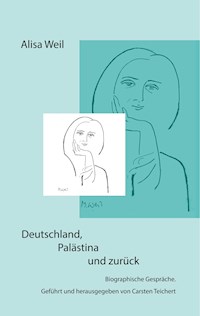
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Biografische Gespräche mit Alisa Weil über Ihre Jugend im Palästina der Mandatszeit, sowie über Ihr Leben in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Annemarie Renger
Vorwort
Carsten Teichert
Einleitung zur 1. Auflage
Erster Teil
Deutschland
Zweiter Teil
Palästina
Dritter Teil
Und zurück in Deutschland
Carsten Teichert
Nachwort zur 2. Auflage
Anhang 1
Presseartikel
Anhang 2
Glossar hebräischer Wörter
Meiner Schwester Rinah
Annemarie Renger
Vorwort
Vor vielen Jahren habe ich Alisa und ihre Familie kennengelernt und war gleich von ihrer Lebhaftigkeit und Natürlichkeit sehr beeindruckt. All die schwierigen Lebenswege und dramatischen Begebenheiten schienen ihrer Lebensbejahung nichts anhaben zu können. Hier in Deutschland hat sie zusammen mit ihrem Mann, dem Maler Manfred Weil, einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Die Bilder, die Manfred Weil malt und die Alisa mit großem Eifer und Liebe den interessierten Menschen nahebringt, sind auch ein Ausdruck dieses glücklichen Zusammenlebens. Mehrere Bilder von Manfred Weil hat der Deutsche Bundestag angekauft.
So überzeugend, wie Alisa Weil als Mensch ist, so eindrucksvoll ist die nur scheinbar einfache Schilderung ihres Lebensweges. In diesem Zwiegespräch zwischen Alisa Weil und Carsten Teichert wird die Zeit der freiheitlichen demokratischen Republik von Weimar genauso lebendig wie das darauffolgende nationalsozialistische Regime, das eine ständige Bedrohung ihres jüdischen Vaters und damit der gesamten Familie bedeutete.
Über die Schweiz gelangte die Familie dann unter schwierigen Umständen in das damalige Palästina. Mit ihrer ganzen Impulsivität, ja mit Leidenschaft, schildert Alisa ihre Zeit im Kibbuz und in der Haganah, während der sie als junges Mädchen den Beginn des jüdischen Staates sah. Aber auch hier hatte sie sich bei aller Hingabe für eine Idee ein kritisches Urteil bewahrt. Selten jedoch habe ich die Darstellung dieser Mandatszeit vor der Gründung des Staates Israel so realistisch und in ihrer Einfachheit so eindrucksvoll geschildert gesehen wie in Alisas Worten.
Ganz ihrer jüdischen Herkunft bewusst, muss es ein Schlag für ihre Identität gewesen sein, als man diese bestritt, weil ihre Mutter nicht jüdischen Glaubens war. So ist es sehr verständlich, dass sie, nachdem die Familie 1948 nach Deutschland zurückgekehrt war, allein nach Israel zurückgehen wollte. Dass sie dennoch in späterer Zeit in Deutschland wieder eine Heimat gefunden hat, ohne ihr geliebtes Israel zu vergessen, spricht auch für ihre Entscheidungsfreudigkeit. So bleibt sie beiden „Heimatländern“ verbunden und überlässt uns ein mit allen Facetten geschildertes buntes Leben, das für hoffentlich viele Leser auch Zeitgeschichte ist.
Dr. h. c. Annemarie Renger Bundestagspräsidentin a. D.
Carsten Teichert
Einleitung zur 1. Auflage
Alisa Weil lernte ich im Januar 1994 auf einer Wochenendtagung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Bonn kennen. Kurze Bemerkungen über ihre in Palästina verbrachte Jugend und ihre Rückkehr in das zerstörte Nachkriegsdeutschland weckten mein Interesse; ich bat sie daher um ein Interview, das sie mir auch gewährte. Aus dem einen Treffen entwickelte sich eine Vielzahl von Gesprächen. Das vorliegende Protokoll stellt eine gekürzte und überarbeitete Fassung dieser auf Tonband aufgenommenen Interviews dar.
Frau Weil, die 1931 in Stettin geboren wurde, lebt heute mit ihrem Mann, dem Maler Manfred Weil, dessen künstlerisches Werk sie auch betreut, in Meckenheim bei Bonn. Ihre Erinnerungen gliedern sich wie von selbst in drei etwa gleichgewichtige Teile. Der erste Abschnitt enthält die Geschichte ihrer Familie, wie Frau Weil sie als Kind und Jugendliche selbst von ihren Eltern erzählt bekommen hat. In ihrer Familie vereinigten sich zwei ganz unterschiedliche Lebenswelten in derselben Stadt: stammte ihre Mutter aus einer seit drei Generationen sozialdemokratischen Familie, so wurde bereits Frau Weils Urgroßvater zur Zeit der Sozialistengesetze aus Stettin verbannt, und ihre Großmutter Else Höfs gehörte zu den ersten Frauen, die nach 1919 in den Reichstag gewählt wurden, und war Mitbegründerin der Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO. Ihr Vater hingegen kam aus einer alteingesessenen assimilierten jüdischen Kaufmannsfamilie, die von der Machtergreifung der Nationalsozialisten überrascht wurde und später zu einem großen Teil dem nationalsozialistischen Massenmord an den europäischen Juden zum Opfer fiel.
Im Dritten Reich durfte ihr Vater seinen Lehrerberuf nicht ausüben; ihrer Mutter, von Beruf Fürsorgerin, wurde aufgrund ihrer Verheiratung mit einem Juden gekündigt. Schließlich wurden beide wegen ihrer sozialdemokratischen Widerstandstätigkeit der Gestapo verdächtig. Rechtzeitig gewarnt, kehrten sie von einem Ferienaufenthalt in der Schweiz nicht mehr nach Deutschland zurück. Die Schweizer Behörden gewährten ihnen daraufhin gnadenhalber ein halbes Jahr Asyl, in dem sie verzweifelt versuchten, einen Zufluchtsort für sich und ihre beiden kleinen Töchter zu finden. Nur aufgrund der Großherzigkeit einer ihnen völlig unbekannten Schweizerin gelang es der Familie schließlich, in das damalige britische Mandatsgebiet Palästina auszuwandern.
Ist dieser erste Abschnitt des Protokolls im Wesentlichen eine Zusammenfassung der an Frau Weil weitergetragenen Familiengeschichte, so gibt der zweite Teil, der ihre Kindheit und Jugend im damaligen Palästina in den Jahren 1937 bis 1947 schildert, die Erinnerungen der Protagonistin selber wieder. Ihr Bericht über den Aufenthalt der Familie in einem Kibbuz, einer ländlichen Kollektivsiedlung mit gemeinsamem Eigentum, über ihre Erlebnisse in Kinderheimen sowie über ihre Tätigkeit in der jüdischen Untergrundarmee Haganah besticht durch seine Lebendigkeit und die Genauigkeit der Beobachtungen aus der kindlichen und jugendlichen Perspektive.
Anfang 1948 kehrt die Familie in das zerstörte Nachkriegsdeutschland zurück, weil ihre Eltern sich als überzeugte Sozialdemokraten am Wiederaufbau der Demokratie in Deutschland beteiligen wollen. Während sie sich sofort wieder in ihrem speziellen deutsch-sozialdemokratischen Milieu einrichten und wohlfühlen, versucht Frau Weil, die nicht freiwillig mit in das ihr fremde und unwirtliche Land gekommen ist, wiederholt in ihr vertrautes und liebgewonnenes jetziges Israel zurückzukehren. Widrige Umstände sowie eine über viele Jahre währende schwere Erkrankung verhindern dies jedoch. Statt dessen stellt sie sich immer wieder als Zeitzeugin zur Verfügung und widmet viel Zeit und Kraft dem Versuch, vor allem die Jugend in Deutschland über die jüngste Geschichte aufzuklären und zu zeigen, „dass ein Jude ein Mensch ist wie jeder andere auch“.
Da das Protokoll der Gespräche mit Frau Weil eine Vielzahl verschiedener historischer Komplexe berührt, erschien es mir sinnvoll, den einzelnen Abschnitten kurze historische Einführungen voranzustellen, die sich mit der Geschichte der Juden in Deutschland bis 1933, den politischen Verhältnissen im Palästina der Mandatszeit sowie dem jüdischen Leben im Nachkriegsdeutschland befassen. Ferner finden sich in den Fußnoten kurze biographische Angaben zu den von Frau Weil erwähnten geschichtlichen Persönlichkeiten. Alle hebräischen Begriffe werden kursiv gedruckt und bei ihrem ersten Erscheinen erläutert; außerdem finden sich in einem Anhang die mehrfach verwendeten Begriffe.
Köln, im April 1999
Dr. Carsten Teichert
Erster Teil
Deutschland
Spuren jüdischen Lebens lassen sich auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands seit der Spätantike als Folge der römischen Herrschaft über Teile Germaniens nachweisen. Im Frühmittelalter waren jüdische Fernhandelskaufleute ein geachteter Teil des fränkischen Wirtschaftslebens, ehe sich dann seit dem zehnten Jahrhundert eine stetig steigende Anzahl jüdischer Niederlassungen sowie die Existenz auch größerer Gemeinden nachweisen lassen. Nun bildeten sich auch die Grundformen der Sitten und Gebräuche des sogenannten aschkenasischen, in Deutschland ansässigen Judentums heraus, das seine Blüte in den Gemeinden entlang des Rheins erlebte. Herausragende Zentren waren die Städte Mainz, Worms und Speyer.
Allerdings ging die bis ins 14. Jahrhundert kontinuierlich wachsende Zahl jüdischer Gemeinden bereits mit einem wirtschaftlichen Niedergang einher. Aus dem Fernhandel zunehmend verdrängt, ergriffen immer mehr Juden den Beruf des Geldwechslers und -verleihers, der Christen aufgrund des kanonischen Zinsverbots an sich untersagt war, oder schlugen sich als Klein- und Trödelhändler durchs Leben, da ihnen in der Regel der Erwerb von Grundbesitz verboten sowie das Ausüben eines Handwerks durch die rigiden Zunftverordnungen versperrt waren. Hinzu kam eine steigende religiöse Intoleranz der christlichen Umgebung. So ereigneten sich erstmals während des Ersten Kreuzzugs von 1096 weit um sich greifende Pogrome, die sich während der folgenden Kreuzzüge wiederholten. Ihren schrecklichen Höhepunkt erreichten die Ausschreitungen anlässlich der Pestepidemie von 1348, für die vielerorts die Juden verantwortlich gemacht wurden.
Neben der angeblichen Brunnenvergiftung wurden auch die Schlachtung christlicher Kinder und die Schändung von Hostien zu beliebten Versatzstücken der antijüdischen Schmähschriften, die in der ganzen lateinischen Christenheit Verbreitung fanden. Die Expansion des christlichen Antijudaismus führte bereits Ende des 13. Jahrhunderts zur Ausweisung der Juden aus England, zu periodisch wiederkehrenden Ausweisungen aus Frankreich und schließlich zur Vertreibung aus Spanien im Jahre 1492.
Als Reaktion auf die zunehmenden Verfolgungen und wirtschaftlichen Beschränkungen im Spätmittelalter verließen viele Juden Deutschland und wanderten nach Osten, vor allem nach Polen. Sie nahmen dabei ihre mittelhochdeutsche Sprache mit, die sich, angereichert mit Elementen aus verschiedenen slawischen Sprachen und aus dem Hebräischen, in der Neuzeit zur Umgangssprache der Juden in ganz Mittel- und Ostmitteleuropa entwickelte, nämlich zum Jiddisch.
Allerdings gab es neben der Verfolgung stets auch ein friedliches Nebeneinander von Christen und Juden und von Seiten der diversen geistlichen und weltlichen Obrigkeiten durchaus Versuche, die Juden zu schützen, zumal ihre Steuerkraft geschätzt wurde. Im Deutschen Reich standen sie verfassungsrechtlich als „königliche Kammerknechte“ unmittelbar unter dem Schutz des Königtums, dessen chronische Finanznot sie im Gegenzug mittels des Judenregals linderten. Aufgrund der Tatsache, dass die Judenbesteuerung in immer stärkerem Maße vom Königtum an untere Herrschaftsinstanzen verpfändet wurde, entwickelte sich die Finanzkraft der Juden jedoch langfristig zu einem beliebten Streitobjekt zwischen Königtum, Territorialherren und Städten. Sie gerieten zwischen die Fronten vielfältiger und verworrener Auseinandersetzungen divergierender Kräfte. Mitte des 14. Jahrhunderts begann sich daher die Praxis einzubürgern, dass Juden, die sich in Städten ansiedeln wollten, zuvor einen „Schutzbrief“ mit der städtischen Obrigkeit abschließen mussten, der ihnen gegen festgelegte jährliche Zahlungen ein befristetes Aufenthaltsrecht und Schutz vor Verfolgungen versprach.
Im 15. Jahrhundert verschlechterte sich die rechtliche Stellung der Juden weiterhin, sie wurden nun aus vielen Städten ausgewiesen oder ihr Wohngebiet wurde mit Mauern von der christlichen Umgebung abgeschlossen. Jetzt entstanden – anknüpfend an die „Judengassen“ des Spätmittelalters und benannt nach dem jüdischen Wohnviertel Venedigs – die ersten Ghettos, die irrtümlicherweise in der Regel mit dem Attribut „mittelalterlich“ belegt werden, obwohl sie doch tatsächlich ein Produkt der frühen Neuzeit sind. Nach der Ausweisung aus den meisten größeren deutschen Städten entwickelte sich ein kleinstädtisches und ländliches jüdisches Leben, das neben den bedrückenden Verhältnissen in den Ghettos nun für mehrere Jahrhunderte charakteristisch blieb.
Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts begann mit dem Zeitalter der Aufklärung der Auszug aus dem Ghetto. Ausgehend von Preußen und Österreich setzte Schritt für Schritt, aber wenig gradlinig, die Emanzipation der Juden in den verschiedenen deutschen Partikularstaaten ein, die ihren Abschluss in der formalen Gleichstellung nach der Bismarckschen Reichsgründung im Jahr 1871 fand. Philosophen, Schriftsteller, Komponisten und Künstler jüdischer Abstammung wurden seit Mitte des 18. Jahrhunderts zu einem unverzichtbaren Bestandteil des kulturellen und geistigen Lebens in Deutschland. Allerdings war an die angestrebte „bürgerliche Verbesserung der Juden“ (so der Titel der epochalen Schrift des preußischen Staatsrats Christian Wilhelm Dohm aus dem Jahre 1781) die Erwartung geknüpft, sie zu „nützlichen Staatsbürgern“ zu erziehen. Man verlangte zwar nicht, dass die Juden Christen würden, aber man erwartete doch, dass sie aufhören würden, Juden zu sein.
Von jüdischer Seite aus wurde die obrigkeitliche Emanzipation mit einer nahezu uneingeschränkten Assimilation beantwortet, einer Anpassung an die gesellschaftlichen und kulturellen Werte der christlichen Mehrheit. Deutschland entwickelte sich zu dem kulturellen und geistigen Zentrum des europäischen Judentums. Jahrhundertelang tradierte religiöse und kulturelle Werte wurden von einer großen Majorität nur mehr als Ballast empfunden. Analog zur christlichen Umwelt säkularisierten sich auch die deutschen Juden und empfanden sich nun als „deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens“, wie es im vollständigen und programmatischen Titel der bedeutendsten jüdischen Organisation, des Centralvereins1, zum Ausdruck kam.
In zunehmendem Maße befreit von jahrhundertealten Beschränkungen erreichten Juden auch in den dynamischen Feldern des wirtschaftlichen Lebens, im Börsen- und Kaufhauswesen, sowie im akademischen Bereich eine Stellung, die ihren proportionalen Anteil an der deutschen Bevölkerung bei weitem überstieg. Ausschlaggebend hierfür war dabei jedoch weder die von Antisemiten so gern beschworene angebliche „jüdische Raffgier“ noch die von Philosemiten ins Feld geführte besonders ausgeprägte „jüdische Intelligenz“. Vielmehr traf hier der im Judentum hoch geschätzte Wert von Bildung jeglicher Ausprägung auf ein Zeitalter, in dem sich zunehmend Bildung statt Geburt und Herkunft zum Motor des gesellschaftlichen Aufstiegs entwickelte.
Trotz der imposanten Resultate der Assimilationsepoche sowie der beeindruckenden Galerie deutscher Nobelpreisträger jüdischer Herkunft gilt es darauf hinzuweisen, dass zumindest ein Grundaxiom des liberalen Judentums in Deutschland offensichtlich auf einer Fehlwahrnehmung beruhte, nämlich der angeblichen Existenz einer deutschjüdischen Symbiose, die bis zum heutigen Tage so gerne in Sonntagsreden beschworen wird. Denn eine Verschmelzung lässt sich in den sechzig Jahren, die zwischen dem Abschluss des rechtlichen Emanzipationsprozesses im Jahre 1871 und der Annullierung eben dieser Emanzipation durch den Nationalsozialismus nach 1933 lagen, nicht nachweisen. Dieser Prozess verlief immer nur in eine Richtung, nämlich hin zur Anpassung der Juden an ihre Umwelt – eine Umwelt im Übrigen, die ihnen oftmals alles andere als freundlich gesinnt war. Man verkehrte mit Juden zwar geschäftlich und bei offiziellen Anlässen, aber in der Regel nicht privat. Der vielfach hundertzwanzigprozentige Patriotismus der deutschen Juden ist daher auch von Gerschom Scholem zu Recht als eine „einseitige, weil unerwiderte Liebesbeziehung“ bezeichnet worden.
Denn obwohl die formale Gleichstellung der Juden in Deutschland vor 1933 bestehen blieb, gab es doch starke gesellschaftliche Restriktionen. So war es praktisch für Juden unmöglich, beim Militär, der wichtigsten und prestigeträchtigsten Institution des wilhelminischen Deutschland, Karriere zu machen. Auch in der wissenschaftlichen Welt waren die Aufstiegsmöglichkeiten für Juden durch einen unsichtbaren numerus clausus stark beschränkt. Außerdem entwickelte sich bereits seit den siebziger Jahren und in manifester Form spätestens seit den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in Deutschland sowie zeitgleich auch in Großbritannien und Frankreich ein starker gesellschaftlicher Antisemitismus. Seine Dynamik erwuchs unter anderem daraus, dass er sich teilweise im Gegensatz zu, teilweise jedoch auch im Verbund mit dem als traditionell zu bezeichnenden christlichen Antijudaismus eine pseudowissenschaftliche „rassische“ Grundlage konstruierte. Man übertrug Charles Darwins Lehre vom „Kampf ums Dasein“ unter den Arten nahtlos auf die in Rassen aufgeteilte Menschheit, wobei der „jüdischen Rasse“ „Minderwertigkeit“ unterstellt wurde. So entstand in Westeuropa ein weitverbreiteter antisemitischer Konsens, dessen besondere Gefährlichkeit in Deutschland aus der Tatsache resultierte, dass er sich hier zum einigenden ideologischen Band für eine vielfach zersplitterte politische Rechte entwickelte.
Zudem avancierte „der Jude“ als Protagonist des Fortschritts für diejenigen zu einer Projektionsfläche ihrer negativen Empfindung, die selbst nicht an der Entwicklung teilnehmen konnten. Ferner übertrug man den zunächst auf die Freimaurer und andere Logen bezogenen Vorwurf einer geheimen Weltverschwörung nun auch auf das Judentum; beispielsweise in der Vorstellung der Weisen von Zion2.
So wurde nicht nur in Deutschland eine Art von phantomhaftem Antisemitismus wirksam, der nicht den einzelnen Juden betraf, sondern im Sinne eines seit Jahrzehnten kultivierten Ganzheitswahns das „Weltjudentum“. Diesem anzugehören bedeutete demnach für den einzelnen, womöglich „anständigen“ Juden sozusagen sein persönliches Unglück.
Im Ersten Weltkrieg verstärkte sich die antisemitische Propaganda und fand ihren Niederschlag auch im staatlichen Handeln. Die vom preußischen Kriegsministerium angeordnete „Judenzählung“ im deutschen Heer von 1916, die eine gefällige Reaktion auf die antisemitische Propagandalüge darstellte, die Juden würden sich vor dem Kriegsdienst drücken, bildet aus der Retrospektive gesehen eine wichtige Zäsur. In der Weimarer Republik erreichte der Antisemitismus nicht nur in der Propaganda neue Höhen. So kam es 1923 im Berliner Scheunenviertel, in dem besonders viele jüdische Flüchtlinge aus Osteuropa lebten, zu gewaltsamen antijüdischen Ausschreitungen. Der wirtschaftliche Aufschwung in den fünf „guten Jahren“ der Weimarer Republik von 1924 bis 1929 führte dann zunächst zu einer Abschwächung dieser Entwicklung. Die durch die Weltwirtschaftskrise ausgelöste Massenarbeitslosigkeit und Verelendung breiter Schichten machte dann jedoch den unterschwellig schon lange weitverbreiteten Antisemitismus in Deutschland mehrheitsfähig. Bei den Reichstagswahlen im September 1930 wurde die NSDAP, die zuvor nur eine rechtsextreme Splitterpartei gewesen war, mit 108 Mandaten zweitstärkste Fraktion im Reichstag, und am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler von Reichspräsident Hindenburg zum Reichskanzler ernannt.
Die Nationalsozialisten begannen unmittelbar nach ihrer innenpolitischen Konsolidierung mit der Revidierung der Emanzipation der Juden in Deutschland. Diese war, was nach dem Zweiten Weltkrieg gerne schamvoll verschwiegen wurde, nicht nur ein Ziel der NSDAP, sondern innerhalb der gesamten politischen Rechten populär. Für die meisten deutschen Juden kam diese Entwicklung hingegen völlig überraschend. Von den etwa 100.000 ostjüdischen Flüchtlingen einmal abgesehen, die sich vor allem in Berlin angesiedelt hatten, waren sie in der Regel seit mehreren Generationen in Deutschland ansässig und fühlten sich vollkommen assimiliert. Der Atavismus des nationalsozialistischen Antisemitismus, der nun zu einer Art von Staatsreligion erhoben wurde, traf sie daher unvorbereitet.
In einer ersten Phase wurde bis 1938 auf bürokratischem Wege durch etwa tausend Einzelverordnungen das jüdische Leben in Deutschland entrechtet, beschnitten und an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Einen ersten Höhepunkt dieser Entwicklung bildeten die Nürnberger Gesetze vom September 1935, die neben einer Vielzahl von diskriminierenden Vorschriften den Juden auch das deutsche Staatsbürgerrecht aberkannten. Nach den Olympischen Spielen von 1936 begann die Verdrängung der Juden aus der Wirtschaft durch die als „Arisierung“ umschriebene Beraubung und Ausplünderung. Gleichzeitig waren Juden auf dem Lande und in kleineren Gemeinden vielfach der Terrorisierung durch ihre Nachbarn ausgesetzt, was zu einer Fluchtbewegung in die großen Städte führte, in deren Anonymität es sich noch vergleichsweise unbelästigt leben ließ. Auch dieser Zustand änderte sich jedoch bald.
Das Jahr 1938 brachte in dem Maße, in dem das sogenannte Dritte Reich keine politischen Rücksichten mehr zu nehmen brauchte, eine Radikalisierung der hiesigen „Judenpolitik“ mit sich. Während des von staatlicher Seite aus organisierten Pogroms vom 9./10. November 1938, der im Nachhinein lange Zeit als „Reichskristallnacht“ verniedlicht wurde, zündete man nicht nur viele hundert Synagogen im Reichsgebiet an. Über hundert Menschen wurden ermordet und viele Tausende in die berüchtigten nationalsozialistischen Konzentrationslager deportiert. Bis zu diesem Zeitpunkt waren etwa 150.000 Juden aus Deutschland ausgewandert, nun folgten bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs etwa 100.000 weitere.
Hatte es sich in den ersten fünf Jahren des NS-Regimes jedoch in der Regel noch um eine geordnete Auswanderung gehandelt, deren Ziele neben den westeuropäischen Nachbarstaaten vor allem die USA und Palästina bildeten, so entwickelte sich nun eine panische Fluchtbewegung. Verzweifelt versuchten die Juden aus Deutschland herauszukommen, während immer weniger Staaten auf der Welt bereit waren, sie als Flüchtlinge aufzunehmen. So kam es, dass allein 20.000 deutsche Juden schließlich in Schanghai landeten, nur weil die damals unter japanischer Kontrolle stehende Stadt kein Visum bei der Einreise verlangte. Wem es nicht mehr gelang, rechtzeitig aus Deutschland zu fliehen, der saß nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in der Falle. Etwa 200.000 deutsche Juden wurden seit Oktober 1941 in den Osten deportiert und fielen dort den deutschen Mordmaßnahmen zum Opfer.
***
Frau Weil, Sie wurden in Stettin geboren, das heute zu Polen gehört. Haben Sie noch Erinnerungen an diese Stadt?
Nicht nur ich, meine ganze Familie, Vater, Mutter und auch meine Großeltern stammen aus Stettin. Ich wurde am 4. Februar 1931 geboren und bekam den Namen Angelika Magda Else Levin. Angelika nach dem Titel eines Buches, das meine Mutter sehr geliebt hat; Magda – so hieß eine Schwester meines Vaters, und Else war der Name meiner Großmutter. Meine Schwester wurde 1936 geboren und Renate Irmgard Lydia genannt. Unsere hebräischen Namen haben wir erst später in Israel bekommen. Meine Eltern wären ja gar nicht auf die Idee gekommen, einen hebräischen Namen für uns auszusuchen. Mein Vater Werner Levin stammte zwar aus einer angesehenen jüdischen Familie, hatte aber zeitlebens mit der jüdischen Religion nichts zu tun, während meine Mutter Grete Levin, geborene Höfs, Nichtjüdin war. Meine Eltern waren beide religiös überhaupt nicht festgelegt, meine Mutter war noch nicht einmal getauft worden. Beide wurden im Jahre 1901 geboren und waren schon in ihrer Jugend überzeugte Sozialdemokraten. Mein Vater kam zwar aus einer jüdischen Familie, die sich weitgehend noch an die jüdischen Riten hielt, zum Beispiel im Haushalt, aber vor allem deshalb, weil immer ein Großelternteil bei ihnen wohnte. Die hätten unkoscheres Essen nicht angerührt, da sie alle noch sehr religiös waren. Deshalb hat meine Großmutter noch eine koschere Küche geführt, meine Großeltern selbst aber waren liberale Juden, das heißt, sie gingen zwar an den hohen jüdischen Feiertagen in die Synagoge, wie sich das gehört, aber waren grundsätzlich liberal.Wenn ich Sie richtig verstehe, bezieht sich das liberal auf ihre religiöse Einstellung, etwa im Sinne von religiös indifferent. Wie weit ging diese Gleichgültigkeit? Haben sie beispielsweise an Weihnachten einen Tannenbaum aufgestellt?
Nein, das gab es bei meiner Mutter in der Familie, aber nicht bei meinem Vater. Als ich 1931 geboren wurde, waren die Eltern meines Vaters bereits tot. Mein Großvater, Arthur Levin, hatte in den zwanziger Jahren einen Schlaganfall erlitten, von dem er sich nicht mehr erholte. Er hat danach aber noch einige Jahre gelebt, in denen er bettlägerig war. Arthur Levin war ein erfolgreicher Geschäftsmann gewesen, ein Tuchhändler im Großhandel, das heißt, er bekam Muster von Stoffen, zum Beispiel aus England, und reiste damit durch Deutschland. Er erhielt dann eine Provision von den Herstellern für die Bestellungen, die bei ihm gemacht wurden. Dieses Geschäft florierte vor dem Ersten Weltkrieg, so dass er seine ganze Familie immer gut ernähren konnte. Aber nach dessen Schlaganfall musste mein Vater das Geschäft übernehmen. Und das führte dann bald zu Auseinandersetzungen, weil mein Großvater nicht verstehen konnte, dass es damals nach dem Ersten Weltkrieg wirtschaftlich schwere Zeiten waren, zumal dann plötzlich 1923 auch noch die Inflation dazukam. Mein Großvater kam nicht auf die Idee, der wirtschaftliche Misserfolg könnte etwas mit den schlechten Zeiten zu tun haben, sondern machte seinen Sohn dafür verantwortlich, den er für nicht lebenstüchtig genug hielt. Allerdings hatte mein Vater wirklich weder Neigung noch Eignung zum Geschäftsmann. Von frühester Kindheit an liebte er es zu lesen und war ein richtiger Büchermensch. Sein Berufswunsch war Lehrer gewesen. Seinem Vater zuliebe hatte er jedoch eine Lehre im Buchhandel gemacht; das hatte dann etwas mit Handelswesen zu tun, aber eben auch mit Büchern. Meinem Vater machte es also die allergrößte Mühe, mit diesem Geschäft die gesamte Familie zu ernähren, das waren ja immerhin acht Personen: Vater, Mutter, vier Mädchen, er und noch ein kleiner Bruder. Und mein Großvater glaubte, dass meinem Vater das Geschick für das Geschäft fehle und der wirtschaftliche Niedergang darauf zurückzuführen sei, dass er nicht von Anfang an mit Enthusiasmus in das Familienunternehmen eingestiegen war, und machte ihm dementsprechend Vorwürfe. Nachdem mein Großvater gestorben war, sagten die Schwestern meines Vaters, also meine Tanten, zu meinem Vater: „Wir sehen das nicht ein, dass du die ganze Familie ernähren musst, wir suchen uns auch einen Beruf und versuchen, uns selbst durchzubringen!“ Er hatte einen jüngeren Bruder und insgesamt vier ältere Schwestern, und ich glaube nicht, dass das ein Zufall war. Jüdische Familien wollten unbedingt einen Sohn haben. Es waren nun zwar schon vier Mädchen da, aber sie haben es eben noch einmal probiert, und das Ergebnis war mein Vater. Nachher wurde noch ein Junge geboren, aber das wusste man zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Deshalb war mein Vater als „Stammhalter“ von Anfang an der Prinz.
Zum Beispiel wurde in unserer Familie immer folgende Geschichte erzählt: Mein Vater hatte ein Kindermädchen, das ihn im Kinderwagen durch den Christow-Park in Stettin (heute: Park Kasprowicza) fuhr, und die vier kleinen Mädchen liefen nebenher auch mit. Und dann kamen die Leute und wollten sich das Baby angucken. Nach kurzer Zeit sagte daraufhin das Mädchen: „Ich muss weiterfahren, Werner darf keine Mücke pieken.“ Also, wenn der Kinderwagen stand, dann hatten die Mücken eine bessere Chance, ihn zu stechen, als wenn er gefahren wurde. Aber es spielte überhaupt keine Rolle, dass die vier Mädchen da drumherum standen. So fing das gleich schon an, da lag er noch im Kinderwagen. Er war der Sohn, und er war der Prinz, und es war schon etwas verrückt im Verhältnis zu den vier Mädchen. Aber später hat sich dieser behütete Werner ja doch noch schwer durchs Leben schlagen müssen. Meine Tanten haben dann, wie gesagt, beschlossen, sich auf eigene Füße zu stellen. Die beiden Älteren waren schon in einem Alter, in dem sie gar keinen Beruf mehr erlernen konnten, deshalb haben sie in ihrer Wohnung die überzähligen Zimmer möbliert vermietet. Die dritte Schwester hatte bereits einen Beruf erlernt. Sie war von meinem Großvater nach Bad Godesberg auf eine Blumenbinderschule zur Ausbildung geschickt worden und hatte dann drei Jahre lang dort gelernt. Das war die Schule mit dem besten Ruf, und mein Großvater kannte sie, weil er doch immer viel reiste. Daher wusste er, hier bekommt meine Tochter die beste Ausbildung, und deshalb geht die Magda auch dahin. Für meine Tante wurde dann eine Unterkunft besorgt; also eine jüdische Familie, bei der sie wohnen konnte. Die vierte Tante machte schließlich eine Ausbildung als Sekretärin und gab zusätzlich Klavierunterricht, da sie sehr musikalisch war. Später wurde sie überzeugte Kommunistin und Sekretärin eines kommunistischen Funktionärs. Übrigens hat keine meiner Tanten je geheiratet. Und alle vier sind unter den Nazis umgekommen.
Die beiden Älteren wurden später von den Nazis mitten im Winter zu „kommunalen Arbeiten“ herangezogen. Das hieß, sie mussten im Park Blätter wegfegen und Gehwege reinigen und solche Sachen. Beide haben sich dabei nacheinander eine Lungenentzündung geholt und sind daran gestorben, und das war ja wohl auch der Zweck dieser Arbeit. Meine dritte Tante hat sich das Leben genommen, als der Vater meiner Mutter gestorben war, den sie im Alter gepflegt hatte. Nach seinem Tode hat sie sich umgebracht, als sie sah, was auf sie zukam. Und die jüngste Schwester meines Vaters, meine Tante Trude, wurde zunächst nach Lublin deportiert, das war ihre letzte Adresse. Sie ist dann in Auschwitz-Birkenau ermordet worden.
Erzählen Sie mir bitte etwas über Ihre Mutter. Sie kam ja aus altem sozialdemokratischem „Adel“!
Meine Mutter stammte aus einer sehr interessanten Familie, aus der Familie Voigt, die schon seit zwei Generationen hundertprozentige Sozialdemokraten und Freidenker waren. Ihre Großmutter war Mamsell auf einem Hof in Pommern gewesen.
Erzieherin, oder was bedeutet Mamsell?
Nein, Mamsell war diejenige, die die Schlüsselgewalt hatte, einkaufte und kochte für alle bzw. das Kochen überwachte und die dafür sorgte, dass die Leute ihr Essen bekamen, also die den Haushalt versorgte. Das war keine gewöhnliche Stellung, und sie war auch schon nicht mehr so ganz jung, als ein Trupp von Arbeitern aus Stettin aufs Land kam, um Stromkabel zu verlegen. Diese Arbeiter wurden in der Gegend, in der sie gerade stationiert waren, den Höfen zum Essen zugeteilt. Bei diesem Trupp war auch mein Urgroßvater dabei. Der saß also auch an diesem großen Tisch, wo die Mamsell die Heringe verteilte und die Kartoffeln über die Kartoffelrillen in den Tischen rollen ließ, und hat sie von Anfang an angehimmelt. Als diese Arbeiter den Hof wechseln mussten, da hat er zu ihr gesagt: „Ich komme wieder!“ Na ja, sie war schon so lange auf diesem Hof, da war es ihr nicht so wichtig und sie hat sich wahrscheinlich gesagt: „Mal gucken, ob er es wahrmacht.“ Und dann kam er wieder und hat gesagt: „Wenn du willst, dann heiraten wir und gehen nach Stettin.“ Das war für meine Urgroßmutter sicher eine gar nicht so einfache Entscheidung, denn dadurch wurde sie plötzlich Hausfrau in einem winzigen Arbeiterhaushalt, und vorher war sie ja jemand gewesen.
Was sagten ihre „Herrschaften“ dazu?
Das weiß ich nicht, ich weiß überhaupt nur sehr wenig. Nur dass mein Urgroßvater Voigt hieß, aber ich kenne noch nicht einmal den Geburtsnamen meiner Urgroßmutter.
Sie haben dann geheiratet und gingen nach Stettin. Mein Urgroßvater begann dann, im Hafen zu arbeiten. Zunächst war er Stauer, und später hat er sich bis zum Staumeister im Stettiner Hafen hochgearbeitet. Das war eine sehr verantwortungsvolle und sehr wichtige Position. Der Staumeister war für die Beladung der Schiffe verantwortlich, er dirigierte, wie die Waren auf den Schiffen verstaut werden sollten. Das war ganz wichtig, damit die Schiffe nicht untergingen. Und dann kam das Sozialistengesetz von Bismarck3.
War Ihr Urgroßvater damals schon in der SPD?
Ja, er war seit seiner Jugend Sozialdemokrat.
Als einfaches Mitglied oder hatte er eine besondere Stellung in der Partei?
Als Staumeister im Stettiner Hafen war er natürlich der Sozialdemokrat in diesem Hafen, und die Arbeiter taten alles, was er ihnen sagte. Der Hafen war eine richtige sozialdemokratische Bastion, und diese Potenz fürchteten auch die Behörden. Die Arbeiter hätten ja zum Beispiel durch einen Streik den ganzen Hafen lahmlegen können. Auf jeden Fall kam das Sozialistengesetz, und meine Urgroßeltern wurden aus Stettin ausgewiesen. Alle Sozialdemokraten konnte man natürlich nicht abschieben, aber zu meinen Urgroßeltern kam an Weihnachten die Polizei in ihre Kellerwohnung, in der sie mit ihrem kleinen Mädchen, meiner Großmutter, lebten, die damals schon geboren war. Da wurden die Betten aufgeschnitten und die Bettpfosten aufgesägt und schließlich natürlich auch die sozialdemokratischen Schriften gefunden, nach denen die Polizei gesucht hatte. Meine Urgroßeltern wurden also aus Stettin verbannt. Sie haben deshalb irgendwo in einem verlassenen Dorf ganz weit weg von Stettin gesessen und durften nicht näher als 80 Meilen4 an die Stadt herankommen. Und dann haben sie, und das hat mir meine Großmutter selbst erzählt, Pantoffeln genäht, um über die Runden zu kommen. Sie mussten ja von irgendetwas leben, denn mein Urgroßvater war ja von seiner Berufstätigkeit völlig abgeschnitten.
Mit der Aufhebung der Sozialistengesetze konnten meine Urgroßeltern wieder nach Stettin zurückkehren. Die Genossen sagten dann zu meinem Urgroßvater: „Hör zu, für die Arbeit im Hafen bist du zu exponiert. Wo immer du dich auch aufhalten würdest, man würde ein Auge auf dich werfen. Wir brauchen dich für etwas anderes.“ Und dann haben die Genossen gemeinschaftlich eine Wirtschaft gemietet und haben ihm erklärt: „Also, du bist unser Wirt, und du hast ein Hinterstübchen, dort können wir unsere Versammlungen abhalten, und du warnst uns, wenn der Falsche vor der Tür steht. Du wirst jetzt unser Wirt!“ Für diese Tätigkeit war natürlich auch meine Urgroßmutter als ehemalige Mamsell sehr geeignet. An diesem Ort ist meine Großmutter aufgewachsen, und sie kannte daher von frühester Jugend an alle Genossen, und jeder Genosse kannte sie. Als sie älter wurde, hat sie auch serviert, und da kriegte sie natürlich auch mal einen Klaps. Die Genossen versammelten sich in dieser Kneipe, und es kamen auch all die sozialdemokratischen Agitatoren zu ihnen (und schliefen teilweise auch dort), die aus Berlin angereist waren, um in Stettin Wahlkampfreden zu halten. Das war zum Beispiel August Bebel5 und viele andere, die nicht so bekannt sind. Außerdem gab es noch den Sozialdemokratischen Schutzbund, der sich bei ihnen traf.
In dieser Wirtschaft in Stettin verkehrte auch mein Großvater Paul Höfs, der ebenfalls Genosse und von Beruf Maler war. Damals war er noch ein ganz junger Mann und wahrscheinlich gerade Geselle geworden. Er hat dann um meine Großmutter bei ihren Eltern gefreit. Sie war zu diesem Zeitpunkt siebzehn und wurde nicht viel gefragt, das war wohl damals auch unter Genossen noch nicht so üblich. Vielleicht hat sie damals auch das Gefühl gehabt, es wäre ganz schön, einmal aus dieser Wirtschaft herauszukommen, denn sie hatte ja kaum Erinnerungen anderer Art. Sie haben dann geheiratet und mein Großvater wurde später Malermeister. Zum Schluss hatten sie sieben Gesellen und Lehrlinge bei sich, das war also ein richtiger Betrieb. Er wurde dann Chef der Maler-Innung in Stettin, deshalb haben sie auch die Betriebskrankenkasse bei sich zu Hause gehabt; um die hat sich meine Großmutter gekümmert. Paul Höfs war ein wunderbarer Mann, der später in der ganzen Stadt sehr beliebt war, auch bei seinen Lehrlingen, obwohl er manchmal sehr grob werden konnte. Meine Mutter hat mir erzählt, dass er immer, wenn er sich sehr aufgeregt hatte, in den Keller ging. Dort hatte er eine Sammlung von Glühbirnen, eine Kiste voll alter Glühbirnen, und die hat er dann in seiner Wut gegen die Wand geschmissen. Dadurch legte sich sein Zorn, und er kam nachher ganz fröhlich wieder hinauf. Er war auch bei den Damen sehr beliebt, also bei den Damen der Sozialdemokratie, weil er wunderbar Polka tanzen konnte, und das tat er auch mit Leidenschaft. Außerdem hat er immer die Geschichte erzählt, die ich von meiner Mutter kenne, dass er nämlich der Sohn einer armen Waschfrau war. Seine Mutter war mit einem Forstbeamten verheiratet gewesen, der sie nach der Geburt des dritten Kindes verlassen hatte. Daraufhin hatte sie ihre drei Kinder genommen und war nach Stettin gezogen, hatte sich dort als Waschfrau verdingt und hatte alles darangesetzt, dass ihre Kinder einen ordentlichen Beruf erlernten.
Hat sich Ihr Großvater auch politisch engagiert?
Mein Großvater ist später für die SPD politisch tätig gewesen und war jahrelang Ratsherr in der Stettiner Stadtverordnetenversammlung. Und meine Großmutter ist ja sogar erst in den Reichstag und später in den Preußischen Landtag gewählt worden6.
Wie hat denn die politische Karriere Ihrer Großmutter begonnen?
Sie war siebzehn, als mein Großvater sie aus der Wirtschaft weggeholt hat. Sie haben sieben Kinder bekommen, von denen nur drei am Leben geblieben sind. Vier sind gestorben, aber das war damals scheinbar nicht so ungewöhnlich. Meine Großmutter hat für ihren Mann – wie gesagt – die Betriebskrankenkasse zu Hause in ihrer Wohnung verwaltet, denn als Vorsitzender der Innung war er dafür zuständig. Sie hat die Korrespondenz geführt, die Krankenscheine ausgestellt usw., und zwar für die Maler-Innung von ganz Stettin und nicht nur für seine fünf Gesellen. Allerdings war er natürlich nach außen der Verantwortliche dafür. Außerdem hat sie den freireligiösen Unterricht in Stettin erteilt, heute würde man das vielleicht „Vergleichende Religionswissenschaften“ nennen, das heißt, sie haben die verschiedenen Konfessionen miteinander verglichen und den Kindern gesagt, dass es nicht nur das Christentum in zwei Variationen gibt, sondern zum Beispiel auch noch das Judentum und andere Religionen. Sie haben den Kindern klargemacht, dass man sich durchaus frei für eine Religion entscheiden kann oder eben auch nicht.
Hatte Ihre Großmutter eine Ausbildung gemacht oder einen Beruf erlernt?
Nein, sie hat nur die normale Volksschule besucht.
Das heißt, sie hat sich ihr Wissen praktisch nebenbei angelesen?





























