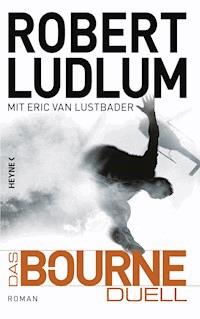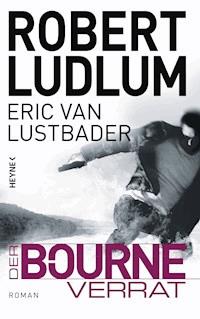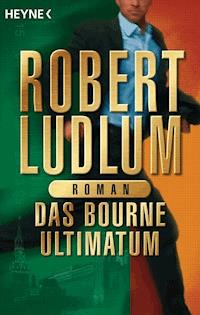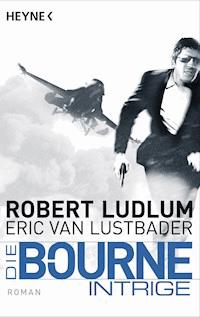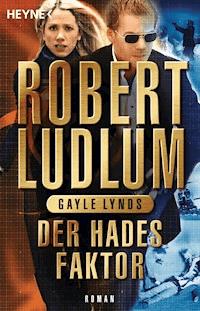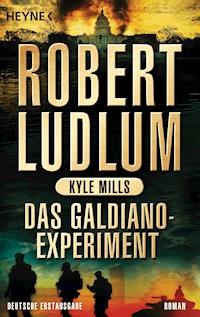8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: COVERT ONE
- Sprache: Deutsch
Im Norden Ugandas wird ein Spezialkommando der US-Streitkräfte von bisher friedlichen Bauern ausgelöscht. Offenbar besaßen die Menschen fast übermenschliche Kräfte. Alles deutet darauf hin, dass sie ein bisher unbekannter Erreger immun gegen Schmerz und Angst machte – eine teuflische Biowaffe, die die Welt ins Chaos stürzen könnte. Das Team von Covert One muss alles daransetzen, der Bedrohung Herr zu werden. Doch der Feind sitzt in den eigenen Reihen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
Covert One ist eine ultrageheime Spezialeinheit, die direkt dem Präsidenten der Vereinigten Staaten unterstellt ist. Diese Einheit unter der Führung des Mikrobiologen Colonel Jon Smith stellt die letzte Hoffnung dar, wenn eine Krisensituation ein schnelles Eingreifen erforderlich macht.
So im nördlichen Uganda: Eine amerikanische Kommandoeinheit, die einen skrupellosen Warlord ausschalten soll, wird von bisher friedlichen Bauern ausgelöscht, die über scheinbar übermenschliche Kräfte verfügen. Offenbar handelt es sich um eine parasitäre Infektion, die die Menschen immun gegen Schmerz und Angst macht. In den falschen Händen könnte der Parasit eine tödliche Biowaffe werden und die Welt ins Chaos stürzen. Smiths Team bleibt nur wenig Zeit, den Erreger ausfindig zu machen, denn auch der iranische Geheimdienst ist bereits vor Ort. Doch auch in Washington versuchen mächtige Hintermänner, Smiths Einsatz scheitern zu lassen.
Zu den Autoren
Robert Ludlum erreichte mit seinen Romanen, die in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden, weltweit eine Auflage von über 280 Millionen Exemplaren. Robert Ludlum verstarb im März 2001, die Romane aus seinem Nachlass erscheinen im Wilhelm Heyne Verlag. Ein ausführliches Werkverzeichnis finden Sie am Ende des Buches.
Kyle Mills, Jahrgang 1966, lebt in Jackson Hole, Wyoming, wo er sich neben dem Schreiben von Thrillern dem Skifahren und Bergsteigen widmet. In den USA ist Kyle Mills mit seinen Romanen regelmäßig in den Bestsellerlisten zu finden. Zuletzt erschien im Wilhelm Heyne Verlag der Politthriller Blutige Erde.
Besuchen Sie Kyle Mills im Internet unter www.kylemills.com
Inhaltsverzeichnis
Kapiteleins
ÜBER NORDUGANDA
12. November, 02:03 Uhr GMT+3
Die Umgebung schien sich in der dröhnenden Dunkelheit aufzulösen. Craig Rivera fragte sich, ob Astronauten auch eine so umfassende Leere erlebten, ob sie so wie er jetzt das Gefühl hatten, nicht weit davon entfernt zu sein, Gott zu sehen.
Er blickte auf das schwache grüne Leuchten des Zifferblatts an seinem Handgelenk. Die Buchstaben waren kyrillisch, aber die Ziffern, die seine Höhe und die Koordinaten anzeigten, waren so, wie er es von seiner Trainingsausrüstung gewohnt war.
Rivera neigte sich leicht in Richtung Norden, während er in freiem Fall die Fünfzehntausend-Fuß-Marke passierte. Ein Hauch feuchter Wärme begann die Haut rund um seine Sauerstoffmaske auftauen zu lassen, und unter ihm wurde die Dunkelheit von vereinzelten schwachen Lichtpunkten durchbrochen.
Lagerfeuer.
Als die GPS-Anzeige bestätigte, dass er sich genau über der Landezone befand, drehte er sich einen Moment lang auf den Rücken und blickte zum Sternenhimmel hinauf, doch die Umrisse des Flugzeugs, aus dem er abgesprungen war, waren nicht mehr auszumachen.
Sie waren allein. Das wenigstens hatte man ihm ganz klar gesagt.
Er wusste nur wenig über das Land, in das er mit 200 km/h hinabstürzte, und noch weniger über den Mann, den sie finden sollten. Caleb Bahame war ein Terrorist und ein grausamer Mörder, über den sich die Leute so furchtbare Geschichten erzählten, dass man nur schwer sagen konnte, ob die Informationen über ihn der Wahrheit entsprachen oder reine Schauermärchen waren. Einige der Geschichten waren jedoch zweifellos wahr. Dass er seinen Männern befahl, kleinen Kindern die Glieder mit heißen Macheten abzuhacken, war durch Fotos belegt. Genauso wie das qualvolle Sterben der Kinder an ihren verbrannten Wunden.
Bilder wie diese ließen Rivera an der Vollkommenheit Gottes zweifeln. Hielt er wohl seine schützende Hand über diese Mission gegen Bahame?
Nicht dass solche philosophischen Fragen irgendeinen Einfluss gehabt hätten auf das, was sich Rivera vorgenommen hatte. Er würde herausfinden, ob dieser Bahame bei all seiner zerstörerischen Energie auch imstande war, Kugeln aufzuhalten, die auf ihn abgefeuert wurden. Für diesen Test würde er mehrere Magazine verfeuern.
Er sah erneut auf den Höhenmesser und drehte sich auf den Bauch. Durch seine Sprungbrille blickte er auf das Blätterdach des Dschungels hinunter. Einige Sekunden später wurde das Leuchten der Ziffern rot; er öffnete den Fallschirm und stürzte auf eine Lichtung zu, die er noch nicht sehen konnte, von der die Geheimdienstleute jedoch geschworen hatten, dass sie da war.
Er war nur noch etwas mehr als hundert Fuß über der Erde, als er seine Landezone erblickte und darauf zusteuerte. In dem Sekundenbruchteil, als er festen Boden unter den Füßen spürte, rollte er sich mit einer fließenden Bewegung ab, die er immer wieder trainiert hatte. Er schnappte seinen Fallschirm und lief zwischen die schützenden Bäume, dann warf er seine Ausrüstung auf den Boden und holte Nachtsichtbrille und Gewehr heraus.
Das etwas abgenutzte AK-47 fühlte sich ein wenig fremd in seinen Händen an, als er es von links nach rechts schwenkte und lauschte, wie seine Leute in Abständen von dreißig Sekunden landeten. Als der Vierte unten war, aktivierte er sein Kehlkopfmikrofon.
»Alles okay bei euch?«
Bei solchen Sprüngen blieb immer ein gewisses Restrisiko, deshalb spürte er, wie sich seine Anspannung ein wenig löste, als sich alle unverletzt meldeten.
Rivera schlich lautlos durch den Dschungel, das Dröhnen des Windes war dem Summen der Insekten und dem Kreischen der tropischen Vögel gewichen. Sie hatten diese Gegend ausgewählt, weil das unwegsame Gelände eine Besiedelung unmöglich machte. Vielleicht würden sie ihre Wahl verfluchen, dachte er, wenn sie erst einmal dreißig Kilometer marschiert waren, aber im Moment zählte vor allem die Tatsache, dass niemand sie mit glühenden Macheten verfolgte.
Seine Leute reihten sich in exakt bemessenen Abständen hintereinander ein, dann ging es los in Richtung Norden. Rivera marschierte hinter einem kleinen drahtigen Mann, der einen schwarzen Pullover mit abgeschnittenen Ärmeln trug, aus dem die grün bemalten Arme herausragten. Er schwenkte sein israelisches Maschinengewehr ständig hin und her, während er über das Gelände glitt, auf dem ein gewöhnlicher Mann hilflos von einem Baum zum nächsten gestolpert wäre. Doch er war kein gewöhnlicher Mann. Das war keiner von ihnen.
Ihre Ausrüstung und Kleidung war ein Mosaik von Bestandteilen aus aller Welt. Keiner von ihnen hatte Tätowierungen oder andere Kennzeichen, an denen sie sich identifizieren ließen – ja sogar ihre Zahnfüllungen waren so verändert worden, dass man ihre Herkunft nicht mehr bestimmen konnte. Sollten sie in Gefangenschaft geraten oder getötet werden, so würde ihnen kein Ruhm zuteilwerden. Niemand würde heroische Geschichten über sie verbreiten, die den Angehörigen ein wenig Trost gespendet hätten. Alles, was an sie erinnern würde, war ein kleiner Grabstein auf einem leeren Grab.
»Wir nähern uns dem Treffpunkt.« Die Stimme des Mannes an der Spitze klang leicht verzerrt in Riveras Ohr. »Etwa zehn Meter.«
Die geordnete Reihe löste sich im Dschungel auf, und die Männer verteilten sich um ein kleines Stück Land, das erst vor Kurzem durch einen Blitzeinschlag verbrannt war. Rivera spähte zwischen den Blättern hindurch auf die verkohlten Bäume und erkannte schließlich den groß gewachsenen Ugander, der allein in der Asche stand. Er rührte sich nicht – nur sein Kopf zuckte bei jedem Geräusch, so als wäre da immer noch ein Rest von Elektrizität, die in kleinen Stromstößen aus der verbrannten Erde kam.
»Jetzt«, sprach Rivera in sein Mikrofon.
Er hatte es hundertmal im Training miterlebt, aber es machte ihn immer wieder stolz zu sehen, wie seine Männer aus dem Dschungel auftauchten. Auf neutralem Boden konnten sie es mit jedem Gegner aufnehmen, selbst mit dem britischen SAS, der israelischen Schajetet 13 oder der Armee des Teufels, wenn es sein musste.
Der Mann auf der Lichtung stieß einen überraschten Laut aus, dann riss er den Arm hoch, um sein Gesicht zu bedecken. »Nehmt eure Nachtsichtbrillen ab!« Er sprach Englisch mit starkem Akzent. »So war es ausgemacht.«
»Warum?«, erwiderte Rivera, nahm aber seine Brille ab und bedeutete seinen Männern, es ebenso zu machen. Es war eine etwas seltsame Bedingung, aber sie hatten es tatsächlich so vereinbart.
»Ihr dürft mein Gesicht nicht sehen«, antwortete der Mann. »Bahame kann durch deine Augen sehen. Er kann Gedanken lesen.«
»Dann kennen Sie ihn also?«, fragte Rivera.
Der Ugander war nur noch als schattenhafte Gestalt zu erkennen, doch man sah deutlich, wie er die Schultern hängen ließ, als er antwortete. »Er hat mich als Kind von zu Hause weggeholt. Ich habe viele Jahre in seiner Armee gekämpft. Ich habe Dinge getan, die man gar nicht aussprechen kann.«
»Aber Sie sind entkommen.«
»Ja. Ich habe eine Familie verfolgt, die in den Dschungel flüchtete, als wir ihr Dorf angriffen. Ich habe ihnen aber nichts getan, sondern bin einfach nur gelaufen. Tagelang.«
»Sie haben unseren Leuten gesagt, Sie wüssten, wo man ihn findet.«
Er antwortete nicht, deshalb holte Rivera einen Beutel voll Euroscheine aus seinem Rucksack und hielt ihn dem Mann hin. Der Ugander nahm das Geld, sagte aber immer noch nichts. Er starrte auf den Nylonbeutel in seinen Händen hinunter.
»Ich habe sechs Kinder. Eines – mein Sohn – ist sehr krank.«
»Mit dem Geld können Sie ihm helfen.«
»Ja.«
Er hielt ihm ein Blatt Papier hin, und Rivera nahm es entgegen. Er hielt die Nachtsichtbrille vor die Augen, um die handgezeichnete Karte zu begutachten. Es war beeindruckend, wie detailliert sie war; die Karte schien mehr oder weniger den Satellitenfotos von dem Gebiet zu entsprechen.
»Ich habe meinen Teil getan«, sagte der Ugander.
Rivera nickte und wandte sich zum Gehen, doch der Mann hielt ihn an der Schulter zurück.
»Lauft weg«, riet er. »Sagt dem Mann, der euch hergeschickt hat, dass ihr ihn nicht finden könnt.«
»Warum sollten wir das tun?«
»Er führt eine Armee von Dämonen an. Nichts kann ihnen Angst machen. Man kann sie auch nicht töten. Manche sagen sogar, dass sie fliegen können.«
Rivera schüttelte die Hand des Mannes ab und verschwand im dichten Dschungel.
Die Armee des Teufels.
Kapitelzwei
VOR DER OSTKÜSTE AFRIKAS
12. November, 04:12 Uhr GMT+3
»Sie müssen verstehen, Admiral, es ist gerade die zerstörerische Herrschaft von Idi Amin, die Uganda heute zu so einem leuchtenden Vorbild macht. Wir haben enorme Anstrengungen unternommen – wirtschaftlich, politisch, in der Krankheitsbekämpfung. Aber die Welt will es nicht anerkennen. Sie will nicht einsehen, wie weit mein Land schon gekommen ist. Deshalb sind die Investoren sehr zurückhaltend, und Probleme tauchen wieder auf, die wir schon fast überwunden hatten.«
Der Zigarrenrauch stieg aus Charles Sembutus Mund auf – er rauchte ein Exemplar aus Admiral Jamison Kayes privatem Vorrat von Arturo-Fuente-Zigarren, während er seinen Vortrag über die moralische Verpflichtung der Welt gegenüber dem Land, das er regierte, hielt.
Kaye hörte mit ausdrucksloser Miene zu und ließ sich seine generelle Abneigung gegen Politiker nicht anmerken. Er war selbst in ärmlichen Verhältnissen auf einer Farm in Kentucky aufgewachsen, und seine Familie hatte auch in den schlimmsten Zeiten nie irgendeine Unterstützung erwartet. Sein Vater sagte immer, dass einen niemand wieder auf die Beine bringen könne. Entweder man stand allein wieder auf oder man blieb am Boden.
»Sie werden also verstehen, Admiral, warum es so wichtig ist, was wir hier tun. Und wie ernst die Lage ist.«
»Ja, Sir, Mr. President.«
Seine Frau ermahnte ihn oft, nicht so streng über Politiker zu urteilen, und sie hatte meistens recht. Aber nicht diesmal. Sembutu hatte die Macht in Uganda durch einen blutigen Umsturz an sich gerissen, bei dem nicht nur der frühere Präsident und seine Familie ermordet worden waren, sondern auch Tausende seiner Anhänger.
Es klopfte leise an der Tür, und der Admiral war froh, seinen Captain hereinkommen zu sehen.
»Gentlemen, wir haben die Livebilder auf den Monitoren. Wenn Sie mir bitte folgen.«
Die Kommandozentrale für diese Operation war in den Tiefen des Flugzeugträgers untergebracht – in einem engen Raum, der dazu da war, Ereignisse zu überwachen, über die keine Zeitung je berichten würde.
Die beiden Frauen, die die komplexen elektronischen Geräte bedienten, sprangen auf, als der Admiral und sein Gast eintraten, doch eine abwinkende Handbewegung ließ sie sogleich wieder an ihre Plätze zurückkehren.
»Das sind Bilder von Ihren Soldaten?« Sembutu zeigte auf die fünf Monitore. Grünlich leuchtend zog der Dschungel langsam auf dem Bildschirm vorbei.
»Jeder der Männer trägt eine Kamera an seiner Uniform, von der die Bilder via Satellit zu uns kommen«, erklärte Kaye.
Sembutu trat vor und las die Namen der Männer unter dem jeweiligen Monitor, während Kaye auf einem sicheren Telefon eine Nummer wählte.
Er hatte ein ziemlich ungutes Gefühl im Bauch, als es klingelte. Seiner Ansicht nach war Krieg so etwas wie der Normalzustand in Afrika – gelegentliche Perioden des Friedens waren eher die Ausnahme. Seine Jungs in eine Situation zu schicken, die sie nur teilweise kannten und die seiner Meinung nach Amerika auch gar nichts anging, erinnerte ihn verdammt stark an Somalia. Doch er hatte keine Wahl. Das war keine verrückte Operation, die sich irgendjemand in einem vergessenen Winkel des Pentagons ausgedacht hatte.
Das Telefon klickte, und die unverkennbare Stimme von Sam Adams Castilla war zu hören.
»Ja, Admiral?«
»Sie sind gelandet und unterwegs zu ihrem Ziel.«
»Sind alle sicher gelandet?«
»Ja, Mr. President. Bis jetzt läuft alles nach Plan.«
Kapiteldrei
NORDUGANDA
12. November, 06:09 Uhr GMT+3
Das Licht der Morgendämmerung sickerte allmählich durch das Blätterdach und vertrieb die Dunkelheit, die sich als sehr angenehm erwiesen hatte. Lieutenant Craig Rivera schlüpfte an dem Mann vor ihm vorbei; er wollte selbst die Führung übernehmen, bis die verwirrende Dämmerung schließlich dem Tag wich.
Der Tau auf den Blättern begann bereits zu verdunsten und erfüllte die Luft mit dieser drückenden Feuchtigkeit, die einem das Atmen schwer machte. Er stieg einen steilen felsigen Abhang hinauf, an dessen Spitze er sich in Bauchlage begab. Mehr als eine Minute lang suchte er das Gewirr von Blättern und Zweigen nach einer menschlichen Gestalt ab. Nichts. Nur das endlose Schimmern feuchter Blätter.
Er wollte schon weitergehen, als ihn ein Knacken in seinem Ohrhörer erstarren ließ, gefolgt von einer Stimme. »Behaltet den Himmel im Auge.«
Rivera drückte sich an einen dicken Baumstamm und blickte nach oben, während seine Hand zu seinem Kehlkopfmikro ging. »Was gibt’s?«
»Bahame könnte jederzeit zuschlagen und Kugelblitze aus seinem Arsch abschießen.«
Das leise Kichern seiner Männer durchzog die Stille, und er ging weiter und überlegte, was er antworten sollte. »Funkdisziplin, Leute. Vergessen wir nicht, was mit den anderen passiert ist.«
Eine Einheit der Afrikanischen Union hatte vor sechs Monaten einen Hinweis auf Bahames Aufenthaltsort bekommen und die Verfolgung aufgenommen. Eine Audioaufnahme war alles, was noch von ihnen übrig war.
Rivera würde es seinen Männern nie erzählen, aber das ruhige Geplauder am Lagerfeuer, die plötzlichen Schüsse und automatisches Gewehrfeuer, die Schreie der Angreifer, die nichts Menschliches an sich hatten, gingen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Und schließlich der brutale Kampf Mann gegen Mann, das Stöhnen, das Röcheln der Sterbenden.
Seine Leute hatten den Vorfall als etwas abgetan, was ihnen selbst nie passieren hätte können. Diese Truppen der Afrikanischen Union – waren das nicht die Typen, die einen Stoffpudel als Maskottchen hatten? Jede Pfadfindergruppe sei schlagkräftiger, meinten sie abschätzig.
Als Teamführer hatte Rivera jedoch die Akten der toten Soldaten gesehen. Das waren keine Politessen aus dem Kongo, wie einer seiner Männer nach ein paar Bieren gescherzt hatte.
Rivera reckte eine Faust in die Höhe und duckte sich, während er sein AK-47 zwischen den Bäumen auf einen braunen Fleck richtete, der in dem grünen Meer auftauchte. Hinter sich hörte er nichts, doch er wusste, dass seine Männer bereits ausschwärmten und in Verteidigungsposition gingen.
Er kroch langsam vorwärts und konzentrierte sich darauf, gleichmäßig zu atmen und keine Blätter über sich zu bewegen. Fünf Minuten und zwanzig Meter später lichtete sich der Wald und sie hatten den Rand eines kleinen Dorfes erreicht.
Die Strohwand der Hütte vor ihm war so ziemlich das Einzige, was nicht verbrannt war – und das schloss die Dorfbewohner mit ein. Es war schwer zu sagen, wie viele verkohlte Leichen neben den Überresten eines Fußballtors aufgestapelt waren, aber vierzig waren es bestimmt. Offenbar waren sie nicht mehr weit von ihrem Ziel entfernt. Sie waren auf Bahames Territorium angekommen.
Hinter sich hörte er ein leises Stöhnen und etwas, das so klang als würde ein Körper auf die weiche Erde fallen. Er stieß einen leisen Fluch hervor und eilte zu dem Geräusch zurück, den Finger am Abzug seiner Waffe.
»Sorry, Boss. Ich hab sie auch erst im letzten Moment gesehen.«
Die Frau kauerte sich gegen einen Baum, die Hände in erstarrter Panik gehoben. Ihre Augen sprangen hin und her, als seine Männer aus dem Buschwerk auftauchten.
»Was glaubt ihr, wer sie ist?«, fragte einer von ihnen leise.
»Da vorne ist ein Dorf«, antwortete Rivera. »Oder zumindest war da eins. Bahame war hier. Sie muss ihm entwischt sein. Wahrscheinlich lebt sie schon ein paar Tage allein hier draußen.«
Sie hatte eine klaffende Wunde am Arm, die offensichtlich infiziert war, und ihr Fußknöchel war nach rechts verdreht, die Knochen drückten gegen die Haut, ohne sie jedoch ganz zu durchstoßen. Rivera versuchte ihr Alter zu schätzen, doch da waren zu viele widersprüchliche Merkmale; ihre Haut sah aus wie ein alter Reifen, sie hatte kräftige drahtige Arme und gerade weiße Zähne. Er musste sich eingestehen, dass er in Wahrheit gar nichts über sie wusste und auch nie etwas wissen würde.
»Was machen wir mit ihr?«, fragte einer seiner Männer.
»Sprechen Sie Englisch?«, fragte Rivera langsam und deutlich.
Sie begann in ihrer Muttersprache zu reden, und die Männer erschraken angesichts ihrer lauten Stimme. Rivera drückte ihr eine Hand auf den Mund und hob einen Finger an die Lippen. »Sprechen Sie ein bisschen Englisch?«, wiederholte er.
Als er die Hand wegnahm, sprach sie leiser, aber immer noch in ihrer Sprache.
»Was meinst du, Boss?«
Rivera trat einen Schritt zurück, und ein paar salzige Schweißtropfen liefen ihm über die Oberlippe und in den Mund. Er wusste nicht, was er davon halten sollte. Er wollte die Kommandozentrale anrufen, aber er wusste, was Admiral Kaye sagen würde – dass er nicht selbst vor Ort war. Dass er das nicht entscheiden könne.
»Sie ist keine Anhängerin von Bahame – nach dem, was er mit ihrem Dorf gemacht hat.«
»Ja«, stimmte einer seiner Männer zu. »Aber die Leute haben Angst vor ihm und wollen ihn nicht ärgern. Sie halten ihn für einen Zauberer.«
»Also, was meint ihr?«, fragte Rivera.
»Wenn wir sie laufen lassen – woher sollen wir wissen, dass sie nicht redet? Verdammt, wir können ihr ja nicht einmal sagen, dass sie nichts von uns erzählen soll.«
Er hatte recht. Was hatte ihr Kontaktmann gesagt? Dass Bahame durch die Augen der Leute sehen konnte? Legenden hatten ihre Wurzeln meistens in der Realität. Vielleicht hatten die Menschen solche Angst vor ihm, dass sogar diejenigen, die ihn hassten, ihm alles erzählten, damit er sie in Ruhe ließ.
»Wir könnten sie an den Baum fesseln und knebeln«, schlug ein anderer vor.
Was sie hier machten, war Wahnsinn. Sie standen schutzlos herum und vergeudeten wertvolle Zeit.
»Boss, das können wir nicht machen. Sie würde verdursten oder ein wildes Tier würde sie sich holen.«
Der Mann, der direkt hinter ihr stand, zog sein Messer. »Sie wird sowieso nicht überleben, ganz allein. Wir würden ihr einen Gefallen tun.«
Rivera stand wie versteinert da – viel zu lange für einen Teamführer. Unentschlossenheit zu zeigen war in seiner Position nicht unbedingt ratsam. Die logische Reaktion war immer, es so zu machen, wie man es in der Ausbildung gelernt hatte – aber die ganze Ausbildung half einem wenig, wenn man in einer solchen Situation war, wenn man ganz real vor der Frage stand, ob man das Leben einer unschuldigen Frau beenden sollte, nur weil es die Sache vielleicht vereinfacht hätte.
»Wir gehen weiter«, beschloss er und schlug einen Weg ein, der um das ausgebrannte Dorf herumführte. Er würde ohnehin schon genug zu erklären haben, im unwahrscheinlichen Fall, dass er eines Tages vor der Himmelstür stehen würde. Einen Mord an einer wehrlosen Frau wollte er nicht auch noch auf seiner Liste haben.
Kapitelvier
SÜDNAMIBIA
12. November, 13:58 Uhr GMT+3
Dr. Sarie van Keuren streckte die Hand aus und verzog das Gesicht, als sich ihre Finger um einen dornigen Zweig schlossen. Es hatte seit Wochen nicht mehr geregnet, und die Erde der Uferböschung, die sie hochkletterte, konnte ihre vierundfünfzig Kilo kaum tragen.
Sie ignorierte das Blut, das ihr über die schwitzenden Hände lief, und schleppte sich weiter, bis zu dem Stativ mit der Videokamera oben auf der Hügelkuppe.
Sie blies den Staub vom Objektiv und blickte in die Büsche, auf die die Kamera gerichtet war. Trotz der grellen afrikanischen Sonne brauchte sie einige Augenblicke, um zwischen den Beeren zu finden, was sie suchte – eine Ameise aus einer Kolonie ganz in der Nähe.
Normalerweise waren die Exemplare dieser Art zierlich und schwarz glänzend. Doch dieses Individuum war durch einen winzigen Parasiten verändert worden. Sein Hinterleib war angeschwollen und leuchtete rot, die perfekte Nachahmung der Beeren, zwischen denen sich die Ameise aufhielt. Der Parasit hatte jedoch auch das Gehirn der Ameise infiziert, sodass sie gezwungen wurde, in den Busch zu klettern, ihre Kiefer um einen Stängel zu schließen und den Hinterleib in die Luft zu strecken.
Zuerst hatte sie sich dagegen gewehrt und mit allen sechs Beinen versucht, sich von dem Stängel zu lösen. Doch jetzt schienen ihre Gliedmaßen gelähmt zu sein – wahrscheinlich weil der schlaue kleine Eindringling sich durch ihre Nerven fraß.
Sie blickte in das ausgewaschene Blau des Himmels, auf der Suche nach den Vögeln, die der Parasit anzulocken versuchte. Dieser spezielle Fadenwurm konnte sich nur im Darm eines Vogels vermehren und verfügte selbst über keine Möglichkeit der Fortbewegung. Die Ameise war der perfekte Partner, wenn auch unfreiwillig.
Van Keuren setzte sich hin und schlang die Arme um die Knie, um so viel wie möglich von sich in den Schatten des riesigen Huts zu bekommen, den sie aufhatte. Vor ihr erstreckte sich trockenes Land in allen Richtungen. Das Einzige, was sie daran erinnerte, dass es da draußen eine moderne Welt gab, war ihr Land Cruiser, der am Fuße des Hügels liegen geblieben war.
Sie versuchte auszurechnen, wie viele Spezies sie im Laufe der Jahre entdeckt hatte, doch ihre Gedanken schweiften schon bald zu ihrer allerersten Entdeckung. Es war vor fünfundzwanzig Jahren gewesen. Ihr Vater war mit einem leicht verbeulten Videorekorder und einer Schachtel Kassetten nach Hause gekommen – ein unbekannter Luxus in dem namibischen Bauerndorf, in dem sie aufwuchs. Sie war damals noch nicht einmal acht Jahre alt und fasziniert von den Kinderfilmen. Stundenlang saß sie vor dem Fernseher und nahm jedes Detail in sich auf, bis sie jedes gesprochene Wort auswendig wusste.
Nach einer Weile begannen ihr die Filme jedoch langweilig zu werden und sie wühlte erneut in der Kiste und fand ein abgenutztes Exemplar von Alien. Ihr Vater hatte sie gewarnt, dass sie davon Albträume bekommen würde, doch sie sah sich den Film trotzdem an und verfolgte wie gebannt die Geschichte von dieser krakenförmigen Kreatur, die sich an das Gesicht der Menschen klammerte und sich in ihren Körpern vermehrte.
Wer hätte gedacht, dass ein Horrorfilm, der ganz unten in einer alten Schachtel versteckt war, eine Besessenheit auslösen würde, die ihr ganzes zukünftiges Leben bestimmen sollte? Gott sei Dank hatte sie keine Kassette von Rocky gefunden, denn dann würde sie jetzt wahrscheinlich in irgendeinem Boxring verprügelt werden.
Die Sonne begann allmählich wieder mit ihrem Abstieg am Firmament, doch das änderte nichts an der drückenden Hitze, die, so schätzte sie, bei fünfundvierzig Grad liegen musste. Es war Zeit, sich in den Schatten ihres Wagens zurückzuziehen.
Hinunter ging es leichter, sie schlitterte einfach auf der lockeren Erde dahin. Als sie festen Boden unter sich hatte, beträufelte sie einen Lumpen mit etwas Wasser und sah in den Außenspiegel, um sich die blonden Haare, die an den Wangen klebten, aus dem Gesicht zu streichen und Staub und Salz abzuwischen.
Ihr Hut war fast so groß wie ein Sombrero, doch er konnte nicht verhindern, dass sich ihre Haut tiefrot verfärbte und sich auf ihrer Nase beinahe zu schälen begann. Obwohl ihre Familie schon seit Generationen in Namibia lebte, war sie mit der hellen Haut geschlagen, auf die ihre Mutter so stolz gewesen war.
Resignierend griff sie in die Kühlbox mit geschmolzenem Eis und nahm die Zutaten für einen Gin Tonic heraus. Vor sechs Tagen waren zwei Männer vorbeigekommen, die in der Gegend nach Bodenschätzen suchten, und sie hatten ihr versprochen, den Toyota-Leuten in Windhoek zu sagen, dass sie hier draußen war, doch jetzt bereute sie, dass sie ihr Angebot, mitzufahren, abgelehnt hatte. Ihre Beharrlichkeit war manchmal eine wertvolle Tugend, aber oft genug brachte sie ihr auch Ärger ein.
Sarie lehnte sich gegen das heiße Metall des Wagens und rutschte ein Stück zur Seite, bis sie den etwas kühleren Hinterreifen im Rücken spürte. Sie hatte nur noch Wasser für einen Tag, doch es gab eine Quelle wenige Kilometer entfernt. Mit den Essensvorräten sah es etwas besser aus, doch das machte ihr ohnehin keine Sorgen; sie hätte hier draußen jederzeit genug Nahrung zum Überleben gefunden. Das einzige echte Problem war der Gin. Nur noch wenige Zentimeter bedeckten den Boden der Flasche, und das war einfach unerträglich.
Sie zog die Stirn in Falten und seufzte leise. Wenn die Sonne unterging, würde sie losmarschieren müssen. Sie würde ungefähr zwei Tage bis zur Straße brauchen, und dann würde sie wahrscheinlich noch einen Tag warten müssen, bis jemand vorbeikam. Was war nur mit der Notiz passiert, die sie sich gemacht hatte, dass sie sich ein Satellitentelefon zulegen musste? Wahrscheinlich lag der Zettel im Handschuhfach, zusammen mit all den anderen ungelesenen Notizen.
Sie war gerade bei ihrem dritten Drink, als sie im fernen Hitzeflimmern etwas auftauchen sah. Zuerst dachte sie, sie hätte zu viel getrunken, doch bald erkannte sie, dass es eine menschliche Gestalt war. Sie griff nach hinten, zog ihr Gewehr aus dem Wagen und spähte durch das Zielfernrohr.
Es war ein Junge von ungefähr sechzehn Jahren, dessen Haut vom Leben im Freien fast schwarz verfärbt war. Er war barfuß und nur mit Khakishorts bekleidet; über der nackten Schulter trug er einen Leinensack.
Sie schenkte sich den letzten Rest Gin ein, um das Ereignis zu feiern, und nippte zufrieden die scharfe Flüssigkeit, während er allmählich näher kam.
»Howzit!«, rief sie, als er in Hörweite war. »Wenn du eine Lichtmaschine in deinem Sack hast, dann bist du mein Held.«
Er blieb vor ihr stehen und sah sie mit einem leicht verwirrten, aber konzentrierten Blick an. Sie versuchte es mit Afrikaans, aber genauso vergeblich, und hatte schließlich mit Ndonga Erfolg, das sie von den Leuten gelernt hatte, die auf der Farm ihrer Eltern gearbeitet hatten.
»Ja«, antwortete der Junge und nickte müde. »Die Autoleute in Windhoek haben sie meinem Vater gegeben, und er hat gesagt, ich soll sie hierherbringen.«
Sie holte eine Cola und etwas zu essen aus ihrer glühend heißen Kühlbox und reichte es ihm, dann kroch sie in ihren Wagen, um Werkzeug zu holen. »Ruh dich im Schatten aus. Wenn wir Glück haben, können wir fahren, bevor es dunkel wird.«
Kapitelfünf
NORDUGANDA
12. November, 17:39 Uhr GMT+3
Lieutenant Craig Rivera ließ sich auf ein Knie nieder und studierte noch einmal die handgezeichnete Karte, bevor er den Blick wieder nach vorne auf den Dschungel richtete. Das Laub war hier nicht mehr ganz so dicht, die Bäume standen etwa drei Meter auseinander in einem Meer aus kniehohem Gebüsch. Man kam zwar schneller voran, doch die schützende Deckung fehlte.
Er blickte zurück und fand schließlich den Mann, der ihm am nächsten war – starr wie ein Stein lag er im Gestrüpp. Der Rest seines Teams war selbst für sein geschultes Auge völlig unsichtbar.
»Es kann nicht mehr weit sein«, sagte Rivera in sein Kehlkopfmikro. »Gibt’s irgendwelche Probleme?«
»Negativ«, bekam er von allen zu hören.
Sie waren fast fünfzehn Stunden ohne Unterbrechung marschiert, und er dankte Gott für das beinharte Training, das sie in Florida absolviert hatten. Der Grundsatz seines befehlshabenden Offiziers lautete: Trainiere doppelt so lang, doppelt so hart und bei zehn Grad größerer Hitze, als du es je im Ernstfall erleben wirst. Operationen wie diese gaben einem das Gefühl, dass sich die Mühe lohnte.
»Bleibt wachsam. Wir gehen weiter.«
Der Plan ließ vermuten, dass das Lager, das sie suchten, ziemlich zersplittert war. Die Ausrüstung war unter Tarnnetzen verborgen, und die meisten von Bahames Soldaten schliefen auf dem nackten Boden. Der äußere Ring wurde von Kindern gebildet, die mit leichten Sturmgewehren bewaffnet waren – Kanonenfutter, um Bahame zu warnen, wenn Gefahr drohte. Der nächste Ring bestand aus erfahreneren erwachsenen Kämpfern, und zuletzt folgte die Leibgarde des Guerillaführers.
Wenn sie das Lager tatsächlich fanden, so hatten sie vor, den äußeren Verteidigungsring still und leise im Schutze der Nacht zu durchdringen und dann gut verborgen zu warten, bis ihr Zielobjekt in Reichweite ihrer Scharfschützengewehre auftauchte. Leider war in diesem Plan vieles dem Zufall überlassen. Würden sie sichere Verstecke finden, die ihnen trotzdem eine gute Sicht auf die Umgebung ermöglichten? Und was noch wichtiger war – würden sie sich schnell genug zurückziehen können, nachdem sie einem Kerl eine Kugel in den Kopf gejagt hatten, von dem seine Leute glaubten, dass er ein Gott in Menschengestalt sei?
Rivera konnte sich nur auf sein Gefühl verlassen. Es gab einfach nicht genug handfeste Informationen, um etwas anderes zu tun, als hineinzugehen und auf seinen Instinkt zu vertrauen.
Der Wald lichtete sich immer mehr, und Rivera erblickte einen Baumstumpf, der die Spuren von menschlichen Werkzeugen zeigte. Er gab seinen Männern das Signal zum Anhalten, warf sich auf den Boden und kroch langsam weiter.
Die gewundene grasbewachsene Straße, die er erreichte, war gut vier Meter breit, doch sie schien so angelegt worden zu sein, dass sie von der Luft aus nur schwer zu erkennen war. Er kroch unter einen Busch und blickte die Straße entlang nach Süden. Da war nichts zu sehen außer einer einsamen Kuh, die zwischen ein paar Blumen graste.
»Ich habe die Straße gefunden«, flüsterte er in sein Mikrofon. »Wir gehen in Richtung … Moment. Da rührt sich etwas.«
Ein junges Mädchen kam um die Straßenbiegung gelaufen, nackt bis auf eine lange Kette, die von ihrem Hals herunterhing. Ihr atemloses Heulen war erschreckend laut, und Rivera versuchte vergeblich zu verstehen, was sie zwischen den Schluchzern stammelte.
Die Kuh erwachte aus ihrem Dämmerzustand, doch anstatt das Mädchen anzusehen, wandte sich das Tier in die Richtung, aus der sie gekommen war. Ihr nervöses Stampfen ließ Staub von ihrem Körper aufsteigen.
Rivera rührte sich nicht von der Stelle und wartete darauf, dass das Mädchen vorbeilief. Doch keine drei Meter vor ihm tauchte sie plötzlich in den Wald ein und begann im Gebüsch zu wühlen, als würde sie etwas suchen.
Wenige Augenblicke später sah Rivera, wovor sie geflüchtet war. Etwa hundert Meter weiter südlich tauchte an der Straßenbiegung eine große Schar Leute auf. Es sah so aus, als wäre ein ganzes Dorf in Rage geraten. Ihre Gesichter waren ebenso blutverschmiert wie die Körper und die Kleider. Die erwachsenen Männer und Frauen liefen vorne, die Kinder und Älteren konnten nicht ganz mithalten, schienen es aber genauso eilig zu haben.
»Feindliche Aktivität von Süden«, flüsterte Rivera in sein Funkgerät.
Die Blätter über ihm wurden weggezogen, und er packte das Mädchen, zog sie auf den Boden und drückte ihr eine Hand auf den Mund. Sie wand sich unter ihm, doch so erschöpft wie sie war fiel es ihm nicht schwer, sie unter Kontrolle zu halten.
Mit seiner freien Hand griff er an sein Mikro. »Fünfunddreißig bis vierzig Leute. Keine Waffen zu sehen. Zieht euch zurück. Wir versuchen uns rauszuhalten.«
Er kroch unter dem Busch hervor, doch dann erstarrte er. Die Kuh stürmte in Richtung des Waldes, mindestens fünf Leute überrannten das aufgeschreckte Tier und rissen es von den Beinen. Das Mädchen wand sich unter ihm und begann an seinem Ärmel zu ziehen, um ihn zum Weglaufen zu bewegen.
Die Kuh versuchte verzweifelt, wieder auf die Beine zu kommen, doch das Gewicht der Leute, die auf ihr lagen, hinderte sie daran. Sie schrien wütend und frustriert, während sie das hilflose Tier mit Fäusten, Füßen und Zähnen traktierten. Ein Mann, der nur mit Shorts bekleidet war, bekam einen mächtigen Tritt ins Gesicht, und Rivera nahm an, dass er tot war, als er zu Boden sank – doch im nächsten Augenblick kroch er benommen zu dem bereits geschwächten Tier zurück.
Rivera sprang auf, packte das Mädchen und lief dorthin zurück, woher er gekommen war. Sie waren keine zehn Meter weit gekommen, als er hinter sich die Geräusche der Dorfbewohner hörte, die in den Wald gestürmt kamen.
Im nächsten Augenblick sah er vor sich Mündungsfeuer aufblitzen. Das beruhigende Krachen von Gewehrschüssen übertönte das schaurige Geheul seiner Verfolger, und er spürte, wie sich die leise Panik, die ihn beschlichen hatte, wieder legte.
Seine Jungs schossen nicht daneben. Nie.
Er fand eine brauchbare Verteidigungsposition zwischen zwei mächtigen Bäumen, blieb stehen und drehte sich um, um das Geschehen durch das Visier seines AK-47 zu beobachten.
Kein Verfolger mehr zu sehen – sie waren von den leichter zu erkennenden Positionen seiner Männer abgelenkt worden und liefen rechts und links von ihm den tödlichen Kugeln entgegen. Keiner kümmerte sich darum, wenn neben ihm einer getroffen wurde, sie rannten blindlings weiter, an den Gefallenen vorbei oder über sie hinweg, ausschließlich auf die Männer fixiert, die auf sie schossen. Manch ein tödlich Getroffener schien gar nicht zu begreifen, was mit ihm geschehen war. Er versuchte wieder aufzustehen, bevor er endgültig tot zusammenbrach.
Sein Stellvertreter sah sich vier Leuten gegenüber, die auf ihn zugestürmt kamen und nur noch fünfzehn Meter von ihm entfernt waren. Zwei Männer, ein höchstens sechsjähriges Kind und eine Frau mit einem – wie es aussah – gebrochenen Arm. Rivera konzentrierte sich auf die beiden unverletzten erwachsenen Männer und atmete tief ein, bevor er den Abzug drückte. Der Getroffene ging zu Boden, doch die drei anderen stürmten weiter und prallten so heftig gegen seinen alten Freund, dass es zwischen den Bäumen widerhallte.
Rivera versuchte noch einen Schuss anzubringen, doch er sah nur noch ein Menschenknäuel, das Aufblitzen eines Messers und Blut. Er konnte nichts tun. Sein Freund – ein Mann, an dessen Seite er seit mehr als fünf Jahren kämpfte und trainierte – würde diesen Ort nicht mehr verlassen.
»Rückzug!«, rief er in sein Mikrofon.
Seine Männer brachen aus der Deckung hervor, und er versuchte so gut er konnte, den Ansturm der wütenden Meute aufzuhalten.
Donny Praman lief auf einen Graben zu, während aus nördlicher Richtung eine Frau in den blutigen und zerfetzten Überresten eines traditionellen Gewands auf ihn zugestürmt kam. Rivera beachtete sie zuerst nicht weiter, bis er verblüfft erkannte, dass die Frau schneller war als er und ihn fast schon eingeholt hatte.
Er gab einen Schuss ab, doch in seiner Verwirrung traf er den Baum neben ihrer Schulter.
Die Schüsse seiner Männer wurden immer unkontrollierter, und in ihren Zurufen schwang nun schon Panik mit, als Rivera noch einmal zielte. Er hatte sie fast im Fadenkreuz, als sie auf Pramans Rücken sprang und mit ihm eine steile Böschung hinunterrollte.
Das Mädchen hinter ihm weinte und stammelte etwas, doch er hörte kaum hin; er konnte immer noch nicht glauben, was er gerade gesehen hatte: Eine dicke Frau hatte einen Soldaten angefallen und niedergerissen – einen der besten Männer, mit denen er je zusammengearbeitet hatte. Vielleicht einen der besten überhaupt.
Das Mädchen sprang plötzlich vor und zeigte aufgeregt mit dem Finger. Als er sich umblickte, sah er, dass er mit seinen Schüssen die Aufmerksamkeit von fünf Afrikanern auf sich gezogen hatte, die nun direkt auf sie zukamen.
Rivera feuerte in die Gruppe und traf den ersten Mann, und die beiden nächsten stürzten über ihn. Sie blickten nicht nach unten, als sie zu Boden gingen – ihr starrer Blick blieb auf ihn und das Mädchen gerichtet.
Er zielte erneut, doch es war hoffnungslos. Die beiden Gestürzten waren schon wieder auf den Beinen, und von Osten kamen drei andere dazu.
Er packte das Mädchen am Arm und rannte, während er versuchte, nicht auf die Schüsse seiner Freunde zu achten, die immer seltener kamen und schließlich ganz verstummten.
Kapitelsechs
SOUTH DAKOTA, USA
12. November, 08:30 Uhr GMT-7
Dr. Jonathan Smith sah langsam einen Stapel Krankenblätter durch, während die Schwester ihm schilderte, was sich im Zustand seiner jungen Patienten verändert hatte. Er blickte alle paar Sekunden zu ihr auf – vor allem um ihr zu zeigen, dass er noch zuhörte, aber auch, um ihre rote Haarpracht zu bewundern, die über ihre Schultern und ihre makellose elfenbeinfarbene Haut fiel.
»Jon Boy!«
Dr. Derek Cantor tauchte am Ende des Ganges auf und eilte schnaufend zu ihm herüber. Der graue Haarkranz auf seinem kahlen Kopf hüpfte mit seinem Bauch im Takt und ließ ihn zusammen mit seinen großen Schuhen ein bisschen wie einen Clown außer Dienst aussehen. Das war einer der vielen Gründe, warum ihn vor allem die jüngeren Patienten liebten.
»Derek. Genau der Mann, den ich sprechen wollte«, sagte Smith. »Ich war gestern im Lebensmittelladen, aber sie lassen mich immer noch nicht bezahlen.«
»Ich hab mit ihnen gesprochen, alter Junge, aber es ist nun mal so, dass keiner Geld von dir nimmt. Verdammt, wenn ich das sehe, dann bin ich richtig froh, dass ich noch meine Steuer zahlen darf.«
Smith zog die Stirn in Falten. Die Sache wurde langsam unheimlich. Der Inhaber des alten Cowboy-Motels, in dem er sich einquartiert hatte, brachte ihm jeden Abend eine selbst gekochte Mahlzeit, und als er gestern das Stoppschild direkt vor der Polizeiwache überfahren hatte, lächelte ihm der Sheriff nur zu und hielt den Daumen hoch.
Cantor zeigte auf die Schwester, die hinter Smith stand. »Also, wie sieht’s aus, Stace?«
»Ich glaube, wir sind über den Berg.«
»Auch Tina?«
»Hat sich deutlich gebessert seit gestern Abend.«
Cantor klatschte laut in die Hände und eilte weiter. »Ich frag mich, ob man auch Trinkgeld in die Steuererklärung reinnehmen kann. Ruft doch mal einer meinen Steuerberater an!«
Smith wandte sich wieder dem Krankenblatt zu, schüttelte den Kopf und lachte leise.
»Es fängt an zu schneien«, sagte Stacy. Ihre Stimme klang so beunruhigt, dass Smith durch das Fenster auf die nicht allzu dichten Schneeflocken hinaussah. Kein Unwetter, das einem Mädchen Angst machen sollte, das in dieser kleinen Stadt in South Dakota aufgewachsen war.
»Die Straße wird glatt sein«, fuhr sie fort. »Das kann ziemlich gefährlich sein für jemanden, der nie bei solchen Straßenverhältnissen fährt. Ich könnte Sie heute Abend zurück ins Hotel fahren …«
Er warf das Krankenblatt auf die Theke zwischen ihnen und suchte in ihrem Gesicht nach irgendeinem kleinen Fältchen. Er fand keines und schätzte ihr Alter auf ungefähr fünfundzwanzig – ganze neunzehn Jahre jünger als er.
»Und wissen Sie, Jon, mein Bruder hat das beste Restaurant in der Stadt. Es liegt auf dem Weg – wir könnten ja kurz reingehen und ein bisschen was essen.«
Es war durchaus möglich, dass sie ihn für deutlich jünger hielt, als er tatsächlich war. Seine Schultern waren immer noch breit und seine Hüften schmal, doch sie konnte nicht wissen, dass es ihn immer mehr Mühe kostete, in Form zu bleiben. Sein kurzes schwarzes Haar war immer noch dicht, und seiner relativ dunklen Haut sah man noch nicht an, wie hart seine Einsätze manchmal waren.
Smiths erster Reflex war, nein zu sagen – private Abenteuer vertrugen sich nicht gut mit seinem Beruf. Andererseits war ein Abendessen mit einer klugen schönen Frau eine angenehmere Aussicht, als wieder einmal vor dem Fernseher zu hocken und sich irgendeine Wiederholung auf dem einzigen Sender anzusehen, den man in dem Hotel reinbekam.
»Gibt‘s auch Steak dort?«
Sie lächelte breit, und nicht einmal jetzt tauchte in ihren Augenwinkeln das kleinste Fältchen auf. »So ein gutes haben Sie noch nie gegessen.«
Er nickte und drehte sich um, um in die provisorische Quarantänestation zu gehen, die man im hinteren Teil des Krankenhauses eingerichtet hatte. »Dann bin ich dabei.«
Am Ende des Ganges schlüpfte Smith durch ein Absperrband und einen Plastikvorhang, ehe er durch die Doppeltür eintrat.
»Okay, wie geht’s euch allen?«
Acht Kinder lagen in den Betten, die vor der Wand aufgereiht waren. Einige waren mit Videospielen beschäftigt und sahen aus, als dürften sie bald nach Hause, während andere noch Mühe hatten, aufrecht zu sitzen.
»Guten Morgen, Colonel Smith«, grüßten sie im Chor, so wie man es ihnen beigebracht hatte.
Er setzte sich auf einen Rollschemel und stieß sich vom Boden ab, sodass er direkt zum Bett eines jungen Mädchens glitt, das gerade in die fünfte Klasse gekommen war. »Ich hab gehört, dir geht’s schon wieder prächtig, Tina.«
Sie hustete und bemühte sich sichtlich, es besser klingen zu lassen, als es war. »Ich fühle mich schon viel besser als gestern.«
»Das freut mich sehr«, sagte er, dann streifte er Handschuhe über und überprüfte ihre Lymphknoten.
In einer kleinen Stadt aufzuwachsen, wo jeder jeden kannte, konnte etwas Wunderbares sein, aber so wie alles im Leben hatte es auch seine Nachteile. So gab es zufällig in dieser Stadt eine sehr charismatische Frau, die davon überzeugt war, dass der Autismus ihres Sohnes von Impfungen verursacht worden war. Seither führte sie eine erschreckend erfolgreiche Kampagne gegen das Impfen und versuchte alle, die sie kannte, dazu zu bewegen, ihre Kinder nicht mehr impfen zu lassen.
Der erste Masernfall war vor einem Monat aufgetreten – ein sechsjähriger Junge, der auf einer Ranch im Norden wohnte; er hatte auch seine Klassenkameraden in der einzigen Schule des Städtchens angesteckt. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Krankheit ausbreitete, überraschte alle; es lag wohl vor allem daran, dass die Impfrate nicht mehr hoch genug war, um die sogenannte Herdenimmunität zu sichern und eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.
Als ein kleines Mädchen an Komplikationen im Verlauf der Krankheit starb, wandten sich die überforderten Ärzte in ihrer Verzweiflung an die Regierung und die Centers for Disease Control. Die Nachricht gelangte schließlich bis Fort Detrick, wo Smith als Army-Spezialist für Infektionskrankheiten tätig war. Es war schon viel zu lange her, dass er selbst am Krankenbett eines Patienten gestanden hatte, und so erklärte er sich sofort bereit, sich der Sache anzunehmen.
»Wie fühlt sich mein Hals an?«, fragte Tina und sah ihn hoffnungsvoll an.
»Sehr gut. Bald bist du wieder auf den Beinen.«
»Wirklich?«
»Ich schwör’s.«
Sein Handy klingelte, und er griff in seine Tasche, um nach der Nummer des Anrufers zu sehen. Mit einem Stirnrunzeln blickte er auf das winzige Verschlüsselungssymbol, das auf dem Display erschien.
»Wer ist es denn?«, wollte Tina wissen.
»Meine Mom«, log Smith, ohne zu zögern – eine Fähigkeit, die er sich in seiner Zeit beim Geheimdienst angeeignet hatte. »Und seine Mom kann man nicht warten lassen, stimmt’s?«
Kapitelsieben
NORDUGANDA
12. November, 18:53 Uhr GMT+3
Lieutenant Craig Rivera warf sein leeres Gewehr weg und riss eine Pistole aus dem Hüftholster, ohne auch nur eine Spur langsamer zu werden. Er stolperte beinahe über ein paar lose Gesteinsbrocken und riskierte einen raschen Blick über die Schulter zurück, als er das Gleichgewicht wiederfand. Es waren immer noch vier Leute hinter ihm, und sie holten rasch auf. Das junge Mädchen, das ihm aus purer Angst gefolgt war, schien nun nicht mehr mit ihm Schritt halten zu können. Die Erschöpfung war offenbar stärker als das Adrenalin, das sie antrieb.
Er jagte einem Mann mit einem blutbefleckten Manchester-United-Trikot eine Kugel in die Brust, hob das geschwächte Mädchen auf und versuchte noch mehr aus seinen müden Beinen herauszuholen.
Die unbegreifliche Wahrheit war jedoch, dass die Leute, die ihn verfolgten, schneller waren als er an seinem besten Tag. Und mit dem zusätzlichen Gewicht des Mädchens war es nur noch eine Frage von Sekunden, bis sie ihn eingeholt hatten. Rivera schlug einen Haken nach rechts in ein Gebüsch mit Blättern so groß wie Elefantenohren, in der Hoffnung, es seinen Verfolgern im dichten Gestrüpp schwerer zu machen.
Die nassen Blätter schlugen schmerzhaft gegen sein Gesicht, nahmen ihm die Sicht und drohten ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen, als sich das Mädchen in seinen Armen zu winden begann. Sie waren nur noch wenige Schritte hinter ihm. Er würde es nicht schaffen.
Rivera spürte eine Hand in seinem Nacken, und dann wich die Dunkelheit des Regenwalds dem strahlend hellen Sonnenlicht. Das Geräusch seiner Schritte und das seiner Verfolger verstummte jäh, und er stürzte Hals über Kopf durch die Luft, ohne zu begreifen, wieso die Welt um ihn herum sich so schwindelerregend drehte – die Leute, die mit ihm fielen, der grüne Dschungel, der blaue Himmel.
Der Schmerz des Aufpralls überraschte ihn. Er war so lange in der Luft, dass er erwartete, augenblicklich tot zu sein. Schmutziges Wasser wirbelte um ihn herum, während er verzweifelt versuchte, das Mädchen nicht zu verlieren und gleichzeitig herauszufinden, wo oben und unten war.
Seine Lungen begannen rasch zu brennen, doch er ignorierte es so lange er konnte und wartete, bis er das Bewusstsein zu verlieren drohte, ehe er auftauchte. Nur einer seiner Verfolger war noch zu sehen, er schlug wild um sich in dem verzweifelten Versuch, sich in dem reißenden Fluss über Wasser zu halten. Die anderen schienen bereits untergegangen zu sein.
Rivera blickte zu der zwanzig Meter hohen Felsklippe hinauf, von der er gestürzt war, und sah jetzt auch die Leute, die oben am Rand standen. Ihre Augen waren auf ihn gerichtet, doch sie schienen nicht recht zu wissen, was sie tun sollten.
Er drehte sich in die Richtung, in die das Wasser ihn trug, und verstärkte seinen Griff um das reglose Mädchen. Als ihr Kopf gegen seine Brust schlug, fiel ihm auf, dass ihr Hals unter der Kette, die immer noch daran hing, unnatürlich abgeknickt war, und er ließ ihren toten Körper widerstrebend davontreiben.
Oben auf der Klippe folgten ihm die Afrikaner und suchten nach einem Weg zum Fluss hinunter. Er versuchte ans andere Ufer zu schwimmen, doch die Strömung war zu stark und trieb ihn und alles andere, was die Fluten mit sich trugen, zur Mitte des Flusses.
Ein Baumstamm traf ihn hart von hinten, riss ihn mit sich und tauchte ihn unter Wasser. Er versuchte sich abzustoßen und wieder nach oben zu kommen, doch sein rechtes Bein wollte ihm nicht mehr gehorchen. Wasser drang ihm in den Mund und weiter zur Lunge, während er verzweifelt versuchte, die Oberfläche zu erreichen.
Er sah das Sonnenlicht, er stellte sich seine Wärme vor, doch je länger er kämpfte, umso weiter schien sich das Licht zu entfernen. Er erinnerte sich an den See, zu dem er mit seiner Familie so oft gefahren war, als er ein Junge war. Und plötzlich war er wieder dort und schwamm mit seinen Brüdern. Er war so müde. War es nicht Zeit, zu rasten?
Charles Sembutu verfolgte gelassen, wie Admiral Kaye den Frauen an den Computerstationen Befehle zurief. Drei der Bildschirme waren dunkel, einer zeigte nur noch den blauen Himmel. Auf dem fünften war eine reglose weiße Hand zu sehen, mit einem Messer, das im Hals eines kleinen Jungen steckte.
»Kommt noch irgendetwas von Rivera?«, fragte Kaye, obwohl die Antwort eindeutig war.
»Keine Funkverbindung, Sir. Auch kein Bild mehr.«
Er beugte sich über den Stuhl einer der beiden Frauen. »Spielen Sie noch einmal die letzten Bilder ab, die wir von seiner Kamera haben. Aber langsam.«
Sie holte die Aufnahme auf den toten Bildschirm zurück, und sie sahen Blätter gegen das Objektiv klatschen, dann einen Moment lang die Leute, die ihn jagten, und schließlich den Absturz.
»Sir, das da unten sieht aus wie Wasser, und unsere Satellitenbilder bestätigen, dass ganz in der Nähe der Stelle, wo es zu dem Zusammenstoß gekommen ist, ein Fluss von Ost nach West fließt. Er könnte noch leben. Kann ich dem Rückführungsteam seine letzten bekannten Koordinaten durchgeben?«
Kaye blickte zurück, und Sembutu sah ihm in die Augen, ohne seinen Ärger zu zeigen. Wenn jemand bei ihm seine Aufgabe nicht erfüllte, dann waren die Tage des Betreffenden normalerweise gezählt. Leider war eine solche Vorgangsweise bei den Amerikanern nicht möglich.
Für ihn war es ein perfektes Szenario gewesen; er überließ es den Fremden, ihm einen Mann vom Hals zu schaffen, den mittlerweile alle hassten, und erntete hinterher selbst die Lorbeeren dafür. Er würde mit einem Schlag die Bedrohung aus der Welt schaffen, seine Macht festigen und sich von der ländlichen Bevölkerung, die am meisten unter Bahame zu leiden hatte, als Helden feiern lassen.
Doch die Amerikaner hatten die Operation vermasselt, wie er es befürchtet hatte. Bei all ihren Fähigkeiten hingen die Soldaten der westlichen Welt einfach zu sehr an ihren Traditionen und ihren nutzlosen Moralvorstellungen, um in Afrika effektiv zu kämpfen.
Jetzt blieb ihm nichts anderes übrig, als die Partnerschaft anzunehmen, die ihm die Iraner angeboten hatten. Es war ein gefährliches Spiel, aber er konnte sich seine Partner eben nicht mehr aussuchen. Bahames Armee drang immer weiter nach Süden vor und würde bald zum Sturmangriff auf die Hauptstadt Ugandas blasen. Es musste schnell etwas geschehen.
Doch er musste sehr vorsichtig vorgehen. Die Amerikaner durften auf keinen Fall Wind davon bekommen, was die Iraner vorhatten, und dass er damit zu tun hatte. Anderenfalls musste er mit einem Vergeltungsschlag rechnen, der seinem Land schweren Schaden zufügen und ihn selbst möglicherweise das Leben kosten würde.
Kaye machte einen zögernden Schritt zurück und zeigte seine Schwäche, seine irrationale Sorge um einen einzelnen Soldaten.
»Nein«, sagte der Admiral. »Das Rückführungsteam soll sich beim Treffpunkt bereithalten.«
»Aber Sir, der Sturz. Er ist wahrscheinlich …«
»Sie haben gehört, was ich gesagt habe, Lieutenant. Wir warten zweiundsiebzig Stunden. Dann ist Schluss, und wir ziehen uns zurück.«
Kapitelacht
WASHINGTON D.C., USA
13. November, 09:00 Uhr GMT-5
Präsident Sam Adams Castilla legte die Füße auf den schweren Beistelltisch aus Kiefernholz, den er aus dem Haus des Gouverneurs in Santa Fe mitgebracht hatte. Das Aussehen des Oval Office hatte sich ständig weiterentwickelt, seit er hier eingezogen war; Einrichtungsgegenstände von zu Hause wurden nach und nach durch Geschenke ersetzt, die er bei seinen offiziellen Reisen bekam. Sie erinnerten ihn an die Größe und Bedeutung seiner Verantwortung.
»Haben Sie noch Fragen, Sir?«
Lawrence Drake, der Direktor der CIA, saß ihm gegenüber in einem Ohrensessel, einem Geschenk der Franzosen – die Amerika sofort den Krieg erklären würden, wenn sie gewusst hätten, dass er den Stuhl mit einer indianischen Decke hatte beziehen lassen.
»Zu Nordkorea?«
»Ja, Sir.«
Castilla runzelte nachdenklich die Stirn. Die Berichte, die ihm der Auslandsgeheimdienst lieferte, schienen immer komplizierter und deprimierender zu werden. China, Russland, Israel, der Nahe Osten – sie alle waren für sich schon unglaublich harte Brocken, die jedoch so ineinander verflochten waren, dass sie ein völlig undurchschaubares Gewirr bildeten.
»Nein, gehen wir weiter, Larry. Was haben wir sonst noch?«
»Den Iran.«
Die Originalausgabe THE ARES DECISION erschien 2011 bei Grand Central Publishing, New York
Vollständige deutsche Erstausgabe 01/2012 Copyright © 2011 by Myn Pyn, LLC Copyright © 2012 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Alexandra Klepper Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Motivs von © Thinkstock Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
eISBN 978-3-641-09197-2
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe