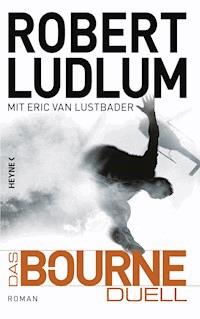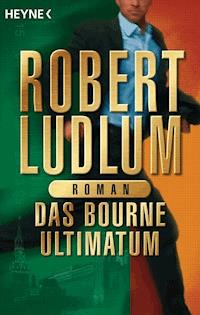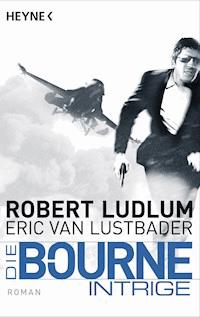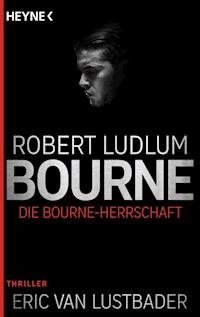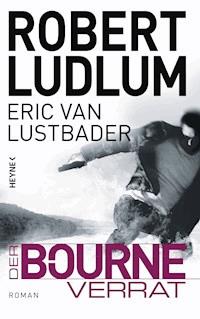
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JASON BOURNE
- Sprache: Deutsch
Actionreiche Hochspannung – der neue Bourne!
Vor der schwedischen Küste zieht Jason Bourne einen Bewusstlosen aus dem Meer. Als der Mann zu sich kommt, fehlt ihm jede Erinnerung an sein bisheriges Leben – eine unheimliche Parallele zu Bournes eigenem Schicksal. Die Lösung scheint in einem geheimen Mossad-Lager im Libanon zu liegen, in das sich Bourne Wochen zuvor geflüchtet hatte. Was geht dort vor sich? In letzter Minute erkennt Bourne einen zerstörerischen Plan, der nicht nur sein Leben, sondern die Sicherheit der Welt bedrohen könnte.
Als der mysteriöse Unbekannte, dem Jason Bourne kurz zuvor das Leben gerettet hat, das Bewusstsein wiedererlangt, greift er Bourne an und flüchtet. Was verbirgt der Mann? Dass Rebekka, eine mit Bourne befreundete Mossad-Agentin, offenkundig hinter dem Mann her ist, macht das Rätsel nur noch größer. In einem verborgenen Mossad-Lager im Libanon finden sie eine erste Spur. Diese führt sie nach Mexiko, wo Bourne und Rebekka den Flüchtigen schließlich im Haus eines mexikanischen Software-Magnaten aufspüren. Sie machen eine schreckliche Entdeckung: Eine teuflische Technologie, die in den falschen Händen Tod und Verderben bringen würde, steht kurz vor dem Abschluss. Die Spur des Komplotts reicht von Mexiko bis China und zu einem Energiekonzern, der – um den Markt zu beherrschen – buchstäblich über Leichen geht. Bourne ist fest entschlossen, dem Treiben ein Ende zu setzen, und stellt sich den dunklen Mächten entgegen. Koste es, was es wolle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ROBERT LUDLUM
ERIC VAN LUSTBADER
DER
BOURNE
VERRAT
ROMAN
Aus dem Amerikanischen von Norbert Jakober
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
The Bourne Imperative bei Grand Central Publishing, New York
Copyright © 2012 by MYN PYN, LLC
Copyright © 2014 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Published by arrangement with The Estate of Robert Ludlum
and Eric van Lustbader c/o BAROR INTERNATIONAL, INC.,
Armonk, New York, USA
Umschlag: Nele Schütz Design, München
Umschlagabbildung: Getty Images
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN 978-3-641-12489-2
www.heyne.de
Prolog
Sadelöga, Schweden
Sie tauchte aus dem Nebel auf, und er rannte, wie schon seit Stunden, seit Tagen. Es kam ihm vor, als wäre er schon wochenlang allein, auf der Flucht, mit dem quälenden Gedanken im Kopf, dass sie ihn hintergangen hatte. An Schlaf war nicht zu denken, nicht einmal an eine kurze Rast. Er wusste nur eines: Sie war ihm wieder auf den Fersen, nachdem er zum dreizehnten oder vierzehnten Mal geglaubt hatte, sie abgeschüttelt zu haben. Und doch war sie hier und verfolgte ihn wie ein Todesengel, unzerstörbar und unerbittlich.
Es gab nur noch sie beide, nichts mehr außerhalb der weißen Wand aus Schnee und Eis und der kleinen roten Fischerhäuser, die nur das Nötigste enthielten: eine Lebenseinstellung, die er bewunderte.
Der Nebel brannte wie Feuer: ein kaltes Feuer auf der Haut, wie die Berührung ihrer Hände … wann war das gewesen? Vor einigen Tagen? Vor einer Woche? Als sie noch mit ihm geschlafen hatte, als sie ein anderer Mensch gewesen war, seine Geliebte, eine Frau, die schnell herausfand, wie sie ihn zum Zittern bringen konnte vor Lust.
Er rannte und glitt über einen zugefrorenen See, rutschte aus, verlor seine Pistole, sie schlitterte über das Eis. Er wollte sich nach ihr bücken, da hörte er einen Zweig knacken, messerscharf in der kalten Luft.
Er ließ seine Waffe liegen und flüchtete in einen kleinen Kiefernwald. Pulvriger Schnee sprühte ihm ins Gesicht, bedeckte die Augenbrauen und seine Bartstoppeln von der langen Flucht quer über die Kontinente. Er verschwendete keine Sekunde mehr damit, sich nach seiner Verfolgerin umzublicken.
Sie war seiner Spur vom Libanon bis hierher gefolgt. Er war ihr in einer verrauchten Bar in Dahr El Ahmar begegnet, obwohl er sich inzwischen eingestand, dass ihre »Begegnung« wohl kein Zufall war, dass alles, was sie gesagt und getan hatte, einen bestimmten Zweck verfolgt hatte. Er sah das alles so klar vor sich – jetzt, da sich entscheiden musste, ob er entkommen oder sterben würde. Er hatte geglaubt, sie zu täuschen, doch in Wahrheit hatte sie ihn getäuscht – ihn, den erfahrenen, eiskalten Profi. Wie hatte er nur so unachtsam sein können? Die Antwort war klar: Der Todesengel war einfach unwiderstehlich.
Zwischen den Kiefern blieb er stehen und stieß eine dicke Atemwolke aus. Es war bitterkalt, doch in seiner Tarnjacke fühlte er sich, als würde er bei lebendigem Leib verbrennen. Er stützte sich auf einen schwarzen Baumstamm und ließ seine Gedanken zu jenem Hotelzimmer schweifen: der Gestank von Schweiß und Sex, dann dieser Augenblick, in dem sie ihn in die Lippe gebissen und geflüstert hatte: »Ich weiß es. Ich weiß, was du bist.«
Nicht wer, sondern was.
Sie wusste es. Er blickte sich in dem Gewirr der Zweige um, dem Labyrinth der Nadeln, in dem er sich versteckte. Es war unmöglich. Wie konnte sie es wissen? Und dennoch …
Erneut hörte er einen Zweig knacken und drehte sich ganz langsam um, alle Sinne auf die Richtung konzentriert, aus der das Geräusch gekommen war. Wo war sie? Der Tod konnte jeden Moment zuschlagen, doch er wusste, dass es kein schneller Tod sein würde. Es gab zu viele Geheimnisse, die sie ihm entreißen wollte, sonst hätte sie ihn schon in dem Hotelzimmer während des wilden Liebesspiels getötet. Der Gedanke daran erregte ihn immer noch, obwohl er genau wusste, wie nah er dem Tod gewesen war. Sie hatte mit ihm gespielt, vielleicht weil sie ihr Zusammensein genauso genossen hatte wie er. Er lächelte grimmig. Was war er doch für ein Narr! Er redete sich immer noch etwas ein, wo er es doch längst besser wusste. Diese Frau hatte ihn verzaubert! Zitternd ging er in die Hocke und drückte sich mit dem Rücken gegen die raue Kiefernrinde.
Er wollte nicht mehr weglaufen. Hier in dieser vereisten Einöde würde er ihr entgegentreten, auch wenn er noch nicht wusste, wie er das Zusammentreffen überleben sollte. Hinter sich hörte er das Rauschen des Wassers. In Sadelöga war die Ostsee immer nah, überall lag ein Geruch von Salz und Seetang in der Luft.
In seinem Augenwinkel tauchte ein Schatten auf. Da war sie! Hatte sie ihn gesehen? Er wollte sich bewegen, doch seine Beine fühlten sich an wie aus Blei. Er spürte seine Füße nicht mehr. Langsam drehte er den Kopf und sah sie zwischen den Bäumen näher kommen.
Sie hielt inne, legte den Kopf auf die Seite und lauschte, als könnte sie ihn atmen hören.
Unwillkürlich strich seine Zunge über die geschwollene Unterlippe. Seine Gedanken flogen zu einer Ausstellung von japanischen Holzschnitten, die er einmal gesehen hatte. Die Arbeiten strahlten Klarheit und Gelassenheit aus, bis auf eine erotische Darstellung einer Frau in höchster Ekstase in den acht Armen ihres Geliebten. So ungefähr sah er seine gefährliche Geliebte und Verfolgerin. In dem stinkenden Hotelzimmer in Dahr El Ahmar hatte er den Gipfel der Ekstase erreicht, wie die Frau in dem Kunstwerk. So gesehen, bereute er nichts. Nie hatte er gedacht, dass ihm jemand solche Lust bereiten könnte, und er empfand eine perverse Dankbarkeit, obwohl ihm diese Frau vielleicht den Tod bringen würde.
Er erschrak. Sie kam näher. Obwohl er sie in dem Labyrinth von Bäumen nicht hören und auch nicht mehr sehen konnte, spürte er ihre Anwesenheit, als würde sie auf unerklärliche Weise von ihm angezogen werden. Er saß still da und bereitete sich in Gedanken auf den Moment vor, in dem sie ihn finden würde.
Er brauchte nicht lange zu warten. Die Sekunden vergingen langsam, als würden sie mit dem Wasser hinter ihm forttreiben. Er hörte sie seinen Namen rufen, leise und sanft, wie sie es im Bett getan hatte, als ihre Körper ekstatisch ineinander verschlungen waren. Ein Schauer lief ihm über den Rücken und zwischen die Beine.
Doch er war noch nicht am Ende. Es lag an ihm, dieses Schlachtfeld lebend zu verlassen.
Er senkte den Kopf und zog die Knie langsam an die Brust. Der Schneefall musste stärker geworden sein, denn immer mehr Flocken fanden den Weg durch das Gewirr der Kiefernnadeln. Die grünen Schatten verfärbten sich dunkelgrau und machten ihn fast unsichtbar. Der Schnee legte sich leicht wie das Flattern von Engelsflügeln auf ihn. Sein Herz hämmerte, er spürte den Puls in seinem Hals.
Noch lebe ich, dachte er.
Er fühlte ihre Nähe, als sie zwischen zwei Kiefern durchschlüpfte. Seine Nasenflügel blähten sich, ein Tier witterte das andere. Egal, wie es ausging, die Jagd war zu Ende. Er spürte eine gewisse Erleichterung. Bald würde es vorbei sein.
Sie war nun so nah, dass er das Knirschen ihrer Stiefel auf der dünnen Schneedecke hörte. Zwei Meter vor ihm blieb sie stehen. Ihr Schatten fiel auf ihn; er hatte ihn immer gespürt in den Wochen, in denen er vergeblich versucht hatte, sie abzuschütteln.
Ich weiß, was du bist, hatte sie gesagt, also wusste sie auch, dass er auf sich allein gestellt war. Es gab keine Kontaktpersonen, an die er sich im Notfall wenden konnte. Er war völlig isoliert, damit der Organisation keine Gefahr drohte, falls er gefasst und einem verschärften Verhör unterzogen wurde. Dennoch kannte er einige brisante Geheimnisse, und sie würde gewiss alles tun, um sie ihm zu entreißen.
Wieder sagte sie seinen Namen, diesmal deutlicher, und er hob das Kinn von seiner Brust und schaute ihr in die Augen. Sie hielt ihre Pistole auf sein rechtes Knie gerichtet.
»Die Flucht ist zu Ende«, sagte sie.
»Stimmt«, nickte er.
Sie sah ihn mit einem seltsamen, fast gütigen Ausdruck an. »Das mit der Lippe tut mir leid.«
Er lachte kurz und bitter auf. »Ich habe wohl einen kräftigen Weckruf gebraucht.«
Ihre Augen hatten die Farbe und Form von reifen Oliven und bildeten einen lebhaften Kontrast zu ihrer braun getönten Haut und dem schwarzen Haar, das bis auf ein paar Strähnen unter der Kapuze verborgen war. »Warum tust du, was du tust?«
»Warum tust du es?«
Sie lachte leise. »Das ist ganz einfach.« Sie hatte eine edle römische Nase, feine Wangenknochen und einen sinnlichen Mund. »Ich kämpfe für die Sicherheit meines Landes.«
»Auf Kosten aller anderen Länder.«
»Wenn es sein muss, ja.« Sie schüttelte den Kopf. »Aber das verstehst du nicht.«
»Du bist dir deiner Sache sehr sicher.«
Sie zuckte die Achseln. »So bin ich nun mal.«
Er rührte sich ganz leicht. »Sag mir eines. Was hast du dir dabei gedacht, als wir miteinander im Bett waren?«
Ihr Lächeln veränderte sich ganz leicht, doch das war auch schon ihre ganze Antwort.
»Du wirst mir erzählen, was ich wissen will«, sagte sie schließlich. »Erzähl mir vom Dschihad bis-sayf.«
»Nicht einmal an der Schwelle des Todes.«
Ihr Lächeln hatte wieder etwas Intimes und Geheimnisvolles, so wie in dem Hotelzimmer in Dahr El Ahmar. Er hatte es für einen Ausdruck dessen gehalten, was zwischen ihnen war, und das war nicht einmal falsch. Doch die Wahrheit dahinter war ihm entgangen.
»Du hast kein Land, dem du dich verpflichtet fühlst. Dafür haben deine Herren schon gesorgt.«
»Wir haben alle unsere Herren«, erwiderte er. »Auch wenn wir uns etwas anderes einreden.«
Als sie einen Schritt auf ihn zu machte, stieß er mit dem Messer zu, das er eng am Körper gehalten hatte. Sie stand zu nahe, um ausweichen zu können. Als sie reagierte, hatte das Messer bereits ihren Parka zerrissen und sich in ihre rechte Schulter gebohrt. Sie schwenkte die Pistole wieder auf ihn, doch er stürzte sich auf sie, warf sie auf den Rücken und drückte sie mit seinem größeren Gewicht in den Schnee.
Er versetzte ihr einen harten Fausthieb gegen den Kiefer. Ihre Pistole lag ein paar Meter entfernt im Schnee. Sie überwand ihre Benommenheit und warf ihn ab. Im Fallen erwischte er den Griff des Messers und stieß es noch tiefer in ihre Schulter. Sie biss die Zähne zusammen und rammte ihm die Finger gegen den Kehlkopf. Hustend und würgend ließ er das Messer los. Sie packte es und zog es heraus. Dunkel schimmerndes Blut lief an der schmalen Klinge hinunter.
Er wirbelte herum, schnappte sich ihre Pistole und richtete sie auf sie. Als sie ihm ins Gesicht lachte, drückte er ab, wieder und wieder. Das Magazin war leer. Was hatte sie vorgehabt? Der Gedanke wirbelte ihm durch den Kopf, während sie eine Glock 20 aus dem Parka zog. Er schleuderte ihr die nutzlose Waffe an den Kopf, drehte sich um und lief. Im Zickzack zwischen den Bäumen hindurch, zum Wasser hinunter. Seine einzige Chance, zu entkommen.
Im Laufen riss er den Reißverschluss seiner Jacke auf und schüttelte sie ab. Im Wasser würde sie ihn nur nach unten ziehen. Das Wasser würde eiskalt sein – so kalt, dass ihm höchstens fünf, sechs Minuten blieben, um sich in Sicherheit zu bringen, bevor ihn die Kälte lähmen und er hilflos untergehen würde.
Ein Schuss pfiff an seinem rechten Knie vorbei, und er stolperte, krachte gegen einen Baum und lief weiter durch den Wald, zum Wasser hin, dessen Rauschen wie eine rettende Armee immer näher kam. Er keuchte eine Atemwolke vor sich her und trieb sich weiter an.
Als er das Wasser aufblitzen sah, hob sich sein Herz, und das Atmen fiel ihm leichter. Er hetzte zwischen den Kiefern hervor, über das verschneite Gras und zwischen den Felsen hindurch, die steil zum Meer abfielen.
Er war fast am Ziel, als er auf einer schlammigen Stelle ausrutschte. Im selben Augenblick streifte ihn eine Kugel am Kopf, die für seine Schulter bestimmt war. Er rannte blindlings weiter, mit brennenden Beinen, Blut in den Augen, und warf sich schließlich in das eisige Nass.
Jason Bourne ließ seinen Blick über die winzigen Inseln in der Umgebung schweifen, während er in dem kleinen Boot saß und die Angel im Wasser kreisen ließ, um vielleicht eine Seeforelle, einen Hecht oder Barsch zu fangen.
»Sie angeln nicht besonders gern, oder?«, meinte Christien Norén.
Bourne brummte etwas und wischte sich den Schnee von den Ärmeln. Der heftige Schneefall hörte so plötzlich auf, wie er begonnen hatte. Der Himmel war in trostloses Grau gehüllt.
»Halten Sie die Angel still«, mahnte Christien. »Sie vertreiben ja die Fische.«
»Nicht ich.« Bourne blickte stirnrunzelnd ins Wasser mit seinen braunen und grünen Farbtönen. Dunkle Schatten wiegten sich wie zu einer unhörbaren Melodie. »Etwas anderes vertreibt sie.«
»Oho«, lachte Christien. »Da haben wir’s wohl mit einer Unterwasser-Verschwörung zu tun.«
Bourne blickte zu ihm auf. »Warum sind Sie mit mir hier herausgefahren? Ihnen macht das Angeln doch auch nicht viel mehr Spaß als mir.«
Christien schaute ihn einen Moment lang schweigend an. »Wenn man über Verschwörungen sprechen will, tut man das am besten an einem Ort ohne Wände.«
»Deshalb also wollten Sie von Stockholm weg.«
Christien nickte. »Nur dass Sadelöga auch nicht abgelegen genug ist.«
»Aber hier draußen auf dem Wasser ist es ideal.«
»Genau.«
»Ich hoffe, Sie haben eine gute Erklärung für das, was Sie und Don Fernando im Schilde führen. Was ich von Peter Marks in Washington gehört habe …«
»Das ist nicht gut«, stimmte Christien zu. »Es ist sogar ziemlich schlimm. Und deshalb …«
Bourne brachte ihn mit einer knappen Geste zum Schweigen. Er deutete auf das Kräuseln des Wassers ganz nah beim Boot. Etwas regte sich unter der Oberfläche, etwas Großes, das nach oben strebte.
»Großer Gott«, rief Christien aus.
Bourne ließ seine Angel los und griff nach dem menschlichen Körper, der aus der Tiefe auftauchte.
ERSTES BUCH
1
»Gerüchte, Andeutungen, Vermutungen.« Der Präsident der Vereinigten Staaten überflog über den Tisch hinweg den ledergebundenen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministers.
»Bei allem Respekt, Sir«, entgegnete Christopher Hendricks, »ich denke, es ist schon etwas mehr.«
Der Präsident sah seinem engen Vertrauten in die Augen. »Sie halten es für wahr, Chris.«
»Ja, Sir.«
Der Präsident deutete auf die Ledermappe. »Wenn ich in meiner langen, wechselvollen politischen Laufbahn eines gelernt habe, dann dass eine Wahrheit ohne Fakten gefährlicher ist als eine Lüge.«
Hendricks trommelte mit den Fingern auf die Mappe. »Wieso das, Sir?«, fragte er ohne Groll, sondern mit ehrlichem Interesse.
Der Präsident seufzte tief. »Weil sich Gerüchte, Andeutungen und Vermutungen ohne Fakten sehr oft zu einem Mythos auswachsen, der sich in den Köpfen der Leute festsetzt. Es entsteht eine Figur, die viel mehr ist als ein normaler Mensch. Eher so was wie Nietzsches ›Übermensch‹.«
»Und Sie glauben, das ist hier der Fall?«
»Genau.«
»Und dieser Mann existiert nicht wirklich?«
»Das habe ich nicht gesagt.« Der Präsident legte die Unterarme auf den glänzenden Schreibtisch. »Was ich nicht glaube, sind all die Gerüchte, was er angeblich getan haben soll. Dafür gibt es überhaupt keine Beweise.«
Einige Augenblicke herrschte Schweigen im Oval Office. Von draußen hörte man kurz einen Laubbläser vor den Betonbarrieren, die das Gelände umgaben. Hendricks schaute aus dem Fenster, sah jedoch keine Blätter. Das passte irgendwie zu der geheimniskrämerischen Art, in der alles im Weißen Haus vor sich ging.
Hendricks räusperte sich. »Sir, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass er eine ernst zu nehmende Bedrohung für dieses Land darstellt.«
Die Augen des Präsidenten waren halb geschlossen, er atmete tief und gleichmäßig. Hätte Hendricks es nicht besser gewusst, hätte er gedacht, dass der Mann eingeschlafen war.
Der Präsident deutete auf den Bericht, und Hendricks schob ihm die Mappe über den Tisch zu. Der Präsident öffnete sie und blätterte die dicht bedruckten Seiten durch. »Erzählen Sie mir von Ihrem Laden.«
»Treadstone läuft schon ganz gut.«
»Beide Direktoren sind auf dem Laufenden?«
»Ja.«
»Sie sagen mir das ein bisschen zu schnell, Chris. Vor vier Monaten wurde Peter Marks von einer Bombe erwischt, als er in sein Auto einsteigen wollte. Gleichzeitig wurde Soraya Moore in Paris schwer verletzt.«
»Sie hat ihren Job erledigt.«
»Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen«, sagte der Präsident. »Ich mache mir einfach nur Sorgen.«
»Sie wurden eingehend gecheckt und sind körperlich und psychisch topfit.«
»Das freut mich wirklich zu hören, Chris. Aber diese beiden Direktoren sind schon einmalig in ihrer Art.«
»Inwiefern?«
»Kennen Sie vielleicht irgendeinen Geheimdienstdirektor, der ständig selbst draußen im Einsatz ist?«
»So läuft das nun einmal bei Treadstone. Es ist eine sehr kleine Organisation.«
»Ich weiß.« Der Präsident hielt einen Augenblick inne. »Und wie macht sich Dick Richards?«
»Er arbeitet sich gut ein.«
Der Präsident nickte und tippte sich mit dem Zeigefinger nachdenklich an die Unterlippe. »Na schön«, sagte er schließlich. »Setzen Sie Treadstone auf die Sache an, wenn Sie meinen – Marks, Moore, Richards, wen Sie wollen. Aber …« – er hob einen mahnenden Zeigefinger – »Sie liefern mir einen täglichen Bericht über Ihre Fortschritte. Und vor allem will ich Fakten, Chris. Liefern Sie mir Beweise, dass dieser Geschäftsmann …«
»Er ist ein Feind unseres Landes.«
»Was auch immer, ich will einen Beweis, dass wir uns um ihn kümmern müssen, ansonsten soll sich Ihr wertvolles Personal lieber mit wichtigeren Angelegenheiten befassen. Verstanden?«
»Ja, Sir.« Hendricks stand auf und verließ das Oval Office noch besorgter, als er gekommen war.
Als Soraya Moore vor drei Monaten aus Paris zurückgekehrt war, hatte sie Treadstone verändert vorgefunden. Zum einen war das Hauptquartier wegen der Autobombe, die in der Parkgarage hochgegangen war, von Washington nach Langley, Virginia, verlegt worden. Eine zweite Veränderung war der groß gewachsene, lattendürre Mann mit dem schütteren Haar und dem einnehmenden Lächeln.
»Wer hat meine alte Firma geklaut?«, hatte sie zu ihrem Kodirektor und engen Freund Peter Marks gesagt.
Peter hatte schallend gelacht und sie umarmt. Sie wusste, dass er sie nach Amun Chalthoum, dem Chef des ägyptischen Geheimdienstes, fragen wollte, der während ihrer Mission in Paris getötet worden war. Sie sah ihn warnend an, und er verkniff sich die Frage.
Der große dünne Mann trat aus seiner Arbeitsnische und hielt ihr die Hand hin. Er stellte sich als Dick Richards vor. Absurder Name, dachte Soraya.
»Schön, dass Sie wieder da sind«, sagte er freundlich.
Sie sah ihn fragend an. »Sie kennen mich doch gar nicht.«
»Ich habe viel von Ihnen gehört, seit ich hier bin, vor allem von Direktor Marks.« Er lächelte. »Wenn Sie möchten, würde ich Ihnen gern das Material zeigen, an dem ich arbeite.«
Sie setzte ein Lächeln auf, bis er ihnen schließlich zunickte und zurück an seinen Arbeitsplatz ging. Soraya wandte sich Peter zu. »Dick Richards? Heißt er wirklich so?«
»Klingt komisch, aber sein Name ist tatsächlich Richard Richards.«
»Was hat sich Hendricks dabei gedacht?«
»Richards ist nicht auf Hendricks’ Mist gewachsen. Der Präsident hat ihn uns geschickt.«
Soraya blickte zu Richards hinüber, der schon wieder an seinem Computer saß. »Dann haben wir wohl einen Spion im Haus?«
»Mag sein«, meinte Peter. »Immerhin scheint er eine Kanone im Aufspüren und Eliminieren von Spionagesoftware zu sein.«
Ihre Bemerkung war eigentlich als Scherz gemeint, doch Peters Antwort war durchaus ernst. »Heißt das, der Präsident vertraut Hendricks nicht mehr?«
»Nach allem, was passiert ist«, flüsterte Peter ihr ins Ohr, »sind wir dem Präsidenten anscheinend suspekt.«
Nach und nach überwanden Soraya und Peter das Trauma, das ihnen vor vier Monaten unabhängig voneinander widerfahren war. Es dauerte lange, bis sie imstande war, über Amun zu sprechen. Peter zeigte wie immer eine unendliche Geduld mit ihr; er wusste, sie würde ihm alles erzählen, wenn sie so weit war.
Sie hatten soeben einen Anruf von Hendricks erhalten, der in einer Stunde ein Briefing abhalten wollte. Ohne ein Wort zu sagen, griffen beide nach ihrer Jacke, um die Zeit bis dahin zu nutzen.
»Einsatzbesprechung in vierzig Minuten«, sagte die pummelige Blondine namens Tricia zu Peter, als sie zur Tür gingen. Peter brummte etwas, mit den Gedanken schon woanders.
Sie verließen das Gebäude, überquerten die Straße, besorgten sich Kaffee und Zimtschnecken und schlenderten in den Park mit seinen kahlen Bäumen, stets mit dem Rücken zum Treadstone-Gebäude.
»Das Schlimme ist«, begann sie, »dass Richards ein schlauer Bursche ist. Wir könnten ihn ganz gut gebrauchen.«
»Wenn wir ihm trauen könnten.«
Soraya nahm einen Schluck Kaffee, um sich innerlich aufzuwärmen. »Wir könnten versuchen, ihn auf unsere Seite zu ziehen.«
»Dann würden wir uns gegen den Präsidenten stellen.«
Sie zuckte die Achseln. »Ist das was Neues?«
Er lachte und nahm sie in die Arme. »Ich hab dich vermisst.«
Sie runzelte die Stirn und kaute nachdenklich einen Bissen Zimtschnecke. »Ich war lange in Paris.«
»Das wundert mich nicht. Die Stadt lässt einen nicht so schnell los.«
»Es war ein Schock, Amun zu verlieren.«
Peter war so einfühlsam, seine Meinung für sich zu behalten. Eine Weile schlenderten sie schweigend durch den Park. Ein Junge ließ mit seinem Vater einen Bat-Signal-Drachen steigen. Sie lachten ausgelassen, und der Vater legte dem Jungen den Arm um die Schultern. Der Drachen stieg immer höher.
Soraya betrachtete die beiden und hob den Blick zum Drachen hinauf. »Als es vorbei war«, sagte sie schließlich, »da fragte ich mich: Was tu ich eigentlich? Will ich mein ganzes Leben so verbringen – Freunde verlieren und …?« Einen Moment lang konnte sie nicht weitersprechen. Sie hatte starke, wenn auch widersprüchliche Gefühle für Amun. Eine Zeit lang hatte sie sogar geglaubt, ihn zu lieben, doch das hatte sich als Irrtum herausgestellt. Die Erkenntnis verstärkte ihre Schuldgefühle noch mehr. Wenn sie ihn nicht darum gebeten und er sie nicht geliebt hätte, wäre er nie nach Paris gekommen. Dann würde er jetzt noch leben.
Sie hatte ihren Appetit verloren und schenkte ihren Kaffee und den Rest der Zimtschnecke einem Obdachlosen auf einer Bank, der erstaunt aufblickte und sich dann mit einem Kopfnicken bedankte. Nachdem sie sich ein Stück von ihm entfernt hatten, sagte sie leise: »Peter, ich kann mich selbst nicht mehr leiden.«
»Du bist auch nur ein Mensch.«
»Oh, bitte.«
»Hast du vorher nie Fehler gemacht?«
»Nur ein Mensch, ja«, sagte sie mit gesenktem Kopf. »Aber ein so schwerer Fehler darf mir nicht wieder passieren.«
Erneut verfiel sie in tiefes Schweigen, so lange, dass Peter sich Sorgen zu machen begann. »Du hast doch nicht etwa vor, alles hinzuschmeißen?«
»Vielleicht gehe ich wieder nach Paris.«
»Im Ernst?«
Sie nickte.
Peters Gesichtsausdruck veränderte sich plötzlich. »Du hast jemanden kennengelernt.«
»Kann sein.«
»Kein Franzose. Sag nicht, du hast einen Franzosen kennengelernt.«
Schweigend beobachtete sie, wie der Drachen immer höher stieg.
Er lachte. »Okay, dann geh«, sagte er. »Nein, geh nicht. Bitte.«
»Es ist nicht nur das«, erklärte sie. »In Paris ist mir klar geworden, dass es mehr gibt als dieses Leben im Schatten.«
Peter schüttelte den Kopf. »Wenn ich nur wüsste, was ich sagen soll …«
Plötzlich gab ein Bein unter ihr nach. Sie taumelte und wäre gefallen, hätte Peter nicht seinen Kaffeebecher fallen lassen und sie gestützt. Besorgt führte er sie zu einer Bank. Sie setzte sich, beugte sich vor und barg den Kopf in beiden Händen.
»Atme erst mal tief durch«, sagte er und legte ihr die Hand auf den Rücken. »Schön langsam.«
Sie nickte und folgte seinem Rat.
»Soraya, was hat das zu bedeuten?«
»Nichts.«
»Einen alten Schwindler kannst du nicht anschwindeln.«
Sie nahm einen tiefen Atemzug und ließ die Luft langsam entweichen. »Ich weiß es nicht. Seit dem Krankenhaus habe ich immer wieder diese Schwindelanfälle.«
»Warst du schon beim Arzt?«
»In letzter Zeit passierte es immer seltener. Das letzte Mal vor zwei Wochen.«
»Und jetzt wieder.« Er strich ihr mit der Hand über den Rücken, um sie zu beruhigen. »Du musst unbedingt zum …«
»Hör auf, mich wie ein Kind zu behandeln.«
»Dann hör auf, dich wie ein Kind zu benehmen.« Mit sanfterer Stimme fügte er hinzu: »Ich mach mir einfach Sorgen, und es wundert mich, dass du es nicht selbst ernst nimmst.«
»Na schön«, gab sie schließlich nach.
»Du kannst also jetzt nicht weg«, erwiderte er halb im Scherz. »Erst musst du …«
Sie lachte und hob endlich den Kopf. In ihren Augenwinkeln schimmerten Tränen. »Genau das ist mein Dilemma.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich finde einfach keinen Frieden, Peter.«
»Du meinst, du verdienst gar keinen Frieden.«
Sie sah ihn an, und er zuckte mit den Achseln und lächelte ein wenig zögerlich. »Vielleicht sollten wir einander erklären, warum wir beide ein bisschen Glück verdienen.«
Sie stand auf, ohne sich von ihm helfen zu lassen, und sie gingen auf dem Weg zurück. Der Obdachlose war mit dem Frühstück fertig, das ihm Soraya spendiert hatte, und lag mit angezogenen Beinen auf der Bank, mit ein paar Blättern der Washington Post zugedeckt.
Im Vorbeigehen hörten sie ihn laut schnarchen, als könnte ihn nichts auf der Welt aus der Ruhe bringen. Und vielleicht war es auch so, dachte sie.
Sie wandte sich Peter zu. »Was würde ich nur ohne dich anfangen?«
Sein Lächeln wurde breiter, während er an ihrer Seite schlenderte. »Weißt du, das frag ich mich auch oft.«
»Weg?«, sagte der Direktor. »Wie weg?«
Über seinem Kopf prangte das aktuelle Mossad-Motto aus dem Alten Testament, Sprüche Salomos 11,14: Wo nicht weiser Rat ist, da geht das Volk unter; wo aber viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe.
»Sie ist untergetaucht«, antwortete Dani Amit, der Leiter der Mossad-Abteilung für Informationsbeschaffung. »Niemand weiß, wo.«
»Wir müssen sie unbedingt finden.« Der Direktor schüttelte seinen Zottelkopf und schürzte die Lippen, ein Zeichen seiner Anspannung. »Rebekka ist eine zentrale Figur in dieser Angelegenheit.«
»Das ist mir klar, Sir. Uns allen.«
»Dann …«
Dani Amits blaue Augen wirkten unendlich traurig. »Wir sind einfach machtlos.«
»Wie kann das sein? Sie ist doch eine von uns.«
»Genau das ist das Problem. Wir haben ihr zu viel beigebracht.«
»Trotzdem müssten unsere Leute sie finden, schließlich sind sie genauso gut ausgebildet. Aber anscheinend ist sie besser.« Der Vorwurf war nicht zu überhören.
»Ich fürchte …«
»Ausreden helfen uns jetzt nicht weiter«, fiel ihm der Direktor ins Wort. »Ihr Job bei der Fluglinie?«
»Eine Sackgasse. Auch dort haben sie seit dem Vorfall in Damaskus vor sechs Wochen keinen Kontakt mehr mit ihr.«
»Was ist mit ihrem Telefon?«
»Sie hat es entweder weggeworfen oder das GPS abgestellt.«
»Freunde, Verwandte.«
»Haben wir alle befragt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Rebekka niemandem von uns erzählt hat.«
»Ein solcher Verstoß …«
Er brauchte den Satz nicht zu Ende zu sprechen. Die internen Regeln des Mossad waren wie die Zehn Gebote, und Rebekka hatte gegen das oberste verstoßen.
Der Direktor drehte sich um und starrte mürrisch aus dem Fenster seines Satellitenbüros im obersten Stockwerk eines Bürogebäudes in Herzlia. Am anderen Ende der Stadt befanden sich die Mossad-Akademie und die Sommerresidenz des Ministerpräsidenten. Der Direktor kam oft hierher, wenn er melancholisch wurde und ihn die Atmosphäre im Hauptquartier im nahen Tel Aviv nervte. Hier stand ein Brunnen in der kreisförmigen Auffahrt, und duftende Blumen blühten das ganze Jahr über, ganz zu schweigen vom nahen Hafen mit seinen Segelbooten, die sich sanft auf ihren Liegeplätzen wiegten. Der Wald aus Masten hatte etwas Beruhigendes an sich, selbst für Amit. Die Boote vermittelten ein Gefühl von Beständigkeit in einer Welt, in der sich von einem Moment auf den anderen alles ändern konnte.
Der Direktor segelte für sein Leben gern. Wann immer er einen Mann verlor – was zum Glück nicht so oft vorkam –, fuhr er mit seinem Boot hinaus, allein mit dem Meer und dem Wind und den klagenden Rufen der Möwen. »Findet sie, Dani«, sagte er schroff, ohne sich umzudrehen. »Krieg raus, warum sie sich über die Anweisungen hinweggesetzt hat. Und auch, was sie weiß.«
»Ich glaube nicht …«
»Sie hat uns verraten.« Der Direktor wirbelte herum und beugte sich vor. Der Bürostuhl ächzte unter seiner massigen Gestalt. Er legte seine ganze Autorität in jedes einzelne Wort. »Sie ist eine Verräterin. Wir werden dementsprechend mit ihr verfahren.«
»Memuneh, ich weiß nicht, ob es klug ist, vorschnelle Entscheidungen zu treffen.« Amit hatte ihn mit dem internen Titel angesprochen, der so viel wie Erster unter Gleichen bedeutete.
Die kugel- und bombensicheren Fenster waren mit einer Schutzschicht gegen Spionagevorrichtungen versehen, sodass man sich in dem Raum ein bisschen vorkam wie unter Wasser. Die Augen des Direktors schimmerten im gedämpften Licht wie die eines Tiefseefisches im Schein der Kopflampe eines Tauchers. »Ich weiß, dass sie deine Lieblingsschülerin ist, aber es wird Zeit, deinen Irrtum einzugestehen. Wir haben vielleicht keinen hundertprozentigen Beweis für Rebekkas Verrat, aber uns läuft die Zeit davon. Die Ereignisse drohen uns zu überrollen. Wir sind alte Freunde und Waffenbrüder. Zwing mich nicht, die Duvdevan einzuschalten.«
Die Erwähnung der Eliteeinheit der israelischen Streitkräfte ließ Amit schaudern. Es zeigte Rebekkas enorme Bedeutung für die israelische Sicherheit, dass der Direktor mit der Duvdevan drohte, um Amit zu einer Vorgehensweise zu bewegen, die ihm zutiefst widerstrebte.
»Wen setzt du ein?« Es klang so beiläufig, als würde er Amit fragen, wie es der Familie ging.
»Was ist mit ihren einzigartigen Fähigkeiten, ihrer Vielseitigkeit …«
»Ihr Verrat wiegt schwerer als alles andere, Amit, auch als ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten. Wir müssen davon ausgehen, dass sie etwas Brisantes herausgefunden hat. Was ist, wenn sie ihre Informationen an den Höchstbietenden verkauft?«
»Ausgeschlossen«, schoss Amit empört zurück.
Der Direktor musterte ihn einen Moment lang mit halb geschlossenen Augen. »Bis zum heutigen Tag hättest du wahrscheinlich auch gesagt, dass sie unmöglich spurlos verschwinden kann.« Er wartete. »Oder irre ich mich?«
»Nein«, gab Amit kopfschüttelnd zu.
»Also.« Der Direktor faltete seine Finger ineinander. »Wen setzt du dafür ein?«
»Ilan Halevy«, sagte Amit schweren Herzens.
»Den Babylonier.« Der Direktor nickte beeindruckt. Ilan hatte seinen Operationsnamen erworben, indem er fast im Alleingang das irakische »Babylon«-Waffenprojekt zu Fall brachte. Er hatte dabei mehr als ein Dutzend feindliche Sicherheitsleute getötet. »Okay, jetzt kommen wir zum Kern der Sache.«
Mit seiner eisernen Hand hatte der Direktor das Schiff in den letzten fünf Jahren durch die raue See der internationalen Spionage gesteuert, mit Operationen auf feindlichem Territorium und staatlich sanktionierten Exekutionen, während die eigenen Opfer auf ein Minimum beschränkt blieben. Der Tod eines eigenen Agenten bereitete ihm körperlichen Schmerz, weshalb er sich in diesem Fall in die Einsamkeit des Meeres zurückziehen musste. Dort verarbeitete er seine Trauer und klärte seine Gedanken.
»Wann gibst du ihm grünes Licht?«
»Sofort«, sagte Amit. »Er kennt Rebekka besser als die meisten.«
»Außer dir.«
Amit wusste, was der Direktor ihm damit nahelegen wollte. »Ich werde den Babylonier persönlich auf die Mission vorbereiten. Er wird alles wissen, was ich weiß.«
Das war gelogen, und Amit vermutete, dass sein alter Freund das auch wusste, doch zum Glück sagte der Direktor nichts. Wie konnte er dem Babylonier alles über Rebekka sagen, was er wusste? Diesen Verrat würde er nicht begehen, auch nicht dem Direktor zuliebe. Er hatte gelogen, um einem eventuellen Befehl zuvorzukommen, alles, was er wusste, an den Babylonier weiterzugeben. Diesem moralischen Dilemma wollte er ausweichen.
Der Bürostuhl ächzte erneut, als sich der Direktor wieder dem Panorama der Stadt zuwandte. Wer wusste, was er in diesem Moment dachte? »Dann haben wir das geklärt.« Wie zu sich selbst fügte er hinzu: »Es ist erledigt.«
Amit stand auf und ging schweigend hinaus. Es waren keine weiteren Worte nötig.
Draußen auf dem Flur blieb er stehen, als wüsste er nicht, wohin. Manchmal lud ihn der Direktor ein, mit ihm hinauszusegeln, wenn es wieder einmal einen Mann oder eine Frau zu betrauern gab, die ihr Leben für die Sicherheit ihres Landes geopfert hatten. Amit stellte sich vor, dass sich dieses Ritual wiederholen würde, wenn Rebekka tot war.
2
Als er zu sich kam, schwamm er immer noch durch das eiskalte, pechschwarze Wasser. Er spürte es brennend in der Nase, und es drohte bereits in die Lunge einzudringen. Er ging hilflos unter. Verzweifelt streifte er die Schuhe ab, zog Schlüssel, Brieftasche und eine dicke Rolle schwedische Kronen heraus, um sich zu erleichtern. Dennoch zog es ihn weiter in die Tiefe.
Er schrie nur deshalb nicht, weil er Angst hatte, den Mund zu öffnen und das Eindringen des Wassers nicht mehr verhindern zu können. Er schreckte hoch, am ganzen Körper zitternd, während er sich immer noch in dem eiskalten Wasser an die Oberfläche kämpfte.
Etwas packte ihn an den Armen, wollte ihn festhalten, und er öffnete die Augen in dem verschwommenen Halbdunkel. Erneut stieg die Angst in ihm auf. Er war auf dem Meeresgrund und halluzinierte, während er ertrank.
»Ist schon gut«, sagte jemand. »Sie sind in Sicherheit. Jetzt ist alles gut.«
Es kam ihm vor wie eine Ewigkeit, bis er anfing, sich zu beruhigen – zu fest hatte ihn die Angst im Griff. Wieder hörte er die Worte, doch sie ergaben immer noch keinen Sinn – ebenso wenig die Tatsache, dass es nicht mehr so dunkel war und er plötzlich atmen konnte, und schon gar nicht die beiden Gesichter vor ihm, die ganz normal sprachen und atmeten, obwohl sie doch alle unter Wasser waren.
»Das Licht«, sagte eine zweite Stimme. »Er glaubt … Schalten Sie das Licht ein.«
Grelles Licht ließ ihn die Augen zusammenkneifen. War eine solche Helligkeit auf dem Meeresgrund möglich? Ein drittes Mal hörte er die Worte, ehe sie durch die Risse im Panzer seiner Angst einsickerten, und er begriff, dass er ganz normal atmete, so wie die beiden Männer vor ihm. Das konnte nur eines bedeuten: Er würde doch nicht ertrinken.
Mit dieser Erkenntnis begann er die Schmerzen im Kopf zu spüren und zuckte zusammen. Doch wenigstens sein Körper begann sich zu entspannen; er kämpfte nicht mehr gegen die Hände an, die ihn festhielten. Er ließ sich von ihnen zurück aufs Bett legen. Er fühlte etwas Weiches unter sich, trocken und fest – eine Matratze –, und ihm war endlich klar, dass er sich nicht auf dem Meeresgrund befand, auf den Tod wartend.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!